Manchmal stößt man im vorbeigehen auf interessante Bücher: So kaufte ich z.B. mal einem Dichter sein Werk in der U-Bahn ab, ein Taxifahrer verkaufte mir während der Fahrt seine Autobiographie, von einem Chinesen erwarb ich am Reichstag eine Chronik seines Kampfes mit der Bayernhypo und der Ostberliner Althippie Willi verkaufte mir seine Biographie von einer Parkbank in Prenzlauer Berg weg. Neulich lernte ich an einer Theke den Pädagogen Alfons Rujner kennen, der mir an Ort und Stelle die im Selbstverlag erschienene Geschichte seiner Jugend in russischer Kriegsgefangenschaft: “Mit 17 hinter Stacheldraht” verkaufte. Das Stettiner Arbeiterkind war in den letzten Kriegstagen noch eingezogen worden und hatte sich dann den Amis ergeben, die ihn jedoch den Sowjets übergaben, damit er dort – “Back in the USSR” – beim Wiederaufbau helfe. Der kleine aber sportliche Alfons kam nach einem langen Marsch durch Tschechien und wochenlanger Bahnfahrt in ein Arbeitslager bei einem abgebrannten Dorf in der Nähe von Brjansk, wo die deutschen Kriegsgefangenen zunächst in Zelten hausten. Für den Winter bauten die 300 Gefangenen sich dort eine kaputte Scheune aus. Der Verwaltungsangestellten-Lehrling Rujner lernte Mauern, Tischlern und Bäume fällen, wobei man ihren Brigaden “kundige Dorfbewohner als Helfer” zuteilte. Von ihnen sowie von der Lagerleitung lernt er zu improvisieren: “Den Satz ,Es geht nicht’ hatten die Russen aus ihrem Wortschatz gestrichen”. Viele Dörfler bekamen niedrigere Lebensmittelrationen als die deutschen Kriegsgefangenen, die manchmal sogar von hungrigen Kindern angebettelt wurden. Der Autor reifte im Lager langsam zu einem “Iwanfreund” – und bezog deswegen von einigen “Unverbesserlichen” Schläge. Nach einem Jahr wagten die Gefangenen ein Flugblatt zu verfassen, in dem sie sich über Verpflegungsmängel beschwerten und das sie am Scheunentor befestigten. Sie befürchteten, deswegen streng bestraft zu werden, aber das Gegenteil passierte: Der Kulturoffizier fragte sie, ob sie ihre Kritik veröffentlichen würden – und richtete ihnen eine “Wandzeitung” ein. Der Autor wurde zum Chefredakteur gewählt. Neben Beschwerden z.B. über mangelnde Hygiene veröffentlichte er auch “ausgewählte Nachrichten” aus Deutschland”. Damals begann er, sich “für das Schreiben zu interessieren”. Es entwickelte sich ein “kulturelles Leben” im Lager, u.a. veranstaltete der Kulturoffizier eine Dichterlesung, dazu las er aus Heinrich Heines “Deutschland, ein Wintermärchen”, das fast keiner der Landser kannte, anschließend wurde darüber diskutiert. Beim nächsten Mal trug er Heines Gedicht “Loreley” vor. Dies war zwar vielen bekannt, jedoch nicht, dass es von Heine stammte: In ihren Schulbüchern stand “Verfasser unbekannt”. Mir ging es noch 1998 im sibirischen Irkutsk so, dass eine junge Friseusin, als sie hörte, ich sei Deutscher, sofort “Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…” deklamierte – und hinzufügte: “Geinrich Geine”. Was?! sagte ich, das ist doch nicht von Heine. Erst nach einer ganzen Weile ließ ich mich überzeugen. Ab 1947 durften die Gefangenen Briefe schreiben und empfangen – und es gab “mehr Kultur als Fressen” im Lager. Grujner versuchte – vergeblich – über das Rote Kreuz Kontakt mit seiner vertriebenen Familie aufzunehmen. Der Kulturoffizier gab ihm daraufhin eine DDR-Zeitung und schlug vor, einen Leserbrief aus dem Lager über ihre Wiederaufbau-Arbeit zu verfassen und darin eine Suchmeldung unterzubringen. “An den paar Sätzen habe ich lange gefeilt,” schreibt der Autor. Die Zeitung hieß “Start” und war Vorläufer der “Jungen Welt”. Sie druckte den Brief ab – und tatsächlich erhielt er daraufhin Post von seinem Bruder. Alfons Rujner war überglücklich: seine Familie lebte. Als er 1948 nach Deutschland zurückkehrte, bedankte er sich bei der Zeitung, für die er dann öfter schrieb. Auch in der DDR wurde er noch einige Male als “Iwanfreund” beschimpft und sogar tätlich angegriffen, wenn er “die Wahrheit” über seine Zwangsarbeitsjahre in der UDSSR erzählte und dass ihm dort eine jüdisch-russische Ärztin das Leben rettete, was ihm dann hier 2001 anläßlich einer Herzoperation sogar noch einmal passierte. Diese zweite Ärztin gab dann den “Hauptanstoß”, seine Russlanderinnerungen aufzuschreiben: eine schöne Geschichte.
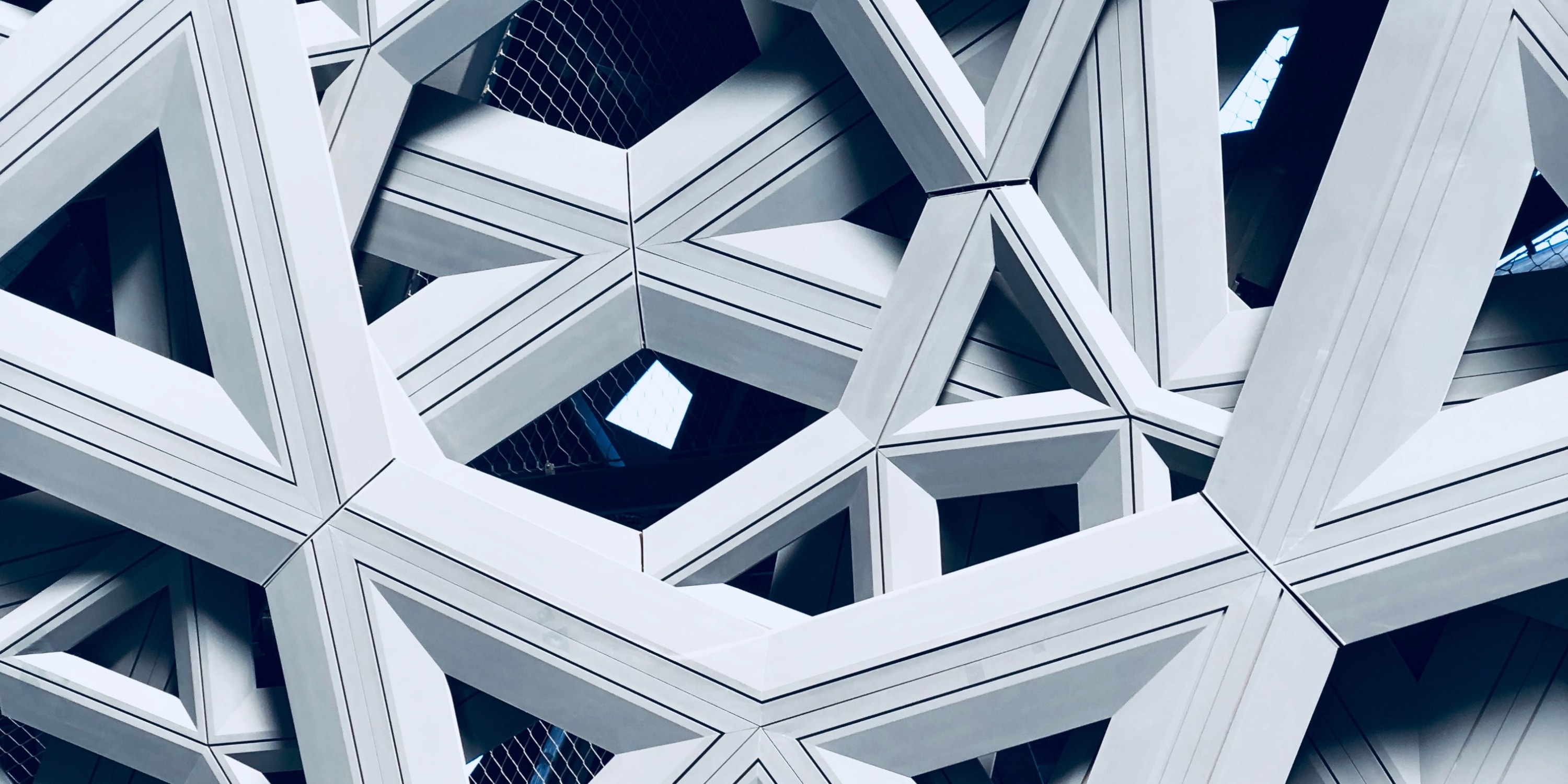
Anzeige



Lieber Helmut, ich habe gerade deinen Hausmeisterblog entdeckt, kannte dich bisher nur von der JW “Die Wirtschaft als das Leben selbst” und Scheinschlag. Hier machst Du ja auch was Feines. Viele Grüße vom dicken Mann soll ich bestellen und wünsche mit ihm gemeinsam ein waches 2007. Antje