Der neue “Campus”-Band “Konsumguerilla” von 22 Wissenschaftlern heißt im Untertitel – etwas zurückhaltender als der des Buches “Marke Eigenbau” von Friebe und Ramge: “Widerstand gegen Massenkultur” – mit Fragezeichen. Immer wieder geht es darin jedoch um das selbe Phänomen, das auch der Trendschnüffler Mathias Horx (“Technovolution”) und die Trendforscher Norbert Bolz (“Das konsumistische Manifest”) sowie Boris Groys (“Der Künstler als Konsument”) gerne bearbeiten.
Die Herausgeber – Birgit Richard, Alexander Ruhl und Hary Wolff – schreiben: “Der Band befaßt sich mit unterschiedlichen Ebenen des Konsums sowie damit verbundenen, (sub-)kulturell überformten Konsumpraktiken und -stilen.” Ihre Autoren stützen sich dabei u.a. auf Michel de Certeaus alltagspartisanische Spurensuche “Kunst des Handelns”, Roland Barthes Produktsemiotik “Mythen des Alltags”, Thorstein Veblens “Theorie der feinen Leute”, Walter Benjamins “Passagenwerk”, Wolfgang Fritz Haugs “Kritik der Warenästhetik”, Daniel Millers “Theorie des Shopping”, Pierre Bourdieus Distinktionsanalyse “Die feinen Unterschiede” und Jay Conrad Levinsons Wirtschaftsratgeber “Guerilla-Marketing”.
“Dem Guerilla-Image wohnt ein eigener, durchaus auch marktfähiger Charme inne, der daher auch hervorragend als Aufmacher einer Marketingstrategie eingesetzt werden kann,” schreiben die Herausgeber – und wagen einige Reproduktionsprognosen: “Unterscheidungen zwischen Bedürfnissen und Wünschen sind nicht mehr möglich” und “Souveräner Konsum avanciert zur elementaren Bürgerpflicht.” Aus “Schnäppchenjägern” werden also “Smart Shopper” – und der Weg dahin geht über die “Konsumguerilla”:
“Ehemals passive EndverbraucherInnen, denen kaum nennenswerte Eigenaktivität zugebilligt wurde und bei denen man davon ausging, dass sie mit Angeboten des Marktes meist relativ planmäßig umgingen, melden sich nun weithin vernehmlich zu Wort und vertreten ihre eigene Interpretation der Bedeutungen, die mit Konsumweisen und Produkten einhergehen.”
Und das geschieht über das Internet, dem die Autoren den Hauptteil ihrer Aufmerksamkeit widmen, nicht zuletzt deswegen, weil z.B. die Bastler ihre Produkte damit weltweit vermarkten können – und sich selbst gleich mit: z.B. auf “YouTube”, “MySpace” usw..
Der im Buch interviewte Poptheoretiker Diedrich Diederichsen versteht unter “Konsumguerilla” 1. dass die Bedeutung von Produkten subversiv angegangen wird (“das Hijacken von Logos und Zeichen”), eine Idee, “an die aber heute keiner mehr recht glaubt”, weil “die Stabilität der Verhältnisse nicht so direkt von bestimmten Bedeutungskulturen abhängig ist. Mit solchen Praktiken ist man mittlerweile auf der Marktseite gelandet.” 2. “dass Waren etwas versprechen, was sie selbstverständlich nicht halten. Ich denke, das ist der Ansatzpunkt: Das Versprechen der Waren mobilisieren.” Jedoch nicht auf deren Feld: “Ich denke eigentlich, dass man dem Prinzip der Ware nicht mit alternativen Waren entgegentreten kann. Man muß auf der Ebene des Prinzips oder eben gegen es agieren.” Die “human hergestellte oder die besser oder fairer hergestellte bzw. fairer gehandelte Ware ist nicht die Lösung des Problems.” 3. Die Lösung oder vielmehr “das eigentliche Thema” sieht Diederichsen in der “Künstlerposition”, also dass man sich in der Kunst die Frage stellt: “Was wäre ein Objekt, ein Fetisch, eine Haltung, ein Prozeß, ein Versprechen, das anders funktioniert als Ware.” Früher habe man auf “partizipatorische Prozesse als Gegenmodell gesetzt”. Heute laufe z.B. vieles darauf hinaus, “dass man dem körperlich vereinzelten, im globalen Datennetzwerk vergesellschafteten Subjekt wieder eine räumliche Dimension zur Seite” stellt. Also “Myspace” und “Face-to-Face” kombiniert. Wird das aber nicht bei “YouPorn.com” bereits praktiziert?
Überhaupt darf man sich wundern, dass die Autoren von “Marke Eigenbau” die Webpornographie, die sicher den größten “Raum” von allen “Kommunikations”-Angeboten dort einnimmt, nicht thematisieren. Der Filmkritiker Georg Seeßlen schrieb vor einiger Zeit:
“Die Pornographie hat seit den Neunzigerjahren…ihre eigene politische Ökonomie zum Inhalt. Der pornographische Diskurs verwirft den weiblichen Körper nicht mehr (um ihn in einem seltsamen Jenseits, dem Pornotopia der Literatur wie des ‘Rotlichtmilieus’ und allen ihren Romantisierungen, zu restaurieren), er fügt ihn vielmehr in den Mainstream ein…Pornographie ist die letzte große Illusion der Teilhabe der unnützen Menschen am System.” Die “alte ‘Elendsprostitution’ – vorwiegend in der Form der sexuellen Ausbeutung der proletarischen Frau durch den bürgerlichen Mann oder der kolonialisierten Frau durch den kolonialistischen Mann” – hält er nur noch für einen “Störfaktor” – in der Entwicklung der globalen Prostitution, “die den Wert des ‘fuckable’ Menschen nicht durch institutionellen Zwang, sondern durch Marktkonkurrenz bestimmt…’Dein Körper gehört dir, nicht wie ein geistiges oder historisches Eigentum, sondern wie ein Auto oder ein Bankkonto, …du kannst ihn verkaufen, vermieten, drauf sitzenbleiben, ihm Mehrwert abtrotzen oder ihn verspekulieren’.”
Nun breitet sich die Pornographie via Internet zwar geradezu epidemisch aus – und die Pornobranche “beschäftigt” inzwischen auch schon wahre Massen, außerdem gibt es immer mehr Pornos der “Marke Eigenbau” im Netz, daneben drängt sich jedoch noch ein anderes Internet-Phänomen in den Vordergrund, dass die traditionelle Prostitution noch gründlicher verändert. Gemeint sind die “Partnersuchdienste”, die bereits von zigmillionen Menschen weltweit in Anspruch genommen werden.
Bei der Zerschlagung bzw. Privatisierung der bisherigen Wirtschaftseinheiten und der wachsenden Priorität des Individuums vor allem Gesellschaftlichen – bietet sich, so wird gesagt, als neue Möglichkeit, um zueinander zu finden, das Internet in hervorragender Weise an. So meinen einige ihrer Nutzerkollektive – “Indymedia” und “Labournet” z.B., dass sich damit eine neue Alternative zu den alten Gewerkschaften und sonstigen politischen Organisationsformen auftut. Das Berliner online-magazin “infopartisan” kam unterdes nach über zehnjährigen Bestehen zu dem entgegengesetzten Resultat, dass man die Leute nicht über so ein Internetforum organisieren könne – damit werde das Pferd gewissermaßen von hinten aufgezäumt: “Sie müssen sich erst zu konkreten Aktivitäten (in der Wirklichkeit) zusammenfinden, damit das Internet für sie brauchbar wird”.
Dies gilt in etwa auch für Liebespaare – oder galt vielmehr, denn mit der nahezu weltweiten Ausbreitung der “Online-Partnersuchdienste” hat sich die Anbahnung von Beziehungen, das Zueinanderfinden von “Singles”, die nicht mehr länger allein sein wollen, umgedreht, d.h. sie treten erst an die Öffentlichkeit – indem sie ein Photo von sich, einen Text über sich sowie ihre Partnerwünsche – ins Netz stellen, um sich dann ggf. mit einem oder mehreren, die darauf ihrerseits mit einem ähnlichen “Profil” reagiert haben, zu treffen – d.h. zu privatisieren. Die israelische Kulturwissenschaftlerin Eva Illouz hat einige Benutzer dieser Partnersuchdienste befragt. Indem sie ein “Profil” von sich erstellen und es ins Internet stellen, wird ihr “privates Selbst in einen öffentlichen Auftritt verwandelt”. Dadurch erfährt die “Ordnung, in der romantische Interaktionen traditionellerweise stattfinden, eine Umkehrung…Die virtuelle Begegnung wird so buchstäblich innerhalb der Marktstrukturen organisiert…Das Internet setzt jeden, der nach anderen sucht, auf einem offenen Markt der Konkurrenz mit anderen aus. Meldet man sich auf einer Seite an, ist man sofort in einer Position, in der man mit anderen konkurriert, die man sogar sehen kann.” Dadurch macht das Internet “aus dem Selbst eine öffentlich ausgestellte Ware”, d.h. doch wohl, dass auch und gerade die seriösesten “Partnersuchdienste” wie Bordelle funktionieren – oder anders gesagt, dass wir uns alle prostituieren müssen, wenn wir nicht länger allein sein wollen. Damit ist jedoch die Prostitution (d.h. das Zur-Schau-Stellen, Ausstellen) im eigentlichen Sinne an ihr Ende gekommen. Eva Illouz sagt es so: “Durch die Präsentation (mit Photo und Text) finden sich die Individuen buchstäblich in der Position von Leuten wieder, die für die Schönheitsindustrie als Models oder Schauspieler arbeiten, d.h. sie finden sich in einer Position wieder, a) die ihnen ein Höchstmaß an Bewußtsein für ihre physische Erscheinung abverlangt; b) in der ihr Körper die Hauptquelle sozialer und ökonomischer Werte ist; c) wo sie über ihren Körper in Konkurrenz zu anderen treten; d) wo ihr Körper und ihre Erscheinung insgesamt öffentlich ausgestellt werden.”
Eva Illouz kommt bei der Sichtung der “photographischen Profile” in den Internet-Partnersuchdiensten zu dem Resultat, daß sie “mit den etablierten Richtlinien für Schönheit und Fitness” übereinstimmen, während die Texte zur “Präsentation des Selbst” sich durch “Uniformität, Standardisierung und Verdinglichung” auszeichnen. Letzteres kann man auch den deutschen Veranstaltungsmagazinen entnehmen, in denen immer mehr “Kontaktanzeigen” abgedruckt werden, die ähnlich formuliert sind – sowohl was die Selbstbeschreibung als auch was den Wunschpartner betrifft. Am Ende steht sehr oft eine Emailadresse, so daß sich die Kontaktanbahnung vom Printmedium erst einmal ins Internet verlagert, wo dann auch meist Photographien ausgetauscht werden. Die an diesem “Verfahren” Interessierten stehen damit laut Eva Illouz vor dem Problem, wie sie mit der immer “größer werdenden Zahl und Geschwindigkeit romantischen Konsums und romantischer Tauschgeschäfte umgehen sollen.” Mit diesem Oxymoron bezeichnet die Kulturwissenschaftlerin einen “Prozeß”, der sich dem des “Tele-Marketings” angleicht: “Das Selbst muß hier wählen und seine Optionen maximieren, es ist gezwungen, Kosten-Nutzen-Analysen und Effizienzberechnungen durchzuführen.” Auf diese Weise “radikalisiert das Internet die Forderung, für sich selbst das beste (ökonomische und psychologische) Geschäft zu machen”…d.h. nach Wegen zur “Verbesserung der eigenen Marktposition zu suchen”.
Die Prostitution geht in diesem massenhaften “romantischen Konsum” auf, der seinerseits nichts anderes als ein Beziehungsgeschäft ist: “Fast alle meine Interviepartner, sowohl in Israel als auch in den USA, haben erwähnt, daß ein Treffen von ihnen verlangt, sich zu ‘vermarkten’ und sich so zu verhalten, als ginge es um ein Jobinterview” – ein Vorstellungsgespräch, bei dem sie sich optimal präsentieren müssen, um genommen zu werden. Anders als bei den wirklichen Vorstellungsgesprächen trifft dies jedoch sowohl auf den Interviewten als auch auf den Interviewer zu, die ihre Rollen beim Treffen ständig austauschen (müssen). Slavoj Zizek meint, daß die “Illusion” damit “schon auf der Seite der Realität selbst” ist, “auf der Seite dessen, was Menschen tun”. Dies geschieht über das Internet, das nun laut Eva Illouz einen “radikalen Bruch mit der Kultur der Liebe und der Romantik” vollzieht.
Die slowenische Philosophin Alenka Zupancic veröffentlichte unlängst ein schmales Büchlein mit dem Titel “Das Reale einer Illusion”. Darin legt sie nahe, dass der Konsumismus eine eigene neue “Ethik” mit (sich) bringt. Es geht ihr demgegenüber jedoch nicht “etwa um einen Aufruf ‘nach unseren tiefsten Überzeugungen’ zu handeln, eine Haltung, der heute eine Ideologie entspricht, die uns ermahnt, unseren ‘authentischen Neigungen’ und unserem ‘wahren Selbst’ Gehör zu schenken.” Denn “das Kennzeichen einer freien Handlung liegt darin, dass sie den Neigungen des Subjekts ganz fremd ist”, wie Zupancic anhand ihres Traktats “über” Kant, das eine “Rückkehr zur Zukunft” ist, herausarbeitet. Es geht darin um Kants “Ethik”, die im Zuge der Umwandlung des Sozialstaats zu einem Sicherheitsstaat, der mit kostengünstigen Gesetzen nur so um sich wirft, immer mehr in deren Dienste genommen wird: Und das eben ist die Scheiße!
Denn dadurch wird die Ethik etwas “im Kern Restriktives, eine Funktion”. Möglich wird dies laut Zupancic dadurch, dass man “jeder Erfindung oder Schöpfung des Guten entsagt und ganz im Gegenteil als höchstes Gut ein bereits fest Etabliertes oder Gegebenes annimmt (das Leben etwa) und Ethik als Erhaltung dieses Gutes definiert.” Das Leben mag die Voraussetzung jeder Ausübung von Ethik sein, aber wenn man aus dieser Voraussetzung das letzte Ziel der Ethik macht, ist es Schluß mit der Ethik. Sie basiert nunmehr auf einer regelrechten Ideologie des Lebens. “Das Leben sagt man uns, ist zu kurz und zu ‘kostbar’, um sich in die Verfolgung dieser oder jener ‘illusorischen’ Projekte verstricken zu lassen”. Die Individuen müssen sich immer öfter Fragen lassen: Was hast du aus deinem Leben gemacht? Du hast zehn Jahre mit einer Sache verloren, die zu keinem greifbaren Ergebnis geführt hat? Du hast keine Nachkommen? Du bist nicht einmal berühmt? Wo sind denn die Ergebnisse deines Lebens? Bist du wenigstens glücklich? Nicht einmal das! Du rauchst?”
Man wird nicht nur für sein Unglück verantwortlich gemacht, “die Lage ist noch viel perverser: das Unglück wird zur Hauptquelle der Schuldigkeit, zum Zeichen dafür, dass wir nicht auf der Höhe dieses wunderbaren Lebens waren, das uns ‘geschenkt’ worden ist. Man ist nicht etwa elend, weil man sich schuldig fühlt, man ist schuldig, weil man sich elend fühlt. Das Unglück ist Folge eines moralischen Fehlers. Wenn du also moralisch sein willst, dann sei glücklich!” Der Autorin geht es mit Lacan darum, “dass der Kampf für ein Reales der Ethik zu wichtig ist,…um ihn den Moralisten zu überlassen.” Was heute um so dringlicher erscheint, da die Ethik inzwischen zu einer der Ordnungsbegriffe der ‘neuen Weltordnung’ geworden ist. ———————————————————————————————————————————
So wie das Buch der Trendforscher Friebe und Ramge hieß 1999 auch schon eine Ausstellung von DDR-Basteleien im Haus der russischen Kultur: “Marke Eigenbau”.
“Basteln ist unter den Bedingungen fortgeschrittener Individualisierung quasi zum universellen Prinzip geworden,” heißt es in dem Reader “Konsumguerilla”, in dem wahlweise auch von “bricolage”, D.I.Y. (do-it-yourself) und “Cultural Hacking” die Rede ist bzw. in bezug auf die dabei herauskommenden Dinge von AMOs (Artistically Modified Objects). Ich schrieb 1999 über die Ausstellung mit selbstgebastelten Objekten:
Jedes der etwa 200 Exponate ist ein Gedicht! Einige rührten mich fast zu Tränen. Die Chemnitzer ABM-Beschäftigungsgesellschaft “Phönix” hat die schönsten “Erfindungen” aus ganz Sachsen für diese Leistungsschau der DDR-Bastler zusammengesammelt. Es gab Küchengeräte aus Bohrmaschinen und Bohrmaschinen aus Küchengeräten, zu Betonmischmaschinen umgewandelte Bierfässer und zu Motorradbeiwagen umgeschmiedete Peitschenlampen. Der Konstanzer Kollege Ebner hat darüber auf den taz-Kulturseiten bereits das Wesentliche gesagt. Dazu hat er überflüssigerweise auch noch den Erfindungsüberschwang der Sachsen auf die Mangelwirtschaft im Sozialismus zurückgeführt -und das als Quasi-Schwabe, der es doch eigentlich besser wissen müßte: Die zumeist aus den Bereichen Garten, Datsche, Urlaub und Hobby zusammengetragenen Erfindungen verdanken sich der Arbeitszeitreduzierung, sind also fast alles Geräte zur Freizeitgestaltung bzw. -erleichterung.
Im Westen gingen daraus die Tourismus-Industrie sowie die Ökologiebewegung hervor: Wenn man ins Grüne zieht, muß die Natur möglichst unverbraucht aussehen. Bei einer gesunden 7-Tage-Woche kommt es eher darauf an, daß der Schornstein raucht – und der Nachschub nicht ins Stocken gerät. In den Basteleien ist dagegen die kommunistische Utopie einer Aufhebung der debilisierenden Trennung von Kopf- und Handarbeit “verwirklicht”, und zwar aufs Liebevollste: Jede noch so kleine Schraube hat ihre eigene Geschichte, zu schweigen von den ganzen Muttern.
“Wir haben hier keine Werkzeuge; keine Stoffe bekommen Sie in der Textilabteilung!”, so ging ein Konsum-Witz in der DDR. Tatsächlich gab es in den Ost-Kaufhäusern meist nicht viel, jedenfalls nicht das, was wirklich glücklich gemacht hätte. Woher zum Beispiel eine Hollywoodschaukel nehmen? Oder eine Rübenschnitzelpresse? Oder einen Heimcomputer? Für die Erfüllung derart dekadenter Wünsche gab es im Arbeiter-und-Bauern-Staat oft nur eine Möglichkeit: selber machen. Die Ausstellung “Marke Eigenbau” beweist, mit wieviel Bastlerfleiß und Geschick “helle Sachsen” im Raum Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, von 1945 bis zur Wende 1989/90 der sozialistischen Planwirtschaft ihre Geschicklichkeit entgegensetzten. Vom Antennenverstärker bis zur Zigarrenrollmaschine gibt es fast nichts, was sie nicht zustande gebracht hätten. Die 200 Exponate der Ausstellung sind vier Schwerpunkten zugeordnet: Bauen, Einrichten, Hobby und Kinderspielzeug. Ein “Porsche”-Sportwagen dient als Blickfang – 1969 samt Knautschzone und Überrollbügel auf der Basis eines VW-Käfer-Rahmens mit Textilgewebe und Plastekleber produziert. Wer jemals versucht hat, aus Waschmaschinenteilen einen fahrtüchtigen Traktor mit Allradantrieb zu bauen, wird aber auch dem 7-PS-Gefährt daneben die Anerkennung nicht verweigern. Weitere Favoriten bei der Wahl des Publikumspreises für das originellste Objekt: eine Heimorgel aus Akkordeonteilen, zwei Staubsaugermotoren und Pedalen von Nähmaschinen. Eine Kettensäge mit einem Fahrad-Hilfsmotor, einer Intershop-Kaffeebüchse als Benzintank und einem Rahmen aus Wasserrohren. Der Betonmischer im Bierfaß und die Schubkarre mit Elektroantrieb sind aber auch nicht von schlechten Eltern. Vielleicht bekommt den Preis aber doch das Tonbandgerät, das aus einem Karteikasten und Schulranzenverschlüssen gebastelt wurde – oder die zu Rasenmähern umgebauten Kinderwagen?
Die Phönix-Mitarbeiter haben sich auf ABM-Basis seit der Wende darum bemüht, Stücke des DDR-Alltags für die Nachwelt zu retten; bisher haben sie sieben Ausstellungen gestaltet. Wie schon “Kühlschränke und Karikaturen”, die erfolgreiche Ausstellung von 1997, wird auch die jetzige “Marke Eigenbau”-Schau gemeinsam mit der “Cartoonfabrik Köpenick” organisiert. Die Cartoonfabrik präsentiert deshalb parallel 150 aktuelle Cartoons von 39 Künstlern zum Thema “Erfindergeist, Ideenreichtum und Kreativität in allen Lebenslagen”. Nach Berlin wird man beide Ausstellungen in Krefeld zeigen. Dort werden allerdings die mal stolzen, mal gerührten Kommentare der ostdeutschen Besucher fehlen. Bei der von Balalaika-Musik begleiteten Vernissage im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur löffelten sie Soljanka-Suppe und lästerten über die Scheiben, die immer mal wieder aus der Glasfassade der gegenüberliegenden “Galeries Lafayette” auf die Straße fallen. Vor einem Festkleid aus dem dicken und absolut unverwüstlichen DDR-Stoff “Präsent 20” kam eine Besucherin ins Sinnieren: “Bei uns gab es ja nichts anderes. Mein Sohn zieht sich aber heute ebenfalls diese synthetischen Sachen an – da stinkt er auch wie ein Bulle. Es wiederholt sich eben alles, nur in anderer Form.” Ein Teil der Ausstellungsobjekte findet sich wieder im “Phönix”-Buch: “15 Milliarden Stunden im Jahr. Ein Blick auf Hausarbeit und Haushaltstechnik in der DDR”.
——————————————————————————————————————————
Eventuell interessante Literatur, im Reader “Marke Eigenbau”, Campus-Verlag 2008, erwähnt:
Gregor Dobler: “Bedürfnisse und der Umgang mit Dingen”, Berlin 2004
Andreas Dorschel: “Zur Ästhetik des Brauchbaren”, Heidelberg 2002
Jens Kastner: “Transnationale Guerilla. Aktivismus, Kunst und die kommende Gemeinschaft”, Münster 2007
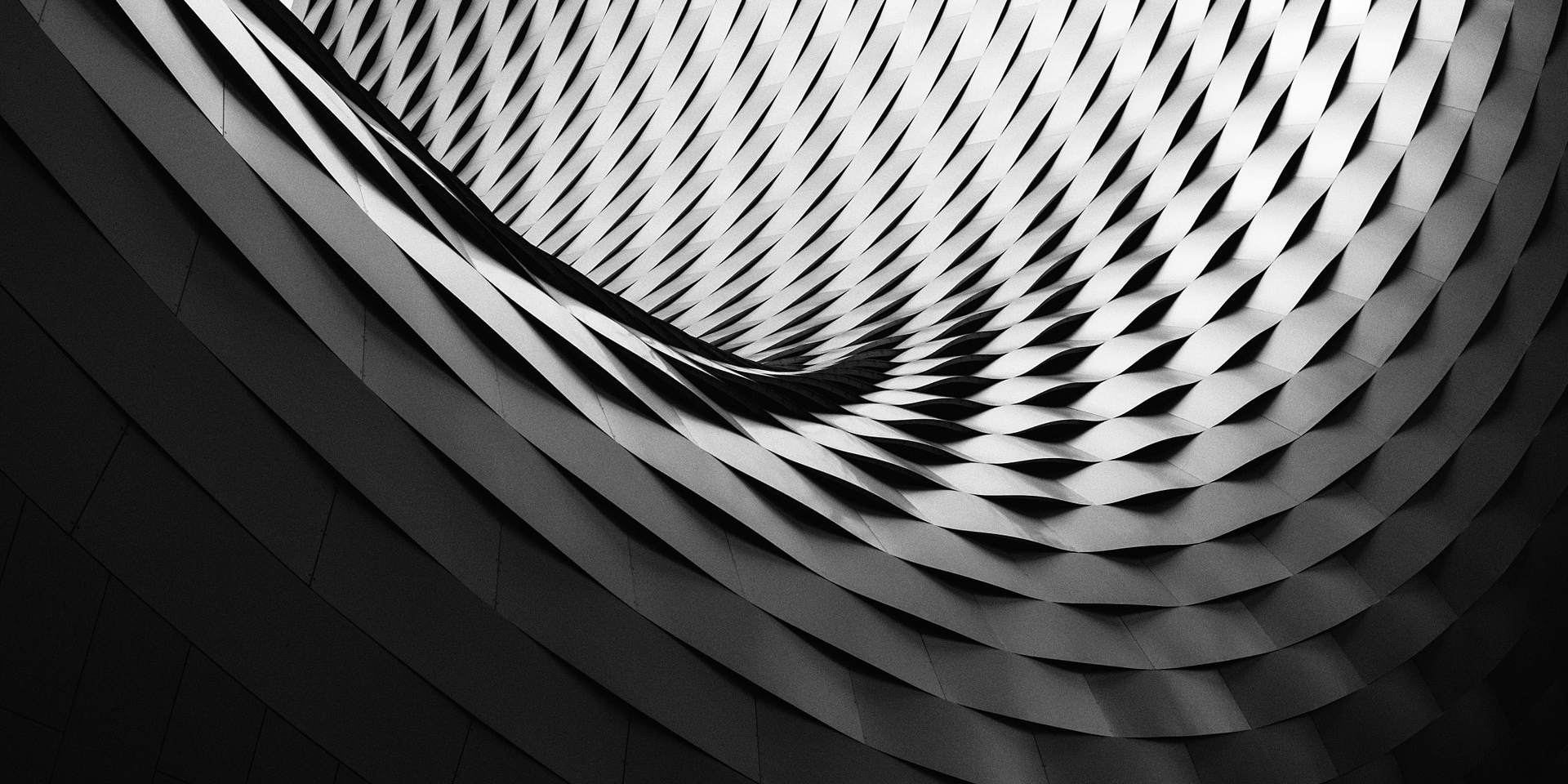



Besonders “romantisch” ist natürlich der Konsum von Ehe, gemeinsamem Hausstand, Urlaub am Meer bzw. in den Bergen und Kinder – mit allem was dazugehört.
Seitdem die deutsche Elite Angst hat, auszusterben, vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwelche Prominenten, vorzüglich aus Hollywood, Schwangerschaft und Kinderaufzucht preisen. Sie brauchen gar nichts groß dazu zu sagen, ihre glücklichen Gesichter sprechen für sich, andererseits auch der Fakt, dass sie für diese von ihnen selbst gelieferten Mutter-Kind-Bilder Millionen Dollar von den Massenmedien bekommen. Die stellen sie nicht einfach ins Netz – bei YouTupe oder auf ihrer eigenen Webpage. Das ist ein großes Geschäft. Immer wenn mal wieder so ein Promi Geld braucht, dann adoptiert er schnell noch ein Kind aus Afrika – und läßt das photographieren, abfilmen, bedichten und bekritteln.
In der bei mir gespeicherten Text-Sammlung von Ekaterina Beliaeva, die unlängst wieder zurück nach Moskau gezogen ist, gibt es noch einen unveröffentlichten Text über
Das Roddom – Geburtshaus – in Kiew
Hätte der Mensch eine Wahl, zu entscheiden, wo er geboren werden will, wie seine Mutter sich fühlt, ob der Vater dabei sein darf und wie der Kreißsaal aussehen soll – würde es sich im Nachhinein vielleicht wie aus einem Webeprospekt einer Privatklinik anhören:
In der Schwangerschaft war meine Mutter glücklich, ich war ein Wunschkind, meinen Eltern ging es gut und auf meine Ankunft wartete eine Schar Verwandte. Als es so weit war, brachte mein Vater meine Mutter ins Geburtshaus, wo freundliches Personal sie in liebevoll eingerichtete Räume begleitete. Es gab Blumen, Musik, bequeme Möbel und leichte Kost. Die Wehen setzten als sanfte Signale ein und als der Instinkt sich meldete, holte meine Mutter tief Luft, schloß die Augen, atmete aus und als sie dann die Augen wieder öffnete, war ich da – in den starken Händen der Hebamme, die mich als weiteres Mitglied der Menschheit willkommen hieß. Meine Eltern hielten Händchen.
Wenn wir in der Schule Aufsätze zur Berufswahl schreiben sollten, wählte die halbe Klasse die “Halbgötter in Weiß”. Es ging darin um Selbstlosigkeit, Liebe, Helfen und Heldentum. Damals wußten wir noch nichts von Billiglöhnen, Extrahonoraren und Schichtarbeit. Die medizinische Versorgung war einfach da – bis dahin, daß die Krankenschwestern die Mütter einige Tage nach der Geburt zu Hause besuchten. Und ob mit oder ohne Einwegwindeln sind wir alle groß geworden.
Die Frage, wie war das eigentlich bei meiner Geburt? stellten wir uns erst, als wir selbst Vater oder Mutter wurden. Auch in den Zeiten schwerer Krisen und absoluter Mangelwirtschaft brachten die Frauen Kinder zur Welt, wo kam der Mut dazu her? Die Verwandten halfen, es gab Kingergärten, die Kinderkleider wurden weiter gegeben.
Umgekehrt gefragt: Ist es schon ein Luxus, egal unter welchen Umständen, Hauptsache geboren zu werden – oder sogar, nicht geboren zu werden? In den Abtreibungsetagen der Geburtshäuser bleiben die Frauen zwei Tage, nur mit Bademantel und Hausschuhen bekleidet, ihre Verwandten müssen sie hinbringen und abholen. Es mangelt an Bettwäsche und Waschmöglichkeiten, die Frauen liegen auf blutigen Laken. Weil die Ärzte braune Gummischürzen tragen, fühlen sich die Frauen wie auf einem Schlachthof. Auch dass die Abtreibungen wie am Fließband durchgeführt werden, erinnert sie daran.
Auf den anderen Etagen, wo die Frauen ihre Kinder im Kreißsaal bekommen, sieht es nicht viel anders aus. Es sei denn, die Familie hat Geld. Dann kann die Frau ein Einzelzimmer bekommen und das Kind die ganze Zeit bei sich haben. Ihr wird gleich nach der Entbindung ein Handy gereicht und das Neugeborene darf der Verwandtschaft seinen zweiten Schrei mitteilen. Danach stehen für Mutter und Kind weitere moderne Überwachungs- oder Diagnostikgeräte bereit.
Am schlechtesten werden die “Kuckucksmütter” behandelt, das sind die am Stadtring arbeitenden Prostituierten, die ihr Kind zur Adoption freigegeben haben. Sie müssen am Längsten warten – auf einen Platz im Kreißsaal und auf eine Hebamme. Eigentlich müssen sie wie alle anderen fünf Tage nach der Entbindung im Geburtshaus bleiben, aber oft verschwinden sie schon nach kurzer Zeit – und keiner hält sie auf.
Auch die Arbeit der Ärzte sieht anders aus, als wir uns das früher vorgestellt haben. Sie haben einen “nicht-genormten Arbeitstag”, d.h. sie müssen oft mehrere Schichten hintereinander ableisten – und das für sehr wenig Geld. Auch sonst fehlt es an allem: Verbandsmaterial, Betäubungsmittel, Gerätschaften etc. Etwas anders sieht es aus, wenn Privatpatienten auf der Station liegen. Erst recht in den neuen Privatkliniken. Daneben gibt es auch immer mehr Hausgeburten. Und Frauen, die es sich leisten können, entscheiden sich für Hausabtreibungen. In den staatlichen Geburtshäusern zahlen sie für eine Schwangerschaftsunterbrechung 50-150 Grivna, ein Abort in einer Privatklinik kostet 280 Grivna, dazu kommen für Beratung und Laborkosten noch einmal 130 Grivna. Das Geld muß man vorab zahlen. Für das Doppelte kommt der Arzt mit einer Schwester auch ins Haus, wo er den Abort auf dem Küchentisch oder im Bad vornimmt. Es werden dabei inzwischen gegen Bezahlung noch einige weitere Dienstleistungen (wie z.B. Massagen) angeboten. Das Problem in der Ukraine ist jedoch, dass immer mehr Frauen, weil arbeitslos, nicht einmal das Geld für die staatlichen Abtreibungskliniken mehr haben und deswegen zu billigen “Volksmitteln” greifen, die dann jedoch oft nur zusätzliche Komplikationen beim Eingriff im Krankenhaus bewirken.