Es ist schon fast Frühling und die Sonne scheint. An sich ist der Samstag in der taz ein Sonntag, aber heute wird überall gearbeitet. Im 6. Stock sitzt eine der Betriebsrätinnen, im 5. wuselt jemand vom Vertrieb herum. Ich sitze im 4. Stock und copy and paste hier die deprimierende Spiegel-Meldung:
“Tripolis/Kairo – Die Weltgemeinschaft debattiert über die richtige Libyen-Strategie, im Osten des Landes liefern sich die Truppen des libyschen Herrschers Gaddafi und die Regimegegner weiter schwere Kämpfe – und es scheint, als gewännen die Regierungssoldaten zusehends die Oberhand.” Es folgen Einzelheiten und dass einer der Gaddafi-Söhne das Land als schon so gut wie zurückerobert begreift, wobei er die Aufständischen, auch Rebellen im Westen genannt, als “Terroristen” beschimpft, gleichzeitig wird ihnen jedoch, wenn sie die Waffen niederlegen und sich ergeben, Amnestie versprochen.
Im 3. Stock hat sich die “Schwerpunkt”-Redaktion niedergelassen – und arbeitet an Sonderseiten über den AKW-Unfall in Japan, gerade diskutierete man dort, ob es nicht falsch sei, von Super-Gau zu sprechen, weil die Abkürzung GAU ja schon für den “Größten” anzunehmenden Unfall stehe.
Im Fernsehen ist in diesem Zusammenhang von einer “Ines-Skala” die Rede, diese gibt es seit über einem Jahr auch intern bei der taz – nach oben offen. Dabei geht es nicht um das internationale Ranking zur Bewertung “nuklearer Ereignisse”, alles muß heute evaluiert und gerankt werden, sondern schlicht um das “Betriebsklima”.Wobei die Radioaktivität nicht ganz ohne Wirkung darauf ist, denn schließlich verdankt die taz ihr Überleben der Reaktor-Katastrophe von”Tschernobyl”. Diese ließ die taz-Auflage geradezu explodieren.
Das derzeitige Betriebsklima scheint zu “stimmen”, wie man heute sagt, denn es geht weiter im 2. Stock, wo eine Handwerker-Brigade den alten Fußboden herausreißt und neuen verlegt. Im 1. stehen einige Leute am Kopierer und wirken aufgeregt. Es handelt sich dabei um Teilnehmer eines Workshops für angehende Journalisten, die, so weit ich weiß, ebenfalls an einer Sonderbeilage arbeiten, als Workshop-Resultat. Wobei anzunehmen ist, dass auch sie was über den AKW-Unfall in Japan veröffentlichen werden.
Auch den Tickermeldungen der Nachrichtenagenturen, auf die die taz abonniert ist, merkt man an, dass das “Thema” Japan-GAU” langsam aber sicher die Informationen über die Aufstände und Protestdemonstrationen in den arabischen Ländern verdrängt.”Wir können uns ja nicht zerreißen!” heißt es wahrscheinlich. Die Bürgerkriege in Südamerika sind darüber ganz hinter dem Horizont des Weltbewußtseins gerückt. Was nicht durch die Medien da einsickert, gibt es nicht.
Der taz-Workshop findet im Konferensaal im 1. Stock statt, im Erdgeschoß wird im taz-Café gerade seine abendliche Party vorbereitet. Eine Koreanerin scheint für das “Catering” verantwortlich zu sein. Von der taz-Genossenschaft, die im 1. Stock ihre Büros hat, ist auch jemand heute erschienen.
Eigentlich müßte das jeden Tag so sein – rund um die Uhr, dann würde sich das taz-Gebäude “rentieren” – in bewegungsmäßiger Hinsicht, wie Jack Lemmon sagen würde.
Hier einige Artikel aus der ausländischen Presse über die taz – vom Orwelljahr 1984 bis zum Jahr des Hasen 2011:
Vorbild bei der Gründung der taz 1978 war die fünf Jahre zuvor u.a. von Jean-Paul Sartre initiierte linke Tageszeitung “Libération”. Diese berichtete dann auch immer mal wieder über die Finanzprobleme, Polizeiüberfälle und Fraktionskämpfe bei dem “alternativen” Schwesterblatt in Westberlin. Manches war ihren französischen Lesern schwer zu erklären: z.B. das das Finanzamt 1984 rückwirkend eine Million DM von der taz verlangte, weil diese kein “verlegtes Werk” sei und deswegen die Steuerbegünstigungen für Westberliner Betriebe zu Unrecht in Anspruch genommen habe. Das war der Hauptgrund für die taz gewesen, sich überhaupt in der “Frontstadt” anzusiedeln. Glücklicherweise entschied das Finanzgericht dann zu ihren Gunsten.
Im Jahr darauf besuchte eine rotchinesische Schriftstellerin – Zhang Kangkang – die Redaktion, die damals noch in einer Weddinger Fabriketage eingemietet war. Eigentlich hatte der Sinologe Wolfgang Kubin Zhang dort hingezerrt, wie sie später in der Literaturzeitschrift “Renmin Wenxue” schrieb, denn sie wollte nicht schon wieder interviewt werden. Aber nein, hatte Kubin ihr geantwortet, nicht sie dich, du sollst sie interviewen. “Sie hoffen, dass du die Fragen stellst.” “Wo gibt es denn so etwas, eine Zeitung, die sich von anderen interviewen läßt?” fragte Zhang Kangkang. “Du wirst sehen, sie sind ganz anders als alle anderen Zeitungen,” versprach Kubin ihr. Zunächst bemerkte die Dichterin, dass es überall “nicht besonders sauber” war. Damals kam noch regelmäßig der spätere Grünen-Abgeordnete Christian Ströbele mit belegten Brötchen vorbei und leerte die Papierkörbe und Aschenbecher. Als sich einige taz-Redakteure um die chinesische Genossin scharen, bemerkt diese, “dass sie sehr glücklich sind, dass wir gekommen sind.” Es gibt keine Unternehmen oder Banken, die sie kontrollieren, “jede Meinung kann veröffentlicht werden,” behaupten die Redakteure ihr gegenüber. Sie beklagen sich jedoch darüber, dass sie nur 1000 DM am Tag verdienen, in anderen Zeitungen seien es 2-3000 DM. Da muß die Chinesin etwas mißverstanden haben. Das höchste taz-Gehalt beträgt heute 2500 Euro netto – aber im Monat. Außerdem versicherte man ihr: “Wir berichten nicht nur, sondern untersuchen auch die Fehler z.B. im heutigen China und machen Vorschläge.” Nicht zuletzt deswegen habe die taz neulich auch Zhangs Erzählung “Das Recht auf Liebe” veröffentlicht. Deutschland betreffend, gestehen ihr die tazler, dass ihnen die “Wiedervereinigung” am Arsch vorbeigehe, im übrigen gäbe es in ihrem Blatt zwar nicht wie einst in China “den Kampf zweier Linien, dafür jedoch den Kampf von 99 Linien.” Nicht zuletzt deswegen, weil man jetzt den Wert der Arbeitskraft und die Entlohnung neu diskutiere. Der taz-“Einheitslohn” wurde dann jedoch erst 1992 abgeschafft – und die Putzbrigade outgesourct. Als die Schriftstellerin müde wird vom Zuhören, lädt man sie zu Spaghetti Bolognese in die Kantine ein, wo man ihr die Herkunft der großen Tisches erklärt: Er stammt aus der legendären Kommune 1.
Zhang Kangkang ist voll des Lobes über das taz-Menü. Abschließend zeigt man ihr die anderen Redaktionsräume. Sie bemerkt, dass überall Blumentöpfe stehen. Als sie mit ihren Begleitern die taz verläßt, ist sie “verwirrt”, wie sie schreibt, ihre “Gefühle sind verwickelt und kompliziert. Wer hätte auch darauf kommen können, dass Westberlin so eine Zeitung hat!”
Die linken Journalisten aus dem kapitalistischen Ausland mußte man nicht in die Redaktion zerren, sie kamen von selbst, um das “Alternativprojekt tageszeitung” näher kennen zu lernen und zu unterstützen. 1986 veröffentlichte Jeff Cohen in der Chicagoer Wochenzeitung “In these Times” einen Artikel über die taz, die seiner Meinung nach den “Stil der Untergrundpresse der Sechzigerjahren wiederbelebte”, die ferner über eine Million für die Guerilla in El Salvador zusammensammelte, die man bis dahin schon 40 Mal angeklagt hatte, die zwei Polizeirazzien und sechs Überfälle von Hausbesetzern, Antiimperialisten und Feministinnen überstanden hat, deren Setzer eigene Zwischenbemerkungen machen dürfen und deren Reporter – Rudi Dutschke – wegen einer Zwischenfrage auf einer Pressekonferenz des rotchinesischen Premierministers Hua Guofeng des Saales verwiesen wurde.
Hua hatte nach dem Tod Mao tse tungs dessen Witwe und drei ihrer Getreuen verhaften lassen – diese “Viererbande” galt fortan als Anführer der von Mao initiierten Kulturrevolution und als Verbrecher, was die Kritik von Dutschke herausgefordert hatte. Auch der für Gewerkschaften zuständige taz-Redakteur Martin Kempe wurde damals nicht zu den Pressekonferenzen der Gewerkschaften zugelassen, später holten sie ihn als Chefredakteur der Ver.di-Zeitung “publik”. Umgekehrt wurde der wiederholt von den Kadern der Kulturrevolution nach Peking eingeladene KPD/AO-Vorsitzende Christian Semler 1989 taz-Redakteur, das ist er noch heute – ebenso Maoist. Der anarchische Auftritt der taz mag “wenig objektiv” sein, wie Jeff Cohen meint, aber er sei ein starker Kontrast zu dem allzu “glatten Journalismus der US-Tageszeitungen”. Und viele bundesdeutsche Journalisten hätten ihre Karriere in der taz begonnen, die inzwischen zu einer wichtigen Quelle für die Konkurrenzblätter geworden sei. Manchmal habe ich schon den Eindruck, erzählte ein tazler dem Autor, “dass ein Scheitern unseres Blattes für die anderen Journalisten schlimmer ist als für unsere Leser.” Wichtig sei sie aber auch für “Whistleblower”, besonders in bezug auf Umweltvergehen. So konnte die taz 1985 z.B. ein geheim gehaltenes Gutachten über arsenvereuchte Böden in Hamburg veröffentlichen. Es gäbe enge Verbindungen zur Partei Die Grünen, die fast zeitgleich mit der taz gegründet wurde: Beiden gehe es “um das Zusammenführen separater Bewegungen”.
Die taz beschäftigte 1986 zwei Köche, einer wurde später Chefredakteur, die andere wurde von Cohen gefragt, warum sie, die im Gegensatz zu den meisten taz-Journalisten gut ausgebildet sei, für so wenig Geld arbeite. Die noch immer in der taz als Köchin arbeitende Bolivianerin Nancy antwortete ihm: “Ich wollte schon immer in einem Kollektiv arbeiten”. Nicht genug wundern konnte sich Cohen auch darüber, wie man in der taz auf die bürgerlichen Politiker herabsieht. Ein tazler gestand ihm jedoch: “Wir wollen aus diesem linken Ghetto rauskommen”. Abschließend zitierte der Autor Willy Brandt: “Wenn ich die taz lese, wunder ich mich immer, wie sie es schafft, in Deutschland zu überleben. Allein das ist schon ein gutes Zeichen.”
1994 druckte die Zeitung “El Pais” einen mehrseitigen taz-Artikel von Willy Brandt nach, der für einige Aufregung in Spanien sorgte: Der spätere Bundeskanzler hatte 1937 als IM für den in Oslo exilierten Führungsoffizier Wilhelm Reich die Sexualgewohnheiten der revolutionären Jugend im spanischen Bürgerkrieg ausgeforscht. Brandts “Report” war mit dem Nachlaß des Psychoanalytikers Reich in den Besitz einer rechten Kampforganisation in Kalifornien gelangt, wo ihn der jugoslawische 68er-Regisseur Dusan Makevejev für seinen Film über Wilhelm Reich “Mysterien des Orgasmus” fand – und kurzerhand kopierte. Anläßlich einer Berlin-Recherche für einen Hollywoodfilm über den “Abzug der Roten Armee aus Berlin” schenkte er die Unterlagen der taz, für die das jedoch bloß ein kurioses Dokument war – anders bei “El Pais” in Madrid, wo gerade ein sogenannter “Ziehsohn Willy Brandts”, Felipe Gonzalez, Ministerpräsident geworden war.
Mehrmals mußte die taz sich “Rettungsaktionen” einfallen lassen, weil ihr mangels genügend Abonnenten das Geld ausgegangen war. Heute hat sie rund 45.000, ist aber als Genossenschaft (seit 1992) nicht mehr alleine auf sie angewiesen. Vor allem bei großen Umweltkatastrophen schnellte die taz-Auflage und Abozahl jedesmal in die Höhe. Am Heftigsten beim Reaktorunfall von Tschernobyl 1986. In dieser Zeit besuchte Martin Griffin vom Londoner “Monochrome” die Redaktion. “Wir sind absolute Profiteure des Fall-Out,” bekam er zu hören, aber auch, dass die taz inzwischen schon über 100 mal vor Gericht gezerrt wurde – meistens wegen Beleidigung und Aufforderung zur Gewalt. Außerdem wurden die taz-Seiten einmal auf dem Weg zur Druckerei geklaut – und durch feministische Texte ersetzt, “die jedoch nicht schlecht waren”. Auch andere linke Gruppen fühlen sich in Westberlin zunehmend von der taz ignoriert oder ins falsche Licht gerückt. “Aber wir wollen politisch einflußreich werden, so dass das, was die taz sagt, mehr Gewicht hat,” bekommt Griffin mit auf den Weg.
1987 veröffentlichte Jeff Cohen noch einmal einen langen Artikel über die taz – diesmal in dem alternativen US-Wochenmagazin “Utne-Reader”, in dem u.a Noam Chomsky und Barbara Ehrenreich schrieben. Die bloße – wenn auch ständig kriselnde – Fortexistenz der taz bewies Cohen bereits, “dass in Europa im Gegensatz zu Amerika das Feuer der 60er-Revolte noch immer brennt. Der Idealismus ist dort noch nicht tot”. Und die taz sei eine “worker-owned cooperative”. Das wurde sie jedoch erst nach der der Wende, während ihr Vorbild “Libération” sich anders entschied – und sich an das Kapital verkaufte. Seitdem gibt es keine Kooperation zwischen den beiden Zeitungen mehr. Dafür kam Ende 1989 eine mit dem französischen Wochenmagazin “actuel” zustande: Als Antwort auf das “Tian’anmen-Massaker” des Militärs auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking wurden von den beiden Zeitungen sämtliche Faxgeräte in China mit Protestnoten von Chinesen eingedeckt – so lange, bis an jedem Gerät ein Soldat wachte und die Faxe festnahm.
Wenig später besuchte Erich Friedländer die taz, um für “The Democratic Journalist”, dem Organ der internationalen Journalistenorganisation, über sie zu berichten. Er sprach u.a. mit der inzwischen reaktionär gewordenen Chefredakteurin Georgia Tornow, die ihn erst mit Zahlen bombardierte und dann kurz die bisherige Geschichte der taz erzählte. Obwohl sich einiges geändert habe, gehe es noch immer darum, eine “alternative Öffentlichkeit zu schaffen”, sagte sie. Ein anderer taz-Mitarbeiter meinte zu Friedländer: “Wir waren ‘Trendsetter’, was Umweltschutz und Ökologie betraf, aber inzwischen haben fast alle Zeitungen nachgezogen.” Generell könne man sagen, “dass eine so kleine Zeitung wie wir so ein Problem nur thematisieren kann, wenn es von einer Bürgerinitiative oder Ähnlichem aufgegriffen und mit einer systematischen Kampagne begleitet wird”. Abschließend kam Friedländer noch einmal auf die Biographie der Chefredakteurin und das damals noch neue Organisationsmodell der taz zu sprechen.
Nach 1990 erschienen etliche Artikel über die taz in den DDR-Medien – aber Ostdeutschland ist seit dieser Zeit nicht mehr Ausland, deswegen sei hier als nächstes ein 2008 erschienender Artikel aus der türkischen Zeitung “Radikal” erwähnt. Die Autorin Pinar Ögünc hat sich darin auf den ebenso langen wie komischen Konflikt zwischen der taz und der Springerpresse konzentriert. Erstere war einst u.a. gegen die Fast-Monopolstellung dieses rechten Zeitungsverlages gegründet worden. Seitdem gab es immer wieder kleinere Scharmützel zwischen den beiden “Häusern”, die inzwischen auch in der selben Straße domiziliert sind. Sie heißt seit 2008 “Rudi-Dutschke-Straße”. Der “Studentenführer” wurde 1968 von einem durch die Berichterstattung der Springerzeitung “Bild” über die Studentenbewegung verhetzten Hilfsarbeiter angeschossen – und so schwer verletzt, dass er sich davon nicht mehr erholte. Das Attentat war Anlaß für eine “Enteignet-Springer-Kampagne”. Die türkische Journalistin erzählt in ihrem Artikel diese Geschichte bis zu der damit zusammenhängenden taz-Gründung nach und kommt dann auf den immer noch amtierenden Chefredakteur der Bild-Zeitung, Kai Diekmann zu sprechen, der die taz verklagte, weil sie auf ihrer Satireseite “Wahrheit” über seine verpfuschte “Penis-Verlängerung” berichtet hatte. Außerdem parkte er einen Lieferwagen vor dem taz-Haus, auf denen die Bild-Zeitung sich mit Plakaten über die körperliche Beschaffenheit der taz-Redakteure lustig machte, und wurde sogar Mitglied in der taz-Genossenschaft, wo er auf der Generalversammlung zuletzt für die Einführung von Gebühren für taz-online plädierte. Auf der anderen Seite ließen ihn die taz-Redakteure eine taz-Ausgabe redigieren – die sogenannte “Feindestaz”, die laut Diekmann alle Verkaufsrekorde schlug. Sein einmaliger Einsatz schlug mithin ähnlich durch wie der Reaktorunfall von Tschernobyl. Nun will man aber doch endlich das Verhältnis zwischen den beiden Boulevard-Presse-Häusern klären – mit einer taz-Arbeitsgruppe.
2010 arbeitete der türkische Journalist Mahmut Hamsici zwei Monate mit einem EU-Stipendium in der taz, u.a. verfasste er dabei auch einen langen Artikel über sie für seine Zeitung “Birgün”. Der Artikel begann mit dem Satz: “Die Rudi-Dutschke-Straße 23 ist ein Haus, an dem ein großer Penis befestigt ist”. Dabei handelt es sich um ein großes Reliefteil, das der Konstanzer Bildhauer Peter Lenk auf eigene Kosten an der Südwand des Verlagsgebäudes anbrachte – für zwei Jahre. Es zeigt den stark vergrößerten Penis des Bild-Chefredakteurs Kai Diekmann und andere Schweinereien aus dem Springerverlag.
Mahmut Hamsici gewann bei seinen Recherchen den Eindruck, dass die taz noch immer kein “Mainstream-Medium” geworden ist. Ihre Arbeitsweise ist anders und sie ist noch immer ziemlich antiautoritär: “Im Gegensatz zu unseren Chefredakteuren, die mit einem Rangerover zur Redaktion fahren, kommt die taz-Chefredakteurin Ines Pohl mit dem Fahrrad.” Und sie sagt: “Meine Befugnisse sind hier sehr begrenzt. Ich begreife mich als Dirigent eines großen Orchesters, wo ich versuche, die Leute dazu zu bringen, aus ihrer eigenen Einstellung heraus, die besten Töne herauszubringen.” Im übrigen habe die taz inzwischen einen größeren Einfluß, als die Auflagenhöhe vermuten läßt. Und sie berichtet auch noch immer über Dinge, über die sonst keine andere Zeitung schreibt. Hinzu kommen ihre “gestalterischen Spielereien” und ihr “ironischer Stil”. Außerdem hat sie das größte Wohlwollen gegenüber Migranten und Einwanderer. Ines Pohl erzählte dem Autor: “Am Anfang war die taz keine wirkliche Zeitung, gemessen an journalistischen Standards. In dieser Hinsicht ist sie Teil des Mainstreams geworden. Zwar hat sie mittlerweile eine größere Distanz zu den Grünen, aber viele ihrer Leser wollen noch immer, dass sie ein Kampforgan ist.”
2011 schickte ein englischer Leser der taz einen Artikel aus dem Guardian, in dem es um Wirkung des Textes eines taz-Autors ging. Die taz orientiert sich schon seit einigen Jahren am britischen Guardian, dem sie u.a. das Konzept für “tazzwei” entlieh. Der englischer taz-Leser schrieb: “Am Samstag war im Guardian ein Artikel über die Überlebenden des Attentats vom 7.7.2005. Darin wird von einem in London lebenden Deutschen berichtet, der in einem der explodierenden Züge saß. Es wird berichtet, dass dieser Mann ein Trauma entwickelt hat: Jedesmal, wenn er nach dem 7.7. lachen musste, wurde er danach unglaublich traurig. Ein Psychologe fand dann bei einer Therapie heraus, dass es wahrscheinlich daran lag, dass dieser Mann zum Zeitpunkt der Explosion gelacht hat, während er das neue Buch von Wladimir Kaminer las.”
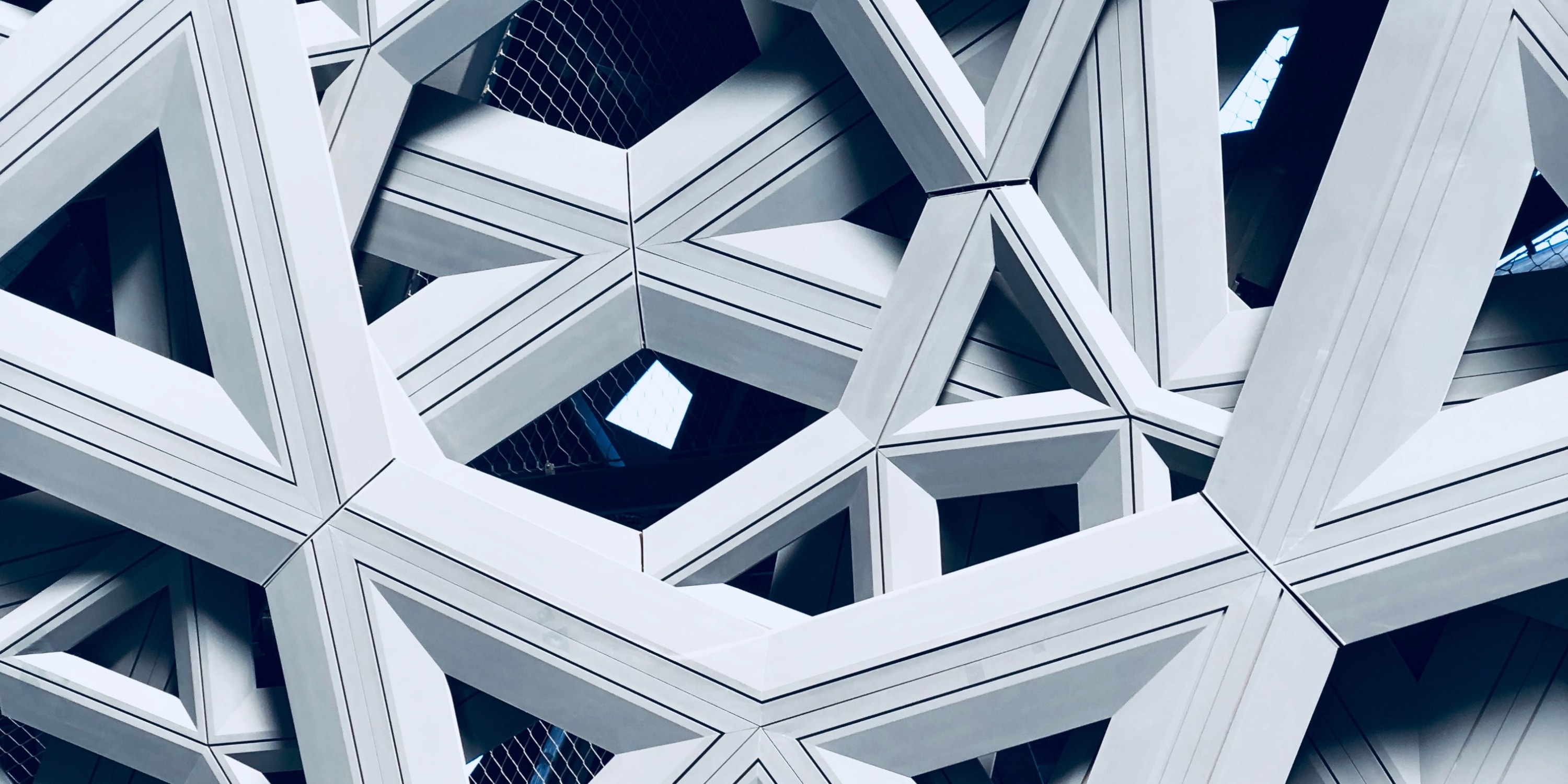



ein rentier als taz maskottchen!den dann könntet ihr 1 neues logo nutzen:rentier klaue.und im winter schlitten fahrten ab bordsteinkante haustier-nein:tür. von vorne weck,mit gastarbeiter/innen aus allen lapplanden…..