Mehr als der Facebook-Daumen
Blogs können für die Musikkritik das werden, was Punk für den Pop war: die Aufhebung der Schranken zwischen LeserInnen und SchreiberInnen.

Das seit gut zweieinhalb Jahren von mir betriebene Popblog “Monarchie und Alltag” auf taz.de lässt mich zwischen allen Stühlen Platz nehmen: zu meiner Rechten die etablierten Feuilletons und Musikmagazine, auf der anderen Seite privat betriebene Blogs. Zwar wird das taz-Popblog gänzlich autark, also ohne Rückkoppelung mit der Redaktion betrieben, andererseits ist die Außenwirkung wohl doch in erster Linie “taz” und nicht “blog”.
Daraus ergibt sich aber die schöne Möglichkeit, jenseits der Frontlinien Blog versus Presse-Establishment Position zu beziehen und die Grenzen auf der Konfliktlinie Online gegen Print deutlicher zu ziehen. Denn häufiger Fehler aller kulturpessimistischen Analysen über die Blogkultur ist die irreführende Annahme, es gäbe nur den einen Typus des Bloggers oder Blogs.
Was schon für Printredaktionen absurd wäre (oder wer setzt etwa gleiche Erwartungen in ein Süddeutsche-Feuilleton und den “Kultur”-Teil der Bild-Zeitung?), ist aufgrund der nicht vorhandenen Einstiegsschranken in das Bloggertum gänzlich abwegig. So viele Blogs wie Menschen!
Gerade hier bietet sich auch die Chance, den von Sonja Eismann in einer früheren Folge der Debatte zur Zukunft der Musikkritik postulierten Vorwurf zu entkräften, dass Popkritik hauptsächlich aus einer männlichen, weißen, heterosexuellen Perspektive geschrieben würde. Blogs können für die Musikkritik das werden, was Punk für den Pop war: die Aufhebung der Schranken zwischen LeserInnen und SchreiberInnen sowie der Bruch mit allen diktierten Geschmackskriterien.
Das tägliche Klick-und-Häppchentexttraining
Ein viel klareres Unterscheidungskriterium als das zwischen Bloggern und Redakteuren bieten die benutzten Medien an. Allein aufgrund des täglichen Klick-und-Häppchentexttrainings im Netz scheint es im Onlinebereich erheblich schwieriger zu sein, für lange Texte über Bands Leser zu finden. Während bei den Printmedien gute von Schrottpublikationen schon dadurch unterscheidbar sind, ob sie sich in ausreichender Tiefe mit einem Thema beschäftigen, diktiert das Netz Maximallängen. Außerdem ist im Internet durch die direkte Einbindung von Streams oder Downloads die sofortige Überprüfung der gerade gelesenen Kritik – zumindest scheinbar – möglich. Wobei nicht übersehen werden darf: Gerade das kursorische Anhören verhindert, dass komplexere Sounds überhaupt wahrgenommen werden. Ein Klick, ein Don’t-like – im Gegensatz zur ausgiebigen Beschäftigung mit Musik früherer Tage.

We will never again agree on anything as we agreed on Elvis
Der Musikkritik fällt es auf diese Weise im Onlinebereich immer schwerer, Allgemeingültigkeit zu erreichen, die über bloßes Abefeiern des nächsten großen Dings hinausgeht. “We will never again agree on anything as we agreed on Elvis”, schrieb Lester Bangs bereits 1977 und meinte damals noch, dass die Zeiten der alle Schranken übertretenden Künstler vorbei seien – heute liefern sich gerade Musikblogs einen grotesken Wettbewerb, die jeweils neueste Hypeband zu finden und abzufeiern, bis die Künstler schon bei der Veröffentlichung ihres Debütalbums nur noch eine Nachricht von gestern sind.
So steigt aber die Gefahr, dass Musikblogs zu Durchlauferhitzern verkommen. Auch wir im taz-Popblog machen das Spiel einmal im Jahr in nahezu epischer Breite mit: Der Januar gehört vollends Bands, von denen wir glauben, dass sie im folgenden Jahr gut (oder groß) werden.
Zeit ist die Währung
Doch im Gegensatz zu Musikmagazinen und Feuilletons hat die generell subjektive Ausrichtung des Blogs auch den Vorteil, ohne weiteres einer echten Begeisterung zu fröhnen, nur den einen Moment zu feiern und Musik generell emotionaler zu beurteilen. Gerade das kann ein Zugewinn der heterogenen Bloglandschaft sein, da sich Feuilletons traditionell, aber auch rätselhaft schwertun, jungen Bands eine Chance zu geben. Die Angst vor der falschen Prognose, das Misstrauen gegenüber Hypes schien im Printbereich schon immer stärker verbreitet zu sein als die Hoffnung auf Neues, Großes!
Noch sind wir Musikblogger in Deutschland auch viel zu sehr damit beschäftigt, britische und US-amerikanischen Bands zu beobachten, die die Kollegen im Mutterland des Pop sowieso schon weit vor uns abgehandelt haben.
Auf der anderen Seite bieten wir heimischen Bands zu wenig Raum – was explizit nicht aus einer patriotischen Deutschlandquotenbegründung heraus missverstanden werden soll und eben gerade auch nicht aus der Gewichtung “weiß, männlich, heterosexuell”. Es zeigt eine Nische, die weder von Blogs aus anderen Ländern noch vom hiesigen Musikkritik-Establishment besetzt wird.
Musikkritik reduziert sich hierbei auf eine Dienstleistungsfunktion, die auch Plattenrezensionen früher hatten: Die Kritik bot den LeserInnen Filter an, die herausarbeiteten, in welche Musik diese ihr Geld investieren konnten. In einer Ära der Ubiquität von Musik, die sich mit dem kostenlosen Streamingdienst Spotify noch weiter verstärken wird, ist es aber nicht mehr die Investition in einzelne Alben, die sich via Musikkritik begründet, sondern das Anhören von unbekannten Bands. Die Funktion bleibt die Gleiche, nur der Einsatz ändert sich. Zeit ist die Währung, nicht mehr das Geld.
Mehr als der Facebook-Daumen?
Darüber hinaus darf sich die Musikkritik aber nicht auf dieser Dienstleistungsfunktion ausruhen. Gerade im Netz muss sie Antworten finden, wie sie entsprechend den Lesegewohnheiten gerechte, komprimierte Texte präsentiert, die dennoch Diskussionen anstoßen können und über ein Geschmacksurteil und den Facebook-Daumen hinausgehen.
Dabei auch noch zu vermeiden, in der kleinteiligen Bloglandschaft nur vor einem Spezialistenhäufchen längst Bekehrter in einmütiger Übereinstimmung zu predigen, dürfte die sogar noch größere Aufgabe der Musikblogger werden. (Christian Ihle)

Der Text ist ursprünglich in der Reihe “Die Zukunft der Musikkritik” in der Print-TAZ vom 22.07. erschienen.
Beiträge bisher: Wolfgang Frömberg (30. 3.), Jörg Sundermeier (9. 4.), Hannah Pilarczyk (16. 4.), Nadja Geer (23. 4.), Max Dax (11. 5.), Sonja Eismann (26. 5.) und Geeta Dayal (16. 6.).
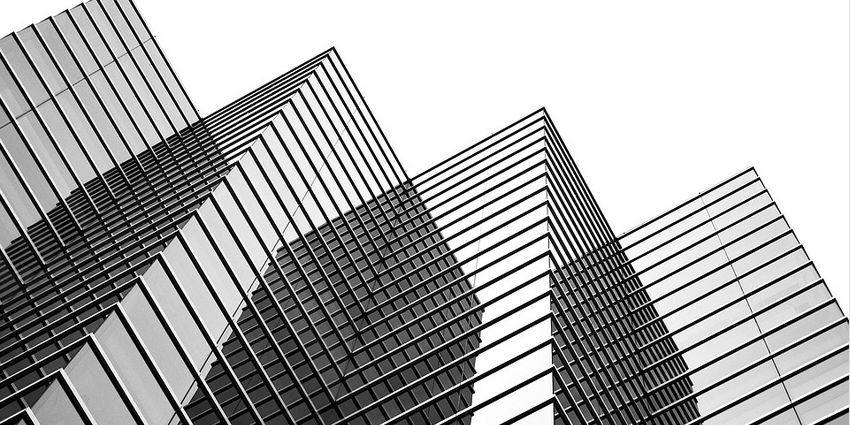



Wo ist der Facebook Like Button ?
Klasse Beitrag , Danke !