Der Tag beginnt. Der gesichtslose Soldat hat mir eine unruhige Nacht beschert. Kaffee, Zigarette. Nataliya und Milena schlafen noch. Bislang scheinen sie ihre Ankunft noch nicht wirklich realisiert zu haben, wir haben kaum ein paar Worte miteinander gewechselt seit ihrer Ankunft. Natalyia gibt sich unnahbar, Milena bleibt verstummt. Man kann es ihnen nicht verübeln. Ihre Körper sind schon hier, doch die Seele reist nach. Nachts höre ich sie schluchzen. Ich sitze an dem alten Tisch aus Eichenholz, vor mir Jushis Laptop, ein älteres Modell. Zum wiederholten Mal klappe ich ihn auf, wieder zu. Ich verbinde ihn mit dem Netzteil. Nataliya scheint sich dafür zu schämen, dass sie das Passwort nicht kennt. So wenig kannte sie ihren Mann, diesen großartigen Genossen. Das Passwort ist der Schlüssel zu seinem Laptop, der Laptop der Schlüssel zu seinem Werk. Ohnehin hat sich Natalyia für Iljushans Arbeit nie wirklich tiefergehend interessiert. Vielleicht unterstelle ich ihr das nur, doch dieses war mein Eindruck. Mit meiner ehemaligen Lebensgefährtin erging es mir nicht anders, ich meine, das zu kennen. Zwar schätzt die Welt den Künstler als Märtyrer des Erhabenen, schmückt sich gerne mit ihm als Wohn-Accessoire, doch belächelt ihn dabei gleichzeitig mitleidig und paternalistisch. Ein Blick in den Abgrund genügt, man gruselt sich gerne, doch dann geht man weiter und kauft sich eine Jeans. Der Kult des Talents ist eine der seltsamsten Launen, die je die Weltenseele beflügelt haben. Die Welt ist eine Steuererklärung, der Künstler ein Sonett von Charles Baudelaire. Ich zermartere mir das Hirn, wie das Passwort wohl lauten könnte, denn ich fühle mich verantwortlich für Jushis Werk. Das Schwarze auf dem Weißen macht den Künstler unsterblich. Die Namen seiner Frau und seiner Tochter versuche ich als erstes. „Anastalia“…nichts. „Kiew“, „Maidan“, „Donez“, „Krim“…nichts. Lächerlich fühle ich mich und, bei Gott, ich bin es. Meine Tochter ist inzwischen wach, wir frühstücken. Die Nachbarskinder klingeln und holen sie ab zum Spielen vor dem Haus in der Mitte der Straße, eine kleine Sackgasse, an deren Ende eine Wendeplatte. Einer der Nachbarn poliert seinen Wagen, es ist ein etwas älterer BMW. Missmutig stehe ich daneben und unterhalte mich schleppend mit den Papas aus der Nachbarschaft. Das Thema: Krieg. Man hat Angst. Perfekt für das Kapital. Die Angst ist die Hand voll Schmiere im rostigen Getriebe des kapitalistischen Systems. Die Angst kurbelt den Konsum an. Man ist sich einig, dass man sich besser mit Vorräten für mindestens zehn Tage ausstatten müsse, falls „der Russ“, wie man ihn hier nennt, ernst mache. Ekelhaft. Im dörfischen Discounter sind Sonnenblumenöl und Weizenmehl ausverkauft. Lächerlich. Man fragt sich, ob man sich bewaffnen solle, um im Ernstfall seine Familie beschützen zu können. Wie Mannhaft. Nicht unbedingt ein Überangebot an kognitiven Kapazitäten, aus dem man hier schöpft. Kleinbübisch patriarchales Chauvinismusgehabe. Mit halbem Ohr höre ich zu, als Dorfbekannter Linker nimmt mich hier ohnehin keiner ernst. Besser so. Für den Fall einer rot-roten Bundesregierung haben sie sich Zyankalikapseln ins Futter genäht. Der Dampfer nach Argentinien steht bereit. Meine Gedanken kreisen um Jushi. Wie lautet das Passwort? Die Nachbarn fragen sich, welche Lebensmittel wohl am längsten platzsparend gelagert werden könnten. Da fällt mir der gemeinsame Segeltrip ein, den ich mit Jushi in besseren Tagen vor der kroatischen Küste unternommen habe, um das SKS-Patent zu erwerben. Richtig bunkern. Segler können das. Ich sehe Jushi vor mir, wie er die Vorräte verstaut, bevor der Trip losgeht. Er bestand darauf, eine Flasche Singlemalt mit an Bord zu nehmen. So viel Platz muss sein! Der Skipper sah das anders. Alkoholverbot! Jushi hat die Flasche an Bord geschmuggelt und wir tauften sie die Manöverflasche. Da fällt es mir plötzlich ein! Nach einigen heimlichen Schlücken sinnierten wir während einer Freiwache an Deck darüber, wie wir wohl unsere eigenen Yachten eines Tages nennen würden. Natürlich müssten es die Namen von Protagonisten der großen französischen Romanciers des neunzehnten Jahrhunderts sein, da waren wir uns einig. Mein Schiff wäre die „Jean Valjean“ und Jushis Yacht trüge den Namen „Edmond Dantès“, „Gavroche“ hieße das Beiboot. Das ist es. Das muss es sein. Ich stürme ins Innere, ohne mich um meine Tochter zu kümmern. Mit zittrigen Händen gebe ich die beiden Passwortversuche ein. Nichts. Ich war mir so sicher. „Rastignac“, „Julien Sorel“, „Père Goriot“. NICHTS. Im Deutschlandfunk bringen sie die aktuellen 7-Tage-Inzidenzen der Corona-Pandemie. 279.642 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, Inzidenzwert 1657. Ein Geistesblitz… Camus! Das ist es. Jushi liebt Albert Camus. Zu Beginn der Pandemie haben wir uns über die erschreckenden Parallelen zu „La Peste“ unterhalten. Er hat mir erzählt, dass er das Buch während des ersten Lockdowns seiner Frau vorgelesen hat. Sie schlief dabei meist ein. Meine Lieblingsfigur ist Cottard, der Kollaborateur der Seuche. Jushi verehrte Bernard Rieux, den absurden Helden, den Sysiphos mit den schwarzen Füßen. „Bernard Rieux“. Ich tippe die Buchstaben ein und der Laptop entsperrt sich. Jushis Werk wird überleben. Il faut imaginer Sisyphe heureux…
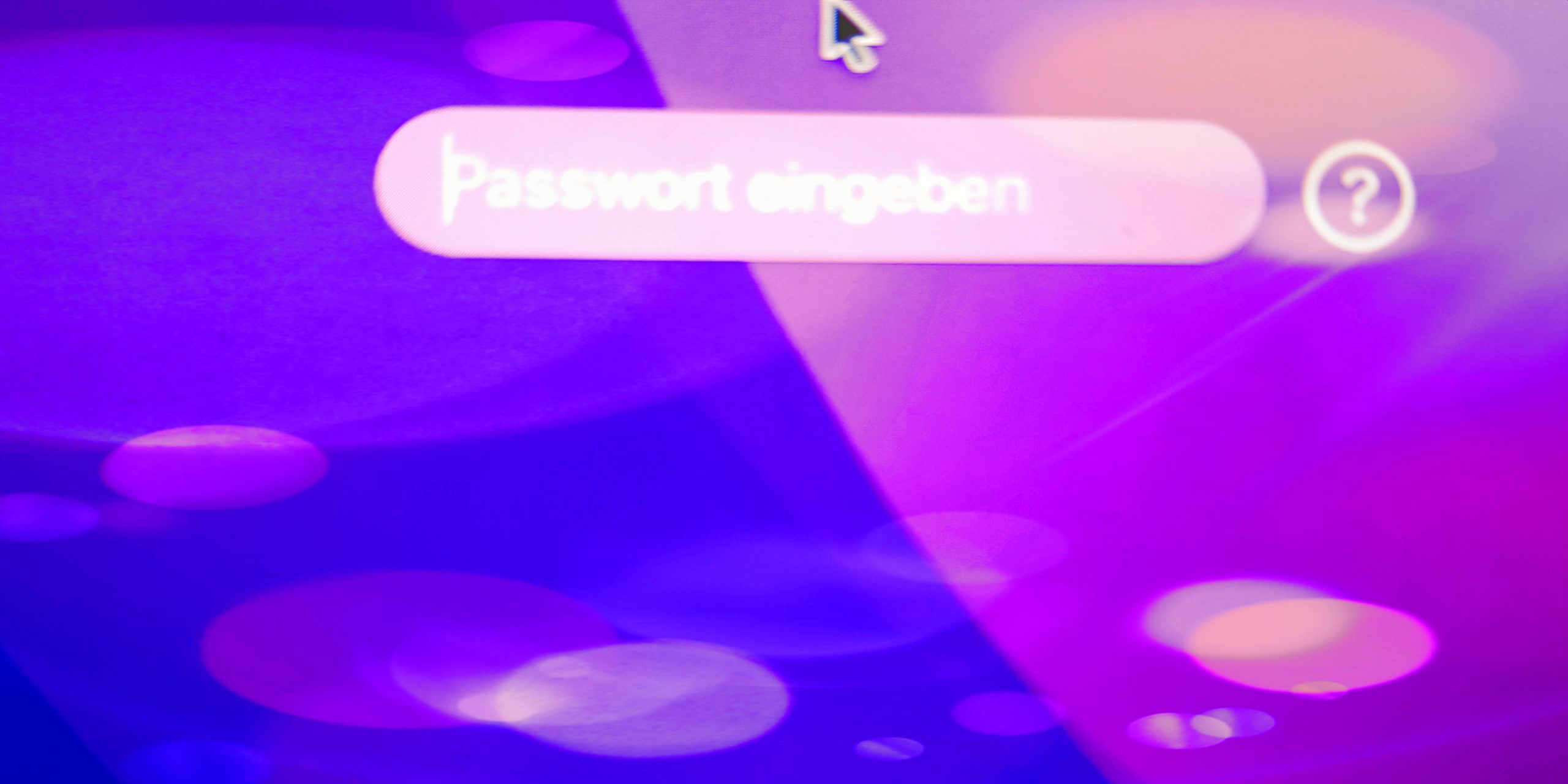
Anzeige


