Unsere scheidende Chefredakteurin Bascha Mika spricht über die Probleme einer Chefin in einem antiautoritären Betrieb wie der taz, ihre Enttäuschung über die Frauen hier im Haus und über ihre Härte zu sich selbst. Das Interview führten die taz-Redakteure Stefan Kuzmany und Stefan Reinecke.
Guten Tag, Bascha.
Wollt ihr mich quälen?
Später. Erst mal eine unverfängliche Frage. Du bist elf Jahre lang Chefredakteurin der taz gewesen – viel länger als alle deine Vorgänger. Warum?
Weil ich gut bin. Und weil ich Respekt vor den tazlern habe, die hier für einen Hungerlohn arbeiten. Den Redakteuren gehört ja die Zeitung. So wollen sie behandelt werden und nicht als Untergebene.
Als Chefredakteurin der taz waren deine Möglichkeiten im Vergleich zu bürgerlichen Zeitungen beschränkt. Du kannst in der taz quasi niemanden entlassen.
Stimmt, sehr schwierig.
Du kannst auch kaum Journalisten von außen holen und denen dann einen Haufen Geld geben.
Das geht gar nicht.
Also hast du geführt, indem du der Redaktion das Gefühl gegeben hast, dass es um sie geht?
Klar. Das ist auch ein Machtinstrument. Wer in der taz 11 Jahre Chefredakteurin ist, muss guten Journalismus mit sozialer Kompetenz und ganz viel Kommunikationsvermögen verbinden.
Überschätzt du dich nicht ein wenig? 1998 war doch die Zeit einfach reif für Kontinuität – weil die taz selbst keine Lust mehr auf den Dauerclinch zwischen Redaktion und Chefs hatte.
Sehr freundlich! Und typisch, dass bei Frauen der Erfolg nicht ihr eigenes Verdienst sein soll. Die taz hat sich von einem linksalternativen Projekt in ein modernes Unternehmen verwandelt. Für diesen Prozess, von null Hierarchien zu flachen Hierarchien, gab es ja kein Vorbild. Dieser Prozess war harte Arbeit und ist längst noch nicht abgeschlossen.
Du warst, für taz-Verhältnisse, ungewohnt freundlich und hast den Redakteuren oft erst mal recht gegeben. Genau das ist aber manchen auf die Nerven gegangen. Was ist dir denn bei der Redaktion auf die Nerven gegangen?
Es gibt diese seltsame Sehnsucht nach jemand, der führt – aber keine unangenehmen Entscheidungen treffen soll. Das blitzt immer mal wieder auf. Es gibt ein frei flottierendes Bedürfnis in der Redaktion nach autoritären, aber unverbindlichen Gesten. Ich finde das merkwürdig gerade bei Leuten, die von sich behaupten, nicht autoritär strukturiert zu sein.
Das erinnert an die Grünen, die basisdemokratisch begannen und in den 90er-Jahren von Joschka Fischer autoritär regiert wurden – informell, denn Parteichef war er ja nie.
Ja, so ähnlich. Gegen formale Hierarchien gibt es in der taz ein ausgeprägtes, teilweise auch gesundes Misstrauen. Doch in den informellen Hierarchien gibt es genau diese Geste freiwilliger Unterwerfung. Ich habe kürzlich aus der Redaktion gehört, dass die taz eine starke innere Führung brauche. Aber hallo – das ist ein Begriff aus der Bundeswehr.
Diese Zwiespältigkeit Macht und Autorität gegenüber stammt doch aus der linksalternativen Szene, die so doch längst nicht mehr existiert.
Das ist ja das Erstaunliche. Die Redaktion hat sich in den 21 Jahren, in denen ich hier arbeite, zigmal umgekrempelt. Trotzdem gibt es bestimmte Haltungen, die bleiben. Es gibt in der taz ein prägendes kollektives Gedächtnis, das Verhaltensweisen tradiert.
Die taz hat sich, so sehen es jedenfalls viele andere Zeitungen, in den letzten zehn Jahren von links in die Mitte der Gesellschaft bewegt. Sie ist etablierter und auch von anderen Medien akzeptiert. Welchen Preis hat die taz dafür bezahlt?
Die taz soll keine linke Zeitung mehr sein? Was ist das denn für ein Quatsch! Mir war es wichtig, dass die taz sich auf Augenhöhe mit anderen Zeitungen bewegt. Dass die Kollegen anderer Blätter gerne schreiben, dass die taz nicht mehr richtig links, nicht mehr bissig und gemein ist, das ist doch eine Projektion. Sie brauchen uns als die, die immer ganz anders sind, die sich immer trauen, was sie sich selbst nicht trauen. Und bitte: Dass die taz lügt und ihre Ideale verrät, das stand in Kreuzberg schon vor 25 Jahren an den Häuserwänden.
Mag sein. Aber die Frage war, ob die taz, politisch und publizistisch, auf dem Weg in die Mitte etwas verloren hat.
Nein. Für mich war und ist die taz eine linke Zeitung, die intelligent, unterhaltsam und respektlos ist. Es gab immer Bestrebungen in der Redaktion, der taz irgendwie eine einheitliche Blattlinie zu geben. Aber wir sind ein pluralistischer Laden. Und das heißt: Jeder hier muss eine Menge Positionen ertragen, die ihm ums Verrecken nicht passen. Mein Ziel war es immer, diese zum Teil sehr heterogenen Ansätze in der Zeitung zu halten. Es wäre der Tod der taz, wenn sie sich in die linksalternative Nische zurückzieht. Das würde manchem vielleicht passen, aber dort wird die Zeitung nicht überleben. Weil ihr das Publikum fehlt.
An wie viele Putschversuche gegen dich kannst du dich erinnern?
An keine. Aber als ich 1998 gemeinsam mit Michael Rediske und Klaudia Brunst die Chefredaktion bildete, gab es enorme Aggression gegen uns. Ich war richtig schockiert, denn vorher als Reporterin war ich Everybodys Darling. Alle mochten meine Reportagen, alle mochten mich.
Und dann?
Dann kam ich in die Chefredaktion – und wurde von einem Tag auf den anderen gehasst. Es war, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Damals hatte ich bei jeder Redaktionskonferenz, die ich leitete, das Gefühl: Die wollen dich am liebsten absägen.
Warum kam es nicht so weit?
Weil Michael Rediske und Klaudia Brunst gingen und ich dann ein Dreivierteljahr allein Chefin war – ohne Stellvertreter. Da ist diese Aggressionsfront in sich zusammengebrochen. Denn gegen eine einzelne Person, die versucht, den Laden zusammenzuhalten, braucht man solche Abwehrmechanismen nicht. Da muss man lernen zusammenzuarbeiten.
In der Redaktion gibt es manche Frauen, die nicht allzu gut mit dir zurechtgekommen sind. Es gab allerdings auch Männer …
… danke.
Aber manche Redakteurinnen lehnen dich besondern heftig ab. Warum?
Frauen haben sehr viel mehr Probleme mit weiblichen Führungskräften als Männer. Männer verhalten sich eher wie im Rudel, wenn sie einmal ein Leittier akzeptiert haben, dann haben sie danach kein Problem mehr mit Führung. Frauen reagieren anders. Sie sehen in einer weiblichen Führungsperson stärker sich selbst gespiegelt. In Jungsgruppen gehört Wettbewerb selbstverständlich dazu. Die sportliche Auseinandersetzung, das Kämpfen, das Rivalisieren, ohne dass das zu Feindschaft und Hass führen muss. Wenn ein Mädchen aus seiner Gruppe den Kopf rausstreckt, mögen die anderen das überhaupt nicht. Und diese Phänomene setzen sich im Verhältnis zu Chefinnen durch: Sie ist ja nur eine von uns, sie will aber was Besseres sein.
Klingt enttäuscht.
Ich hätte mir manchmal gewünscht, dass die Frauen in der Redaktion sich stärker einmischen. Es gibt viele taz-Frauen, die machen einen tollen Job, aber sie wollen sich aus bestimmten Auseinandersetzungen heraushalten. Weil sie sagen: Das sind doch Jungsgeschichten. Wir wollen an diesen Hahnenkämpfen nicht teilnehmen. Das war für mich wirklich eine große Enttäuschung.
Chefinnen sollen emotional sein, nicht bedrohlich auftreten – aber auch Macht und Führung repräsentieren. Das passt alles eigentlich überhaupt nicht zusammen. Wie hast du das gelöst?
Na ja, diese Männlich/weiblich-Zuschreibungen sind doch Klischees. Ein moderner Führungsstil, so wie ich ihn verstehe, ist eine Mischung aus sogenannten männlichen und sogenannten weiblichen Elementen. Und das heißt, mit Respekt und freundlich aufzutreten, aber in der Sache sein Ding durchzuziehen. Und zwar mit Härte, auch dir selbst gegenüber.
Was bedeutet Härte dir selbst gegenüber?
Ein Indianer kennt keinen Schmerz, und eine Indianerin auch nicht. Wenn ich ein Weichei gewesen wäre, dann wäre ich in dem ersten Dreivierteljahr als Chefin schreiend aus der Redaktion gelaufen. Dieses Gefühl: Da ist ein System, zu dem du gehört hast und das dich jetzt abstößt, war brutal. Am Marterpfahl zu stehen ist kein besonders schönes Gefühl.
Das klingt so, als hättest du hier keinen Spaß gehabt.
Nein, im Gegenteil, ich hatte schon eine glückliche Zeit. Im Frühsommer meines fünften Jahres in der Chefredaktion hieß es eines Tages, ich solle auf den Dachgarten kommen. Da standen Unmengen von Leuten aus Verlag und Redaktion und haben eine Überraschungsparty für mich gemacht. Das war klasse. Da sind mir echt die Tränen gekommen.
Wenn tazler die Zeitung verlassen, folgt oft eine Phase der Verbitterung. Später kommt Verklärung. In welchem Stadium befindest du dich gerade?
Ach, ich habe alle Phasen schon mehrfach durch. Enttäuschung, Bitterkeit, Wut bis hin zu Hass, aber auch Phasen von Begeisterung und Leidenschaft und wirklich großer Liebe zu dieser Zeitung. Im Moment ist es eine Mischung aus Melancholie und großer Sorge um die Zukunft der taz. Aber auch innere Unruhe, weil für mich etwas Neues ansteht. Zwischendurch blitzt schon mal eine Ahnung von Freiheit auf. Aber das ist längst noch nicht das dominierende Gefühl.
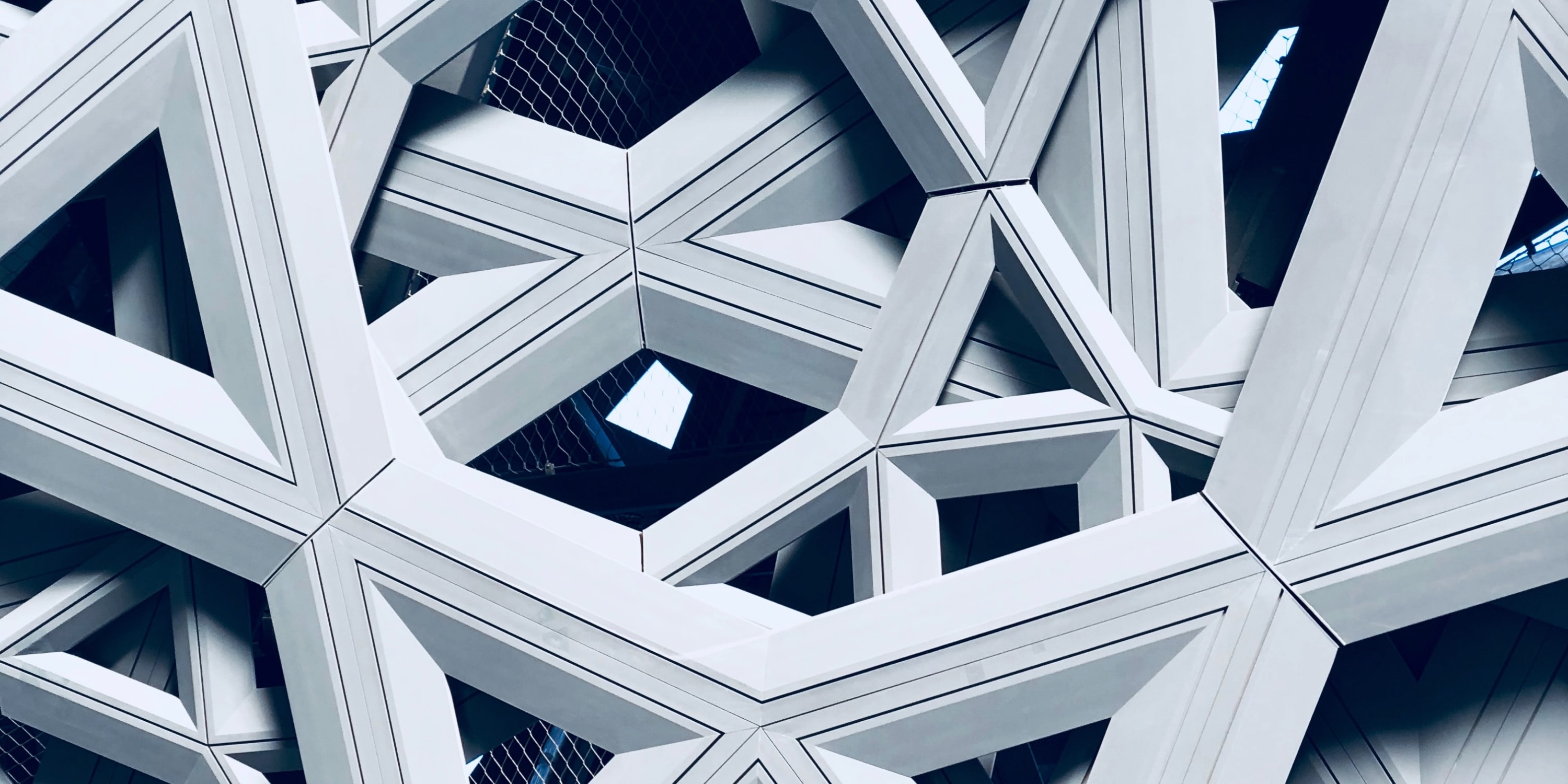



[…] Vorgängerin Bascha Mika warnte in ihrem Abschiedsinterview, die taz dürfe nicht in die “linksalternative Nische abrutschen”. War das an […]