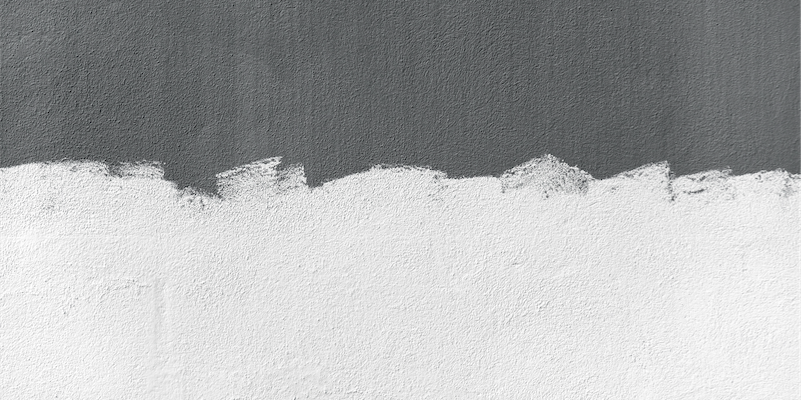Auch Neonazis wollen Aufmerksamkeit. Dafür brauchen sie die Medien. Drei taz-JournalistInnen berichten, welche Erfahrungen sie mit der NPD machen.
Zurückrufen und höflich sein
Von Astrid Geisler
Das Strategiepapier muss eine Zumutung sein – zumindest für viele überzeugte Neonazis. „Wir sind im Ton freundlich, bedanken uns für das Interesse an unserer Arbeit und versuchen ggf. Wünsche zu erfüllen“, heißt es im 39 Seiten langen Leitfaden der NPD zur Pressearbeit. „Am Telefon melden wir uns mit dem Namen unserer Partei. Wir gehen ans Telefon, wenn jemand anruft. Wenn unser Kontakttelefon nicht zu erreichen ist, dann haben wir zumindest den Anrufbeantworter eingeschaltet und rufen natürlich auch umgehend zurück.“
Journalisten zurückrufen und dabei auch noch höflich sein? Und das, obwohl unter Rechtsextremen doch eigentlich Konsens ist, dass die „Schmierfinken“ von der „Judenpresse“ der letzte Abschaum sind? So wünscht es zumindest die NPD-Parteiführung. Für die Strategen in der Berliner NPD-Zentrale gilt die Devise: Journalisten umgarnen statt verprügeln. Schließlich ist die Partei auf Medienberichte angewiesen, um zu den Wählern durchzudringen. Und die Reporter sollen beim Stichwort NPD an professionell auftretende Politiker denken – nicht an gewaltbereite Neonazis. Gerade jetzt, da auf allen Kanälen über das rechte Killerkommando aus Jena und seine mutmaßlichen Verbindungen zur NPD berichtet wird.
Verantwortlich für die Regeln zur Pressearbeit ist Klaus Beier, langjähriger NPD-Sprecher und Parteivorsitzender in Brandenburg. Beier hat selbst vor Jahren dem „Bund Frankenland“ in Bayern angehört, einer Neonazi-Kameradschaft, die laut dem bayerischen Verfassungsschutz „die Beseitigung des Grundgesetzes, der parlamentarischen Demokratie und die Schaffung eines ,Vierten Deutschen Reiches nationalistisch-rassistischer Prägung“ anstrebte. Ideologisch ist er mit den militanten Neonazis auf einer Linie. Dennoch steht er für einen geradezu radikalen Pragmatismus im Umgang mit Journalisten. Dass seine Gesinnungsgenossen am Rande von Parteitagen oder Demonstrationen immer wieder Reporter anpöbeln oder sogar handgreiflich werden, passte Beier nicht ins PR-Konzept. Die Funktionäre der NPD könnten „die geborenen Zulieferer für regionale, aber auch überregionale Medien“ sein. Doch dazu müsse seine Partei „die Hinterzimmeratmosphäre“ überwinden und „ganz bewusst die Öffentlichkeit“ suchen.
Als Pressesprecher hat Beier täglich die offensive Pressestrategie umgesetzt. Die taz konnte auf der Seite eins titeln: „NPD: die Verbrecherpartei“ – und ein paar Tage später stand er taz-Journalisten trotz allem wieder höflich Rede und Antwort. Auch sein Nachfolger, der neue NPD-Sprecher Frank Franz, will diese Anbiederungstaktik offenbar fortführen. Gleich in einer seiner ersten Pressemitteilungen versichert er: „Medienvertretern mit vernünftigem journalistischem Anspruch stehen wir gerne Rede und Antwort.“ Die NPD respektiere Journalisten, die „gewillt sind, objektiv über das zu berichten, was die NPD betrifft“.
Das heißt allerdings auch: Für einige, als besonders lästig wahrgenommene Journalisten ist die NPD nicht zu sprechen. Szenekennerinnen wie die freie Journalistin Andrea Röpke bekommen schon mal eine schriftliche Ausladung statt einer Akkreditierung zum Bundesparteitag. Begründung: Sie hätten in der Vergangenheit „im vorauseilenden antifaschistischen Gehorsam die antidemokratischen Phantasien der multikulturalistischen BRD-Obrigkeit Realität werden lassen“.
Solche Exempel haben für die NPD-Führung einen nicht zu unterschätzenden positiven Nebeneffekt. Sie besänftigen jene Parteimitglieder, denen die Anbiederung an die „Feindpresse“ zu weit geht.
Gerade im militanten Neonazi-Spektrum fordern viele weiterhin einen Boykott der Massenmedien. Die rechtsextreme Zeitschrift Volk in Bewegung hat diese Strategie in zwölf „Leitlinien Feindpresse“ zusammengefasst. Der „sogenannten liberalen Presse“ wird einiges vorgeworfen. Ihre „Hetzjournalisten“ seien „bewusst ausgewählte geistig-seelisch und körperlich minderwertige Menschen“. Jede Zusammenarbeit „mit Institutionen, deren Aufgabe es ist, Volk und Staat in den Ruin zu schreiben“, schließe sich daher aus. Pressemitteilungen seien „Munition an den Feind“, Pressesprecher nichts anderes als „Verbindungsoffiziere zum Feind“.
Obwohl die NPD-Führung seit Jahren versucht, zumindest ihre Mitglieder von diesem Boykott abzubringen, tun sich einige noch schwer mit der offensiven PR-Strategie. Der Potsdamer NPD-Stadtverordnete Marcel Guse zum Beispiel versicherte in einer E-Mail an einen taz-Journalisten, er empfinde „einen unaussprechlichen Ekel, wenn mich volksfeindliche Elemente Ihres Schlages anschreiben“. Dann ließ er seinen Gefühlen freien Lauf: „Sie und ihr rotes Käseblatt sind eine Schande für die vielen Generationen unseres Volkes, die vor uns kämpften und starben damit Deutschland leben kann. Ich verachte Sie!“
Systempresse? Abhauen!
Von Wolf Schmidt
„Erlebnisscheune“ heißt der Veranstaltungsraum des Hotels „Romantischer Fachwerkhof“ bei Erfurt, in den sich die Thüringer NPD nach der Landtagswahl 2009 zurückgezogen hatte. Sie wollte hier den Einzug ins dritte Ostparlament feiern, doch am Ende hat es für die Rechtsextremen mit 4,3 Prozent knapp nicht gereicht.
Gefrustete Neonazis, das wollte ich mir anschauen. Doch am Eingang der „Erlebnisscheune“ traf ich an dem Abend Ende August erst mal einen freundlichen NPD-Pressesprecher in Sakko und Hemd: Patrick Wieschke. Ach, von der taz, ja, Herr Schmidt, kommen Sie doch rein, sagte der nur. Essen und Trinken gebe es auch.
Patrick Wieschke ist vor knapp zehn Jahren zu 33 Monaten Haft verurteilt worden, weil er an einem Anschlag auf einen Döner-Imbiss in Eisenach beteiligt war: als Anstifter. Umgangssprachlich nennt man das wohl Terror. Mit so einer Vita auf Typ netter Schwiegersohn zu machen, dafür muss man schon ziemlich dreist sein. Drinnen auf der Wahlparty in der „Erlebnisscheune“ wollten freilich nicht alle so freundlich tun wie Wieschke. Und statt Anzug trugen viele der NPD-Kader und -Anhänger einfach nur T-Shirts mit dem Aufdruck „Nationaler Sozialismus“.
Nach einer guten halben Stunde begann jemand in der „Erlebnisscheune“ laut zu grölen: Ob die von der „Systempresse“ jetzt mal abhauen könnten, damit man endlich richtig anfangen könne. Da bin ich dann doch lieber gegangen.
Vor wenigen Tagen habe ich wieder mit Patrick Wieschke telefoniert. Er ist vor zwei Wochen in den Bundesvorstand der NPD aufgestiegen. Er, der früher nicht nur der „Döner-Bomber von Eisenach“ war, sondern auch beim „Thüringer Heimatschutz“ mitmarschierte, wie Fotos aus alten Tagen zeigen. Jenem militanten Kameradschaftszusammenschluss also, bei dem einst auch das Neonazi-Terror-Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe mitmischte.
Mit denen, sagt Wieschke heute, habe er nichts zu tun. „Ich kenne keinen Nationalsozialistischen Untergrund“, sagt er. Ganz freundlich.
Kaffeetrinken mit den Nazis
Von Andreas Speit
Ein Marktplatz in Boizenburg, Mecklenburg-Vorpommern, kurz vor der Landtagswahl 2011. Die NPD hatte einen Infostand aufgebaut und verteilte Flugblätter. An jenem Markttag war ich der einzige Journalist vor Ort.
Der NPD fiel ich gleich auf. Offene Ablehnung brachten sie einem entgegen. „Guten Tag, Herr Speit, noch Platz?“, fragte aber lächelnd Stefan Köster, NPD-Landtagsabgeordneter. Zusammen mit Michael Grewe, damals NPD-Fraktionsmitarbeiter, stellte er sich zu mir an einen Tisch, beim Kaffee- und Kuchenstand.

Vor knapp sechs Jahren trat Stefan Köster auf eine am Boden liegende Demonstrantin ein. Ich stand daneben bei dem Wahlauftakt in Schleswig-Holstein. Ich wusste nicht, ob ich eingreifen sollte oder nur beobachten. Später sagte ich gegen Köster aus. In der Deutschen Stimme erschien auch deswegen später ein diffamierendes Porträt über mich. Bis heute finden die meisten Veranstaltungen der Szene unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – wie besondere Konzerte, alle Lager, politische Schulungen und auch NPD-Landesparteitage.
Wenn wir als Journalisten diese Veranstaltungen dennoch entdecken, werden wir angegangen. So stand bei einer meiner Recherchen mal ein Neonazi mit einer Eisenkette vor mir. „Ich mach dich platt“, sagte er. Ein anderer Neonazis versuchte mit seinem Auto meinen Wagen von der Fahrbahn zu drängen. Grundsätzlich wollen die Rechtsextremen nicht, dass es Journalisten gelingt, zwischen Schein und Sein der Szene zu unterscheiden. Gelingt es dennoch, wird im Internet immer wieder gegen uns gehetzt.
Vielleicht auch, weil unsere Berichte Folgen haben: Neonazis verloren Arbeitsplätze oder kamen vor Gericht. Nach einem brutalen Angriff auf Gegendemonstranten nannte ich Namen von anwesenden Neonazis. Ein Verfahren gegen Grewe und weitere Kameraden folgte.
In Boizenburg auf dem Marktplatz plauderte er trotzdem mit mir. „Noch einen Kaffee?“, fragte er. „Es wird wohl das erste und letzte Mal sein, dass ich Ihnen einen anbiete“. Dachte ich auch und sagte: „Nein danke!“
Siehe auch das Interview mit Andreas Speit über seine bisher bereits 20 Jahre währende journalistische Beschäftigung mit der NPD: „Gern wird auch geschubst, gespuckt oder geschlagen.“