Der falsche Zug fährt vorbei
Ich sitze auf einer Bank und lese in einem Buch. Die Bank ist aus Metallgeflecht und steht auf dem S-Bahnsteig am Ostkreuz. Das Buch ist mir eigentlich egal. Wichtig ist, dass die schräg gestellte Oktobersonne auf die Bank scheint. Der Zug nach Strausberg Nord wird in ungefähr einer Viertelstunde vom Gleis hinter mir, auf der Nordseite des Bahnsteiges, abfahren. Noch eine Viertelstunde gleißende, güldene Sonne.
Könnte es sein, dass ich vergesse, wie lang eine Viertelstunde ist? Die S5 nach Strausberg Nord fährt nur alle 40 Minuten. Und nur diese eine S-Bahn hat Anschluss an den Bus 927, der weiter nach Reichenow fährt.
Die Busse auf dem Land fahren die Hauptverbindungsstrecken entlang und zweigen von dort in die Dörfer ab. Nicht alle Busse fahren in alle Dörfer. Meine Freundin K. hat für mich diesen ausgesucht, der mich nach Hause bringen wird. Aber ich darf die S-Bahn nicht verpassen.
Ich setze mich um, auf das kalte Gitter der Bank auf der anderen Seite. Der Blick kann jetzt ganz einfach über den Buchrand auf die Gleise gleiten. Aber dann kommt auch das mir nicht mehr sicher genug vor. Ich stelle mich an den Bahnsteigrand und schaue den ankommenden Zügen entgegen, damit ich gleich das Ziel an der Zugfront erkennen kann. Es gibt zwar auch eine Anzeigetafel auf dem Bahnsteig, aber ich habe mich schon entschlossen, dass, wenn es da Abweichungen geben sollte, ich der Auskunft des Zuges selber vertrauen würde.
Es kommt eine S-Bahn nach Wartenberg. Nach meiner Rechnung müsste die S5 folgen. Ich steige normalerweise am Ostbahnhof oder an der Warschauer Straße ein, deshalb weiß ich die Abfahrtszeiten von hier nicht genau. Es ist zwischen Bahnhof und Bahnhof aber fast immer ein Zeitintervall von 2 Minuten.
Auf dem nächsten Zug steht „Hoppegarten“. Das liegt zwar auf dem Weg, ist aber weit vor Strausberg. Könnte das ein Einstellungsfehler sein? Ich schaue zur Anzeigetafel hoch. Auch dort steht „Hoppegarten“. Ein Entlastungszug vielleicht. Bei den ICs fährt auch manchmal ein außerplanmäßiger Zug voraus, um schon mal einen Teil der Leute mitzunehmen.
Der Zug nach Hoppegarten verlässt den Bahnhof. Ich warte drei, vier Minuten und werde unruhig. Die S7 nach Ahrensfelde fährt ein. Eine andere Richtung, aber bis Lichtenberg dieselbe Strecke. Ein hastiger Blick auf den ausgehängten Fahrplan bestätigt mir, dass die S7 eindeutig nach der S5 kommt. Als ich das Abfahrtssignal höre, springe ich noch schnell durch die Tür.
Zwei Stationen weiter kommt der Bahnhof Lichtenberg. Von hier fährt der Regionalzug nach Osten bis an die polnische Grenze. Seine Abfahrtzeiten kenne ich auswendig. Wenn man die S-Bahn verpasst hat, kann man mit diesem Zug bis Strausberg Bahnhof fahren, dabei die verpasste S-Bahn überholen und in Strausberg Bahnhof umsteigen, um dann zehn Minuten später in Strausberg Nord anzukommen.
Bei der Einfahrt in Lichtenberg sehe ich den Regionalexpress mit der großen Aufschrift „Heidekrautbahn“ schon auf dem Nachbarbahnsteig. Lichtenberg ist sein Endbahnhof. Er bleibt zehn Minuten stehen, bevor er zurück nach Küstrin fährt. Im Tunnel überkommt mich aber doch Angst, dass die Bahn plötzlich losfährt, ohne mich, und ich in Lichtenberg hängen bleibe. Ich haste nach oben. Die beiden Waggons stehen ungerührt da. Die Tür öffnet sich auf Knopfdruck und schließt sich hinter mir wieder. Auch die Fahrgäste sitzen ungerührt, als sei gar nicht beabsichtigt, dass der Zug sich jemals wegbewegt. Er tut es zum vorbestimmten Zeitpunkt.
Wir rollen durch die Vororte. Ich habe wieder angefangen, in dem Roman zu lesen. Ohne nachzudenken habe ich mich auf die Sonnenseite gesetzt. Wenn – falls – wir die S-Bahn überholen, müsste sie auf der anderen, der nördlichen Seite zu sehen sein. Nach einigen Minuten klappe ich das Buch zu, um an den lesenden oder schlafenden Menschen vorbei durch das Fenster auf der anderen Seite zu schauen. Ich zwinge mich zur Aufmerksamkeit und schiebe ein Telefongespräch auf, in dem ich zu fragen vorhatte, ob mich vielleicht jemand mit dem Auto in Strausberg Bahnhof abholen kann.
In Fredersdorf ziehen wir dann tatsächlich an der S-Bahn vorbei. Fredersdorf liegt hinter Hoppegarten. Als ich zurückschaue, sehe ich den Schriftzug „Strausberg Nord“. Wie das? Wie kann das sein? Es ist die einzige S-Bahn, die wir überholt haben, und die fuhr laut Aufschrift nur bis Hoppegarten.
Jedenfalls ist es richtig, in Strausberg Bahnhof den Zug zu verlassen, es gibt gar keine andere Möglichkeit für mich. Die Ausgestiegenen strömen an mir vorbei; sie wissen, wohin sie wollen. Ich wandere nachdenklich ein Stück zurück bis zum S-Bahnsteig, um auf die S5 zu warten.
Den Bus erreichen
Wenn sie aber nicht kommt? Wenn sie ihr Fahrtziel ändert? Vielleicht habe ich doch falsch gelesen? Ich brauche ja nicht die S-Bahn, sondern ich brauche den Bus, den 927er von Strausberg Nord nach Wriezen, der mich nach Reichenow bringt. Mir fällt ein, dass der Bus möglicherweise schon von hier abfährt.
Auf der anderen Seite des Bahnhofsvorplatzes stehen Busse. Ich könnte gucken, ob der 927er dabei ist. Reicht die Zeit, notfalls zurück zu gehen? Ich rechne die Fahrtzeiten nach, schätze die Entfernungen, vergleiche errechnete Zeitspannen und gehe los.
Es ist der 927er. Der Busfahrer steht mit zwei Fahrgästen, die ihm bekannt sind, vor der Tür und raucht. Er lässt noch keinen rein. Noch könnte ich zurück und die S-Bahn nehmen, wenn sie denn kommt. Aber warum sollte der Bus nicht fahren? Warum noch einmal umsteigen? Eine plötzliche Abschweifung erfasst mich. Gegenüber ist eine Bäckerei; ich will zwei Brötchen kaufen und mit Thomas ein schönes Mittagessen haben, wenn ich angekommen bin. Während ich hinübergehe, wähle und zahle, fährt im Bahnhof die S-Bahn ein – und davon.
Aber alles geht gut. Ich sitze mit der Brötchentüte im Bus, der gleichmäßig brummend Richtung Norden fährt. Die wenigen Fahrgäste haben sich in der Tiefe des Busses verteilt. Ich sitze hinter dem Fahrer, der einen Ohrring trägt. Die Sitze sind teppichartig bezogen. Sie schwanken und schweben über der durchfahrenen Straßenlandschaft. Ich fühle mich in Sicherheit, fast schon zuhause angekommen.
Strausberg ist eine lange, sehr lange Stadt. Villenvororte, Wohnblock-Gegenden, Beamten-Siedlungen, dann die Innenstadt. Der 927er fährt an der Stadtmauer entlang. Am Gymnasium steigen geschminkte Mädchen und gelangweilte Jungen ein. Alle haben Stöpsel in den Ohren, gegen die sie anreden. Noch mal Beamtensiedlungen, das Krankenhaus, die Einkaufszentren, dann kommt der S-Bahnhof Strausberg Nord. Die S-Bahn war da und ist schon wieder weg, alles fahrplanmäßig. Hier stünde ich jetzt, wenn ich mich anders entschieden hätte. Erleichtert würde ich den Bus ankommen sehen, denn ich hätte bis zum letzten Moment gezweifelt, ob K. den Fahrplan richtig gelesen hat. Aber nun ist er da, der Bus, und noch besser: ich sitze schon drin.
Einsteigen vorne, aussteigen hinten. Während der Fahrt werden die kommenden Stationen auf einem Schriftband über dem Mittelgang angezeigt. Die Haltestellen sind nach Einrichtungen benannt, die es gar nicht mehr gibt: Gesundheitszentrum, Sägewerk, Forsthaus. In Prötzel fährt der Bus eine Schleife, um Kinder aus der Grundschule aufzunehmen. Sie werden von einem Betreuer bis zur Bustür begleitet und einzeln an den Schultern hinein geschoben.
Nach Prötzel folgt der Bus der Straße bis nach Prädikow, wendet dort an der Haltestelle, lässt zwei Frauen aussteigen und fährt zurück zur Hauptstraße Richtung Wriezen. Herzhorn liegt am Weg und wird angefahren. Danach kommt eine Haltestelle auf freier Strecke, die „Reichenow Kreuzung“ heißt. Sie ist aber noch zwei Kilometer vom Reichenower Ortseingang entfernt. Hier aussteigen ist zu früh. Der Bus fährt rechts herum bis ins Dorf hinein.
Aber der 927er, in dem ich sitze, tut das nicht. Er fährt an der Abzweigung vorbei. Der falsche Bus, die falsche Verbindung. K. hat doch nicht richtig gelesen, oder sie kennt den Unterschied zwischen Reichenow Kreuzung und Reichenow Dorf nicht. Dann hätte ich doch hier aussteigen müssen. Aber dazu ist es nun zu spät. Ich muss an der nächsten Haltestelle raus. Das ist die Station „Frankenfelde Abzweig“.
Weg ins Offene
Ein paar verstreute Häuser und eine Querstraße, die nach Westen in ein anderes Dorf führt. Nach Osten, Richtung Reichenow führt gar nichts. Um auf die nächste Verbindungsstraße zu kommen, hätte ich jetzt noch eine Station weiter fahren müssen. Nun stehe ich da, der Bus fährt davon. Ich bin allein mit einem leeren Bushäuschen. Es ist eine Art Blockhütte aus Baumstämmen. Das massive Schutzangebot verweist darauf, dass man es wohl brauchen wird. Aber ich will hier nicht bleiben. Ich will nach Hause.
Ein weites Feld dehnt sich östlich der Straße, ein sehr weites Feld. Es ist gar nicht absehbar. In der Ferne, in winzigster Stecknadelkopfgröße die Alleebäume der Straße, die nach Reichenow Dorf geführt hätte. An der Hauptstraße werde ich nicht bis zum Abzweig zurücklaufen. Die Autos schießen auf Tuchfühlung vorbei. Einen Seitenstreifen gibt es nicht.
Es bleibt das Feld. Ich gehe querfeldein. Ich betrete die braune Erde, aus der kleine grüne Halme herausschauen. Es macht nichts, wenn ich darauf trete. Das ist alles nur Gründüngung oder bestenfalls Biomasse für die Energieproduktion. Pflanzenschutz wird nicht gewährt sondern gesprüht. Alles andere ist Sentimentalität. Das hier ist Winterroggen. Er wird eingesät, damit sich keine anderen Pflanzen auf dem leer geputzten Acker ausbreiten können, bevor die Wachstumspause anfängt. Vor zwei Wochen waren hier die großen Erntemaschinen unterwegs, um die Zuckerrüben einzubringen. Noch ist nicht alles weg, Halden von Rüben liegen an den Feldrändern.
Man sagt hier nicht „Feld“, auch nicht „Acker“, sondern „Schlag“. Dieser Schlag, dieses zusammenhängende Stück Agrarfläche hat gigantische Maße. Kolonnen von Erntefahrzeugen verlieren sich spielend darin. Mit Janne, dem Patenenkel, habe ich am Rand gestanden und zugesehen, wie die Rüben aufgeladen und Lastwagen für Lastwagen davon gefahren wurden. Schon ist alles wieder geglättet, gescheibt, neu eingedrillt. Zwischen den grünen Halmen liegen hier und da halb in der Erde steckende, verlorene Rüben und abgeschnittene Wurzelstränge. Sie sehen aus wie kleine Schädel und bleiche Knöchelchen.
Ich halte auf den fernen roten Fleck zu, der die Reichenower Schlossfahne sein könnte. Es ist wie an einem weiten Strand, der sich nach allen Seiten dehnt. Man verliert das Gefühl für die Dimensionen. Die Schritte werden geschluckt. Der Blick gleitet von den Details unter den eigenen Füßen zu den Punkten in weiter Ferne; zwischen ihnen besteht ein groteskes Missverhältnis. Die Zeit verliert alle Konturen. Man könnte immer so weiter gehen.
An einem dunklen Wintertag hatte ich eine Wanderung nach Batzlow machen wollen. Es lag hoher Schnee. Das hatte mich gelockt, aber es wurde dann schwerer, als ich gedacht hatte. Der Hohlweg war so voll geweht, dass ich, nachdem ich mich schon weit vor gearbeitet hatte, einfach nicht mehr weiter konnte. Ich wollte auch den mühsamen Weg nicht zurück und hatte mir überlegt, dass auf dem freien Feld vielleicht besser voran zu kommen ist, weil es weniger Widerstände gibt, an denen sich Schneewehen bilden könnten. So schlug ich den Rückweg über das Feld ein.
Ich wusste nicht, was sich unter so einem weiten, verschneiten Feld alles verbergen kann. Es gab Hügel und Mulden, Gräben und Gestrüpp und immer wieder tiefe Schneewehen, die ich vom Weg aus nicht gesehen hatte. Ich stolperte voran, mit jedem Schritt erst bis zu den Knien, dann bis zu den Oberschenkeln einsinkend. Das Feld dehnte sich endlos. Ich hatte das Gefühl, überhaupt nicht weiter zu kommen. Ich hatte keine Kraft mehr, ich konnte die Beine kaum noch hochziehen. Es wurde dämmrig. In der Ferne war die Straße zu sehen. Manchmal fuhren Autos vorbei. Mein Rufen wurde vom Schnee geschluckt. Mein Armwedeln hat niemand gesehen. Wie auch? Wer schaut dahin, wo er nichts zu sehen erwartet? Ich dachte an mich selbst zurück als eine, die an einem Winterabend auf dem Feld liegen geblieben und erfroren ist. Aber ich wälzte mich doch weiter aus jeder Schneewehe heraus. Als ich den Weg erreichte, funkelten die Sterne über mir.
Verborgen im Nirgendwo
Auf dem Reichenower Feld liegt kein Schnee, nur die bleichen Rübenreste zwischen den winzigen, zarten neu aufgegangenen Halmen. Alle sechs oder sieben Meter eine Traktorspur. Sonst nichts. Ich schaue zurück. Meine Fußspuren sind kaum zu erkennen. Hier ist der Ort Nirgendwo. Wenn ich eine Leiche zu vergraben hätte, wäre das wahrscheinlich ein guter Platz. Hier sucht niemand. Hier kommt niemand zufällig vorbei. Die Traktorfahrer, die zwei- oder dreimal im Jahr durchfahren, sehen wahrscheinlich bei der Arbeit fern.
Links vor mir gibt es vielleicht zweihundert Meter entfernt ein paar Flecken, deren Braun sich vom Boden abhebt. Findlinge können es nicht sein; die wären längst an die Seite geräumt. Die Flecken bewegen sich. Als ich näher komme, stehen sie auf. Auch sie haben mich wahrgenommen. Rehe verstecken sich tagsüber im Unterholz – oder in der Weite. Da sind sie sicher. Wenn sich Gefahr nähert, sind sie schnell genug, um rechtzeitig zu entkommen. Die Gruppe setzt mit anmutigen Sprüngen über das Feld. Das letzte Reh bleibt noch eine Weile stehen und sieht zu mir herüber, bevor es den anderen folgt.
Ich kreuze eine diagonal verlaufende Fahrzeugspur, die schmaler und tiefer ist als die von den Traktoren. Ich folge ihr mit den Augen bis zu einer entfernt liegenden Niederung, in der Schilf und ein paar Bäume wachsen. An ihrem Rand erkenne ich einen Hochsitz. Die Gewehrkugel ist schneller als das fliehende Reh, aber so weit reicht sie wohl doch nicht. Wenn die Schläge noch größer werden, werden die Jäger irgendwann mit intelligenter Munition schießen, die klein, kompakt und gefährlich den Rehen hinterher fliegt.
Auch im Land Nirgendwo gibt es Leben und Geschehen. Ein Farbwechsel im Boden wird sichtbar. Ich überschreite eine Vegetationsgrenze. Hier hat bis vor kurzem Mais gestanden. Die grauen Strünke stecken noch im Boden. Gehäckselte Blätter und einzelne Maiskolben liegen verstreut. Ich suche den Horizont mit den Augen ab. Der rote Punkt, den ich für die Schlossfahne halte, ist deutlich zu erkennen. Ob sie näher gekommen ist, kann ich nicht beurteilen; ich habe keinen anderen Vergleich als die Erinnerung, und in der gibt es keine Größenmaßstäbe.
Ich durchwandere das Maisfeld. Die Farbe der einzelnen, liegen gebliebenen Maiskolben ändert sich von ausgeblichenem Gelb zu Kieselgrau. Es fehlen die Maiskörner. Die Kolben sind nur noch Gerippe. Auch die Erde verändert sich, sie ist wie gekräuselt. Es gibt Fußspuren. Große, dreizackig gegabelte, vielfach übereinander liegende Fußspuren. Das müssen große Vögel gewesen sein. Ich finde fein geformte, leicht gebogene, flaumweiche Federn und schwarzweißen Vogelkot. Die großen Vögel haben gegessen, sie haben sich geputzt, haben sich hin und her bewegt, haben verdaut und sind dann weiter geflogen. Hier in der schützenden Weite stört sie niemand.
Auch ich bin in der Weite verborgen, das wird mir bewusst. Eingehüllt im Alleinsein. Wenn ich hier pinkele, sieht es niemand. Ich lege mein Gepäck ab, knöpfe die Hose auf und hocke mich hin. Das Wasser rinnt zwischen den Strünken durch, es wird vom Boden aufgesogen und es bleibt nichts als eine leichte Verfärbung zurück. In der Ferne höre ich sirrende Geräusche.
Zwei Vogelschwärme kommen vom nördlichen Horizont in meine Richtung geflogen. Sie kreisen umeinander, vermischen und teilen sich und geben dabei lang gezogene, krächzende Laute von sich. Ich sitze ganz still und beobachte sie. Ob sie wirklich hierher fliegen? Immer wieder sieht es so aus, als ob sie ihre Richtung ändern wollen, aber sie scheinen nur systematisch den Grund unter sich abzusuchen. In Kreisen kommen sie näher. Ich kann die langen Hälse, die gestreckten Beine und die langsam schwingenden Flügel sehen. Sie suchen und sie verständigen sich. Jetzt kreisen sie über mir. Ich bin ein Teil des Bodens, eine kleine Erhebung. Ich habe den Kopf nach hinten gelegt und sehe ihnen entgegen.
Dann stehe ich auf, immer noch den Kopf in den Nacken gelegt, und breite langsam die Arme aus, als wollte ich mich zu meiner eigenen Größe bekennen. Sie sehen die Bewegung auf dem Feld, eine Bewegung, mit der sie gerechnet haben, die sie aber nicht wünschen, fliegen krächzend noch ein paar Runden und ziehen dann, langsam kreisend über mich hinweg. Ich schaue ihnen nach, bis sie am Horizont verschwinden. Mit der Brötchentüte in der Hand gehe ich weiter.



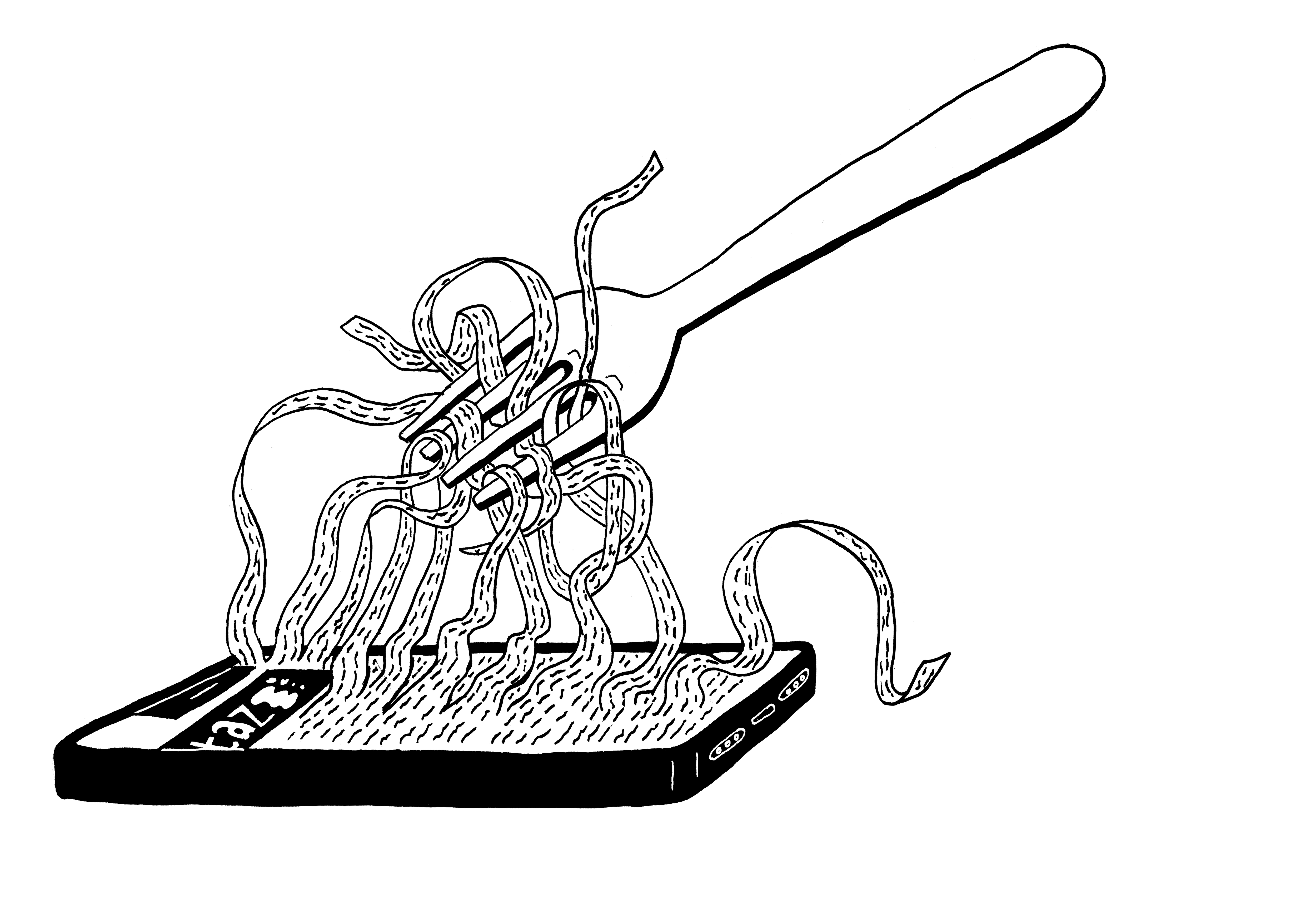
Liebe Imma,
ich lese deine Beiträge sehr gerne, vermisse nur gerade was über den neuesten stand der stiftung und was nun mit der lokomotive karlshof passiert. Du hattest mich ja dankenswerterweise aufgeklärt – aber das ist schon wieder mindestens drei monate her.
In Oldenburg an der Uni gibt es eine politische Gruppe, die sich mit Genossenschaften beschäftigt. Ich habe ihnen deinen Namen und deinen blog genannt, vielleicht laden sie dich demnächst ein, damit du ihnen was über deine diesbezüglichen Gedanken erzählst…
gruß
h.h.