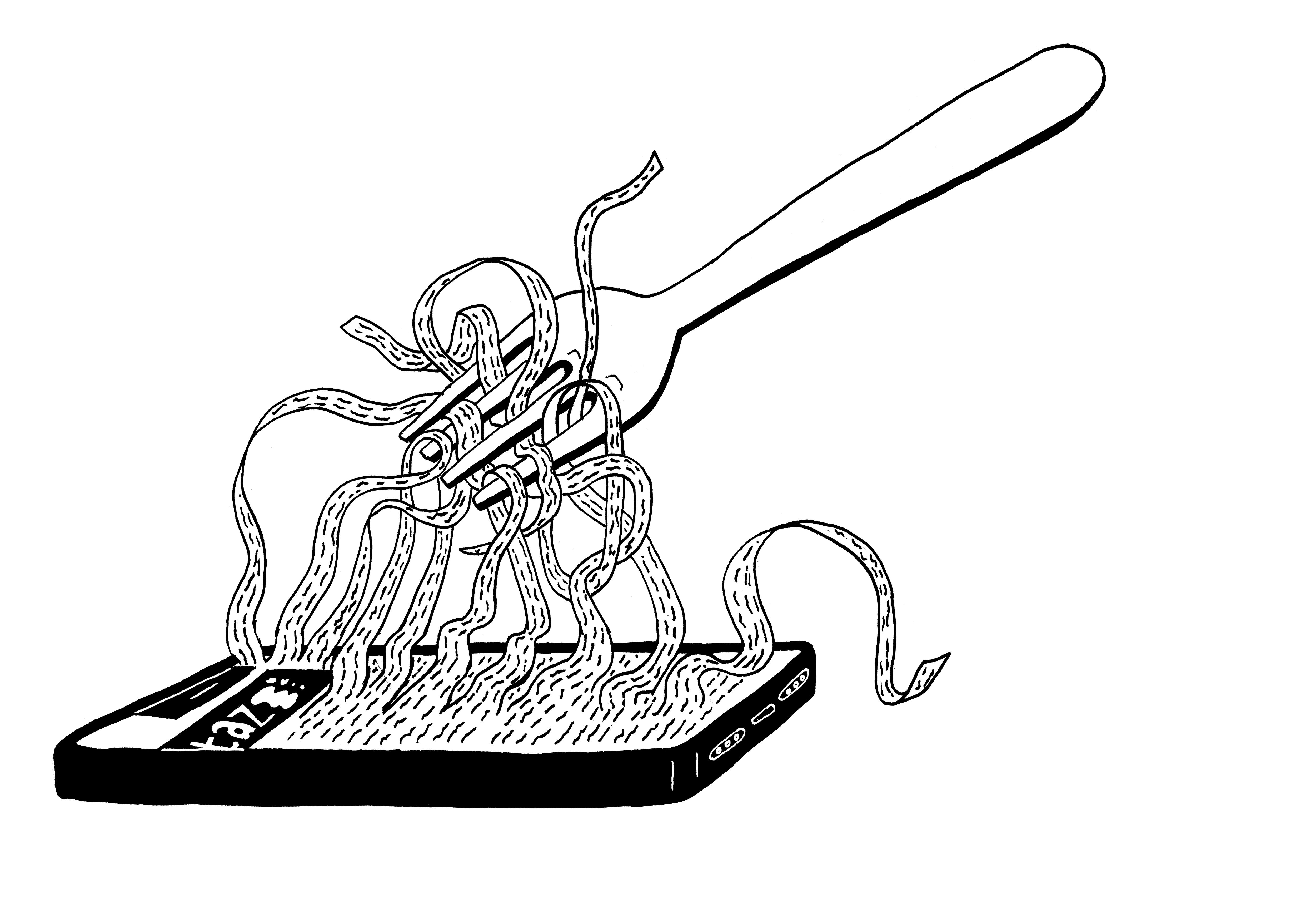Peter Paul Zahl.
Jamaica, im Haus von PP Zahl, mit Blick aufs Meer.
Unveröffentliches Gespräch aus dem Frühjahr 1994. Erster Teil.
V.: Peter, du lebst nicht mehr in Deutschland. Hast dich zurückgezogen von Europa, auch von der politischen Arbeit?
Z. : Ich bin nicht da ausgestiegen, ich bin hier eingestiegen. Schnauze voll von Deutschland, wieso? Ich möchte mich hier einmischen.
V.: Wie sieht diese Einmischung aus?
Z.: Ich mache jetzt eine Bürgerinitiative, dann einen Umweltverband. Es gibt eine Theatergruppe, die wir hier aufgebaut haben.
V.: Kannst du das etwas konkreter ausführen, deine Einmischung in Deutschland sah doch ganz anders aus.
Z.: Ich hatte die Faxen dicke, sowohl von Deutschland als auch von der ehemaligen politischen Linken, weil die meiner Ansicht nach niveaulos geworden ist, mittelständlerisch, langweilig, pazifistisch. Bis auf ein paar Autonome, die mir nicht autonom genug sind. Als ich aus dem Knast raus kam, habe ich gesehen, dass die 60er Bewegung endgültig vorbei war. Das war 1983. Ich bin dann erst einmal hier, nach Jamaica gekommen, um von den Leuten zu lernen und nicht um ihnen etwas beizubringen. Ich bin doch kein Kolonialist. Ich will lieber jamaicanisieren als ein neues Deutschland machen. Ich werde gerade eingebürgert. Das geht nach fünf Jahren.
V.: Wieso Jamaica, warum nicht Wladiwostok, Peking, Rio oder Manhattan?
Z.: Für mich war klar, es sollte ein Land im Süden sein, das englischsprachig ist. Australien, Neuseeland sind zu amerikanisiert. Blieben also dann die kleinen Pazifikinseln und die Karibik.
V.: Wieso englischsprachig?
Z.: Weil ich sehr gut Englisch konnte. Da bin ich halt nach Trinidad geflogen und von dort aus nach Grenada und wollte mich dort niederlassen.
V.: Es war eher die Schönheit der Landschaft, die dich überzeugt hat?
Z.: Vor allem die Leute.
V.: Was war das Hauptargument, warum bist du geblieben?
Z.: Wer meinen Schelmenroman kennt und die darin enthaltenen Positionen, z. B. Der Faulheit, also ein bisschen easy going zu machen, dafür ist Jamaica das ideale Land. Die Leute hier sind anarchoid, also obrigkeitshassend und sehr antiautoritär und damit verbunden sehr willensstark. Unglaublich stark beeinflusst hat mich auch, wie die Leute hier mit Unglück umgehen. Ein Jahrhundertsturm wie der Hurrican „Gilbert“ 1988, der die ganze Insel plattgemacht hat und die Leute in 24 Stunden verloren, wofür sie ihr ganzes Leben hart gearbeitet haben. Es gab danach 26 verschiedene Reggaetexte über Gilbert. Das ist eine ganz andere Art, mit Katastrophen umzugehen als in Deutschland, wo man schon einen Mord begeht für einen zerkratzen Kotflügel am Golf GTI. Und diese Überlebenskunst der hiesigen Leute, ihr Charme, ihr Wortwitz, ihre Kommunikationsfähigkeit haben mir gefallen. Durch die orale Tradition wird mehr erzählt als gelesen. Kindern werden Geschichten erzählt, Rätsel aufgegeben. Bei Begräbnissen werden sogenannte Runderzählungen zum Besten gegeben. Mich fasziniert auch die Musikalität der Leute, ihr Spaß am Tanzen und der Musik. Ich habe mit 13 oder 14 Jahren einen guten Zugang zu schwarzer Musik bekommen. Vorher waren es Blues und Jazz, hier in der Karibik sind es Calypso, Salsa, Reggae, Soka- viele verschiedene Formen, die jeweils beeinflusst sind von ihren Kolonialherren, aber auch sehr spezifisch afrikanisiert wurden.
V.: Du sprichst von sehr traditionellen Tänzen.
Z.: Die werden hier und heute weiter entwickelt. Die jetzigen Modetänze, z. B. Jix- Tänze, basieren im Grunde auf Volkstänzen.Ich habe vor kurzem noch gesehen, wie afrikanische Musik gespielt wurde oder auch sehr spezifische jamaicanische Musikformen, die teilweise hunderte von Jahren alt sind. Die Kids nehmen das sofort begeistert auf und tanzen genau wie die alten Leute.
V.: Verflüchtigt sich das wieder oder bleibt die Substanz?
Z.: Die Substanz bleibt. Das ist praktisch wie Jazz, der nicht immer auf Blues basiert, eher auf den verschiedenen Ausformungen des Blues, aber immer wieder zum Blues zurückkehrt. Diese hiesige Musik kehrt immer wieder zur Volksmusik zurück und holt sich da ihre Stärke. Rap war hier hier schon lange angesagt, noch bevor er in den USA auftauchte.
V.: Ist der Reggae jamaicanisch oder überhaupt amerikanisch?
Z.: Das ist so entstanden, dass die Leute erst mal abgefüttert worden sind sind in den 50er Jahren mit weißer Musik aus den Staaten. Bing Crosby im Radio und so Zeug. Da die Jamaicaner auch Gastarbeiter waren, sehr viele sind ausgewandert, da es in Jamaica keine Arbeit gab, kamen sie in Kontakt mit Rhythm and Blues in den USA. Rhythm and Blues vermischte sich dann mit der Kirchenmusik der Rasters und mit der Trommeltradition. Diese bunte Taktverschiebung vom Reggae ins Träge, schleppende, teilweise auch 100stel Sekunden neben dem Takt zu trommeln, macht das Typische des Reggae aus. Die Texte sind entweder sehr politisch ,oder sehr gewaltbetont oder sehr sexuell. Keine Schlagermusik.
V.: Der Reggae ist doch noch gar nicht so alt, 30 oder 40 Jahre?
Z.: Früher gab es als Volksmusik den Mento. Saxophon und Akkordeon als Leadinstrument, dann Banjos, Bass, Schlagzeug und Rumbabox- eine große Holzbox mit Eisenspangen dran, praktisch wie ein Bass. Die Musik ist fröhlich und sehr anzüglich.
V.: Aber diese Musik wird kaum gespielt.
Z.: Doch, sie wird gespielt und weiter entwickelt. Sie wird immer wieder zitiert, auch in der Popmusik.
V.: Aber es dominiert doch sicherlich der Reggae.
Z.: Wobei natürlich gesagt werden muss, dass selbst ein Mann wie Bob Marley nach seinem Tod Millionen von Platten verkaufte und damit einen erheblichen Einfluss auf die Weltmusik hatte. Clapton, Joe Cocker, die Stones- alle spielen ab und zu Rave.
V.: In welcher Form verehrt man denn hier die Musiker? Ist das so ähnlich wie bei uns, also absolut idealisiert?
Z.: Idealisiert werden sie so gut wie nie, weil der Kontakt zwischen Publikum und Stars sehr eng ist, weil die ja quasi in der Nachbarschaft wohnen. Sie ziehen also nicht in die Oberstadt. Das trifft hier auf die Hauptstadt Kingston noch viel mehr zu. In der Oberstadt wohnen die Reichen in ihren Villen mit Alarmanlagen, und aus der Unterstadt kommen sämtliche kulturellen Schübe, z. B. Bob Marley. Der hat eine abgebrochene Lehre als Schweißer hinter sich, kommt aus ärmlichsten Verhältnissen, wohnte in den übelsten Slums der Karibik, in Frenchtown. Dann hat er Frenchtown auf die Landkarte der Musik gesetzt. Er hat eine message-music, seine Botschaft ist sehr oft spirituell, religiös. Sie beschäftigt sich mit dem Alltag oder der Liebe, sehr viel mit Polizei und Spitzeln.
Ein Typikum hier ist aber folgendes: In der Vorschule wir die Kreativität enorm gefördert, an den Sekundarschulen gibt es ausgezeichnete Lehrer, die einen Crash-Kurs gemacht haben in der School of Drama und dann Theaterwissenschaften studieren.
V.: Aber sicherlich nur in Kingston!
Z.: Nein nein. Das ist fest im Curriculum drin. Speach, also freie Rede, Tanz, Drama. Meine Stieftochter Sascha z.B., als sie 13 war, hat sie den dritten Preis für Kinder unter 16 Jahren in freier Rede gemacht. Da bekommt sie ein Thema, Papier und Bleistift, 5 Minuten Zeit um sich vorzubereiten, dann geht sie in den Saal, hält eine Rede vor tausend Leuten über ein schwieriges Thema.
V.: Du hast von der oralen Kultur gesprochen und von der Kreativität des Reggae. Ich habe mich etwas umgesehen, man kann hier alles kaufen, Cola, TV Geräte, man kann vor allem amerikanische Serien sehen. Geschieht hier etwas ähnliches wie in den ehemaligen sozialistischen Staaten, nämlich eine Kapitalisierung nicht nur des Marktes sondern auch der Gehirne und der Träume?
Z.: Ja sicher, TV und Video sind auf dem Vormarsch. Die Jamaicaner sind aber gesellige Leute, die auch die Eigenkreativität sehr hoch schätzen. Wenn sie einen Film sehen, sind sie anschließend in der Lage, den Inhalt in einen DJ Text zu übertragen. Das ist ein Land mit einer unglaublichen Mobilität. In England gibt es eine riesengroße jamaicanische Gemeinde. In Brixton, wo die Jamaicaner in Straßenkrawallen immer wieder gegen die Faschisten und die Polizei zugeschlagen haben, speist sich der Reggae auch durch der britischen Kultur.
V.: Die Musik stellt hier ein starkes Moment innerhalb der Kultur da und du scheinst ja ein Experte geworden zu sein. Wird die Musik in allen Altersgruppen akzeptiert und praktiziert.
Z.: Alle tanzen..Wir machen hier Wohltätigkeitspartys, ich bin jeden Samstag unterwegs und fahre nach Port Antonio. Da spiele ich für die alten Leute Musik, Reggae aus den frühen Jahren und es amüsieren sich die Leute zwischen 50 und 80.
V.: Was heißt eigentlich Reggae genau, vom Wortstamm her?
Z.: Es gibt viele Erklärungen dafür. Es kann vom Wort „raggamov“ kommen, also von einem der schlecht gekleidet ist.. Oder es kann das Wort „streggae“ sein. Das ist eine Bordsteinschwalbe, also eine Straßennutte.
V.: Du lebst jetzt zehn Jahre hier. Akzeptieren dich die Leute?
Z.: Das Phantastische an den Jamaicanern ist, dass sie niemals verlangen, dass man sich assimiliert. In Deutschland wird ja erwartet, dass der Türke sich zwangsassimiliert, am besten noch aussieht wie Heino. Das Wichtigste hier auf Jamica ist der Respekt und das Schlimmste, was man tun kann ist „to dis“. Dis meint disrespektieren. Also respektieren sie auch den Fremden in seiner Fremdheit.
V.: Das mit dem Respekt ist klar, den Disrespekt verstehe ich noch nicht ganz.
Z.: Wenn ich dich so sein lasse, wie DU sein möchtest. Ich kann nicht einfach sagen, du musst jetzt Jamaicaner werden. Hier existiert eine total synkretische Kultur, also eine Kultur, die mehr auf Widersprüchen beruht, auf verschiedenen Kulturen, aus denen sich immer wieder etwas neues ergibt. Der Reggae wird durch den Rhythm and Blues weiterentwickelt, der wieder von der hiesigen Kirchenmusik beeinflusst wird- zwei völlig unterschiedliche Kulturen. Erst ist da ein Crash, dann gibt es etwas Neues.
V.: Irgendwann bist du hier einfach aufgetaucht. Du hast inzwischen ein komfortables Haus, Auto, bist mobil, bist mit eine Frau verheiratet, hast ein Kind. Wie war die erste Zeit?
Z.: Es wäre wahrscheinlich schwieriger gewesen, wenn ich nicht den direkten Kontakt zu dieser jamaicanischen Familie gehabt hätte. Dass ich geheiratet habe, Kinder gekriegt habe, Stiefkinder großgezogen und zur Schule geschickt habe, spielt eine große Rolle. Da ich kein reicher Weißer bin, wurde mir von meinen Nachbarn geraten, die Schriftstellerei aufzugeben, und lieber mit der Rinderzucht anzufangen, weil das mehr Geld bringt. Meine zehn Jahre im Knast die zählen hier als etwas Positives. D. h. , der Weiße war ein „Sufferer“, der wie wir unter der Sklaverei gelitten hat. Die denken immer, den Weißen geht es generell gut. Die Touristen, die hier herkommen, müssen alles Millionäre sein, wenn sie für einen popeligen Flug schon 150 ausgeben, also mehr als einer hier in drei Jahren verdient.
V.: 150 Euro in drei Jahren?
Z.: Vielen leben am totalen Rand der Weltwirtschaft. Der Mindestlohn beträgt hier zur Zeit 500 Jamaica Dollar und das für 13 Stunden Arbeit am Tag und 6 tage in der Woche.
V.: Du warst 10 Jahre im Knast, du bist Schriftsteller. Wird dieser Beruf akzeptiert?
Z.: Es gibt hier viele bekannte Schriftsteller und die werden sehr geschätzt. Geld verdienen können sie nur, wenn sie sich Märkte in England oder in den USA suchen. Selbst der Nobelpreisträger Derik Walcot musste als Honorarprofessor in Boston arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er machte damit seinen Wunsch wahr, ein Häuschen im eigenen Land zu bauen. Ich wollte fürs Neue Deutschland karibische Autoren auftreiben. Ich habe sie angeschrieben, keine Antwort. Bis ich erfuhr, dass sie alle inzwischen ausgewandert sind, um sich ihre Brötchen in den USA, Kanada oder England zu verdienen.
V.: Liest du selbst viele einheimische Autoren?
Z.: Hier, die ganze Wand. Das sind alles jamaicanische Autoren.
V.: Die sind auch alle im Handel zu bekommen?
Z.: Es gibt hier gute Stadtbüchereien, Busse fahren übers Land. Die Schulen werden angehalten, die Büchereien auch zu nutzen, nicht nur zu schulischen Zwecken, sondern auch zum lesen und informieren, gerade auch, weil die Fluktuation so groß ist und es so viele Auswanderer gibt. Die Jamaicaner sind ungeheuer offen und nehmen gern Sachen auf, die aus dem Ausland kommen. Die haben einfach kapiert, dass Schriftsteller ein Beruf ist wie jeder andere auch. Ganz einfaches Beispiel: Als wir hier gebaut hatten, gab es hier auch einen Bauarbeiter, der hat sich nur auf seinem Spaten ausgeruht. Da hat mein Nachbar, der das Haus gebaut hat, zu ihm gesagt: „Pass mal auf, Toni, wenn der Peter dich nicht feuert, dann feuer ich dich. Der hackt da oben auf seinem Maschinengewehr rum, um uns am Freitag unseren Lohn auszahlen zu können, der arbeitet genauso hart wie wir. Also Arschloch hoch!“