Wolfgang Walkensteiner hat das Wüstengold seiner Bilder aus den Farben Nickeltitangelb, Elfenbeinschwarz und dem Grün der böhmischen Erde gemischt. Alle Malereien, die hier zu sehen sind, basieren auf Eitempera-Technik, und Walkensteiner schafft, wenn er in Fahrt ist, gut und gerne ein kleineres Format an einem Tag.
Wie geht er dabei vor? Zunächst nimmt etwas Modellierton und formt mit den Händen einen etwa grapefruitgroßes Klumpen daraus. Dabei bohrt er lustvoll mit den Fingern in der Masse, dehnt und quetscht den Ton, rollt ihn zur Kugel, bearbeitet ihn wie Teig, usw.
Nach ein paar Tagen nimmt Walkensteiner die trocknete Form wieder zur Hand und schaut sich alle Details genau an. Findet er eine Stelle, die ihn anspricht, so überträgt er sie ins Riesenhafte gesteigert auf die Leinwand. Dabei geht der Künstler nicht stur realistisch vor; im Malakt können noch zusätzliche Durchbrüche oder Schatten auf das Objekt komponiert werden.
Wichtig ist, dass wir es hier nicht mit einem abstrakten Maler zu tun haben; stets gibt es ein kleines Modell für das Sujet im Vordergrund. Und es dürfte Sie kaum überraschen zu hören, dass Sammler diese Tonformen (auch als Bronzeguss) gerne zu den erworbenen Bildern dazukaufen.
Interpretationen sind bekanntlich immer mystagogisch: sie versprechen in ein Geheimnis einzuführen. Man könnte über Walkensteiner etwa sagen, er persifliere den christlichen Schöpfergott, doch er belege die erschaffenen Homunkuli nicht mit einer Strafandrohung, sondern nehme sie her, um etwas Ästhetisches zu schaffen. »Die Abbildung der Schöpfung als der eigentliche Generator des Schönen« … das wäre ein, einem Künstler absolut angemessener und würdiger Gedanke.
Aber so einfach geht das nicht! Betrachten wir noch einmal das Wechselspiel der Künste. Malerei erschafft stets einen Raum auf der Fläche, auf den Betrachter bezogen; sie bleibt unfassbar. Bildhauerei hingegen findet immer im Realraum statt, wir halten uns automatisch im selben Raum mit ihr auf; sie ist fassbar.
Die dreidimensionale plastische Figur hat über Jahrtausende das Verhältnis der Gesellschaft zum Körper thematisiert. Sie hat uns das Menschenbild einer jeden Epoche vorgeführt. Wenn das stimmt, dann sind wir heute allerdings ein einer sehr merkwürdigen Situation. Seit 1945 ist ja die figurative Plastik nahezu bedeutungslos; sie ist zu einem absoluten Minderheitenprogramm geworden – wie unvertonte Lyrik oder Schellak-Sammeln oder Diaprojektionen.
Das war im 19. Jahrhundert noch ganz anders. Ich bin ja ein passionierter Friedhofsgeher, und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich entdeckt habe, dass mich eigentlich nicht die Toten interessieren, sondern die architektonischen und bildhauerischen Lösungen der Grabmale.
Wo kann man denn heute noch gute Bildhauerarbeiten sehen? Eigentlich nur am Friedhof. Und wir da haben hier in Wien das besondere Glück, dass ab 1874 am Wiener Zentralfriedhof 200 Bildhauer beschäftigt waren, von denen 60 zugleich auch bei den Bauten der Wiener Ringstraße mitgewirkt haben.
Ist das nicht paradox, dass die berühmteste Statue der Welt, die New Yorker Freiheitsstatue von Frédéric-Auguste Bartholdi seit 1886 Jahren all das verspricht, was die westliche Zivilisation der Welt anzubieten hat, während gleichzeitig die Bildhauerei einen einzigartigen Wandel durchmacht?
Ich sage bewusst: einen Wandel, nicht einen Niedergang. Die Kunst von Skulptur und Plastik ist ja nicht eigentlich verschwunden, sie hat sich besonders in den letzten Jahrzehnten zum Kult am eigenen Körper transformiert. Früher einmal besaß man die Muse, den fremden Körper in Stein zu betrachten; heute scheint uns der eigene Körper im Spiegel im Weg zu stehen. Denken Sie bitte an die enorme Popularität, der sich heute Catwalk und Fashion erfreuen, an Cosplay, an Supermodell-Bewerbe, dann an die unmittelbaren Körpermoden von Tatoo über Piercing bis zur ästhetischen Zahnchirurgie oder an das Suchtphänomen der Plastoholics.
Wir haben es heute mit mächtigen Sport- und Medizinindustrien zu tun, die all ihr Geschick daransetzen, unsere Körper zu formen. Ich könnte Ihnen mühelos ein Dutzend Führungskräfte in unserem Land nennen – Politiker, Zeitungsherausgeber, Unternehmer –, die sich mit Hilfe von Laufsport und Fitnessstudio regelrechte Körperpanzer zugelegt haben. Man demonstriert heute durch Körperarbeit seinen gnadenlosen Opportunismus. Wir malträtieren uns und bringen unseren Leib dem Erfolg als Opfer dar.
Die aktuelle Kunst von Wolfgang Walkensteiner scheint mir in diesem Zusammenhang auf einen großen Erfahrungsverlust hinzuweisen. Warum halten wir den Anblick des fremden Körpers nicht mehr aus? Warum modellieren wir so verbissen am eigenen herum? Warum haben wir in wenigen Jahrzehnten die Bildhauerei, eine der ältesten Formen der Selbstwahrnehmung des Menschen, so rigoros abgewertet? Warum wurde aus einer Kultur des gelassenen Voyeurismus, bei der das autonome Individuum im Mittelpunkt stand, die kommerzielle Massenkultur eines aggressiven Exhibitionismus?
Ohne Frage müssen Künstler das moderne Diktat der Sichtbarkeit besonders schmerzhaft empfinden. Walkensteiner zeigt in seiner neuesten Serie das Körperliche oder Plastische auf zweierlei Arten: einmal als abgeschlossenes Objekt, das vor dem monochromen Hintergrund zu schweben scheint, und dann immer öfter auch in einem Ausschnitt – er zoomt unseren Blick quasi in das plastische Objekt hinein.
Dabei entsteht ein Effekt, der sich mit den persischen Medaillonsteppichen des 16. und 17. Jahrhunderts (Safaviden) vergleichen lässt. Auf solchen Geweben gibt es immer ein Mittelfeld mit Ranken, Blüten und Arabesken. Aber das Muster gliedert die Fläche nicht einfach, das Muster wird optisch angeschnitten. Das Fenster zeigt einen Ausschnitt aus einem unendlichen Rapport.
Diesen Fenstereffekt finden wir auch auf den Bilder in dieser Ausstellung. Auch bei Walkensteiner gibt es einen Körper für das Auge, und es gibt einen für das Auge unsichtbaren Körper. Es existiert gewissermaßen eine von der Darstellung unabhängige Plastizität – eine Plastizität als Vorstellung, als Körper an sich.
Beim persischen Teppich war die Botschaft klar: Der Orient sprach von unserer endlichen Existenz innerhalb eines unendlichen kosmischen Geschehens, das natürlich von Gott gelenkt wurde. – Walkensteiner zeigt die Idee des endlichen Körpers innerhalb eines kosmischen Geschehens, das er wohl das Sein nennen würde. Er zeigt eine flüchtige begrenzte Wirklichkeit mit offenen und mit verstopften Durchbrüchen auf die monochromatische Flächen.
Ich möchte mit einem Wort von Walkensteiners aktuellem Lektüreautor schließen, dass mir auf die Problemstellung dieser Arbeiten ganz gut zu passen scheint. »Das Tiefste«, hat Paul Valery einmal gesagt, »ist die Haut«.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! – Freuen Sie sich mit mir, dass wir hier einen Künstler unter uns haben, dem es mit spielerischer Sicherheit gelingt existenzielle Frage aufzuwerfen.
© Wolfgang Koch 2010
Rede in der BKS Bank Direktion Wien am 9. Juni 2010
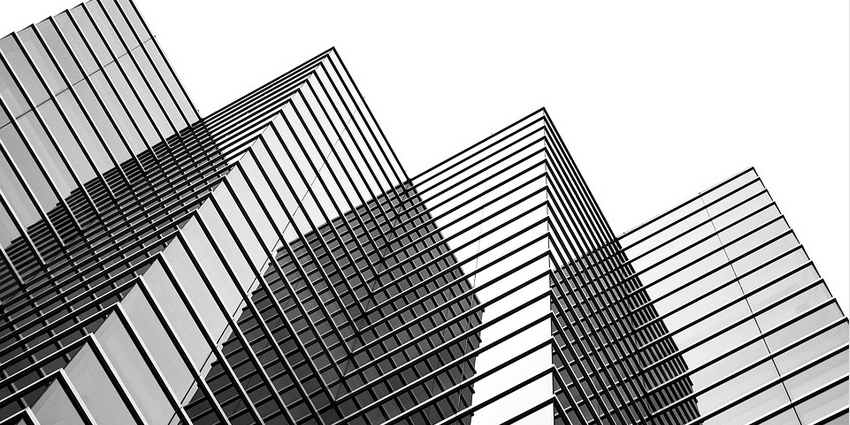



schön geschwätzt!&was sieht 1 hier davon?nüschte-isdette jut?……
Lesen lernen, der eigenen Vorstellungskraft vertrauen lernen…
W.K.