Das Gerücht über die erschossenen Tauben kann ich heute nicht bestätigen, aber es ist auch so sonnig und warum draußen, dass keine Taube freiwillig in die Messehallen fliegt (oder man schießt hier sehr schnell und leise). Drinnen ist es unsonnig wie immer. Die Cosplaykids haben sich umgezogen – und ich musste erst meine 10. Buchmesse erleben, um zu checken, dass die nicht jeden Tag dasselbe tragen (ich ja auch nicht). Sie sind jeden Tag jemand anders. Hab auf Twitter und Instagram den Hashtag #cosplaylineup gelesen, weil ich nicht einschlafen konnte, es ist alles viel ausgefuchster als ich dachte.
Mir ist etwas aufgefallen. Die Bücher in dieser Saison haben oft Titel mit nur einem Wort: Ellbogen. Rotlicht. Zink. Kraft. Fürsorge. Elefant. Zuhause. Kompass. Ist das ein Trend oder bilde ich mir das ein? Wenn ich zwanzig Jahre älter wäre, würde ich sagen, es ist wegen den Hashtags. Ein einzelnes Wort geht besser als Hashtag. Aber ich glaube, es wäre falsch. Vielleicht ist es einfach die Gegenbewegung zu „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“. Vielleicht haben die Leute ein Bedürfnis nach Einfachheit, oder sie haben Bock Manifeste zu schreiben, und Manifeste sollten keine Titel haben wie „Wie ich es voll kompliziert finde mit meinen verschiedenen Identitäten klarzukommen aber halt doch mein Bestes gebe, klappt leider nicht immer“.
Eines dieser Bücher mit Ein-Wort-Titel ist von Daniel Schreiber, „Zuhause“. Er stellt es nachmittags am taz-Stand vor und das ist schwierig, weil nebenan jemand schlimm Saxophon spielt. Gestern war es auf der Veranstaltung von Fatma Aydemir genau so schwierig, weil jemand daneben Gitarre gespielt hat, und ja hm, ich weiß nicht warum Leute auf der Buchmesse Musik machen, aber auf jeden Fall nervt es eigentlich immer. Ich verstehe eh schon nicht, wie man sich in diesen Hallen konzentrieren soll, wenn ständig Leute in einen reinlaufen. Manchmal klappt es für einen kurzen Moment.
„In Zeiten kollektiver Entwurzelung erleben wir immer eine neue Fokussierung auf Heimat“, sagt Daniel Schreiber, und das passiere oft mit Bildern von Idyllen, die es so nie gab. Mit Entwurzelung meint er zum Beispiel, dass viele Leute es für selbstverständlich halten, für ihre Arbeit umzuziehen. „Zuhause ist etwas, das wir uns immer wieder neu erarbeiten müssen“, sagt Daniel Schreiber, und das ist genau so halb-politisch und halb-persönlich wie seine Essays, in denen er danach fragt, was es mit uns macht, dass „Herkunft“ und „Zuhause“ oft nicht mehr dasselbe sind. „Ich wollte auch klar machen, dass Deutschland viel mehr ein Einwanderungsland ist, als viele denken“, sagt Daniel Schreiber, und: „Die Schaffung eines Zuhauses für Schwule und Lesben ist auch ein politischer Akt.“
„Heimat kann auch ne Melodie sein“, sagt dann entweder Daniel Schreiber oder der Moderator, ich weiß es nicht mehr, denn in diesem Moment fängt eine Frau an wie irre zu lachen, und da war im Vergleich das Saxophon noch ganz anständig.
Ich hatte, als ich von dem Buch gehört habe, ein bisschen befürchtet, dass es etwas wird, was das Thema „Zuhause“ auf eine Art idealisiert, die ich furchtbar finde, auf eine Art, die Rückzug als einzig wahre Richtung aufzeigt, auf eine Interior-Blogger-Art (sorry!!), auf diese Art, wo alles „hygge“ sein soll, was aber am Ende im Zweifel nur heißt, dass man mehr Kissen kaufen soll und heiße Schokolade trinken. Das Buch ist genau das Gegenteil davon. Das ist gut, und am Ende gehen wir kurz raus in die Sonne und reden und sind uns sehr einig. „Fuck hygge, oder?“ – „Ja, fuck hygge.“



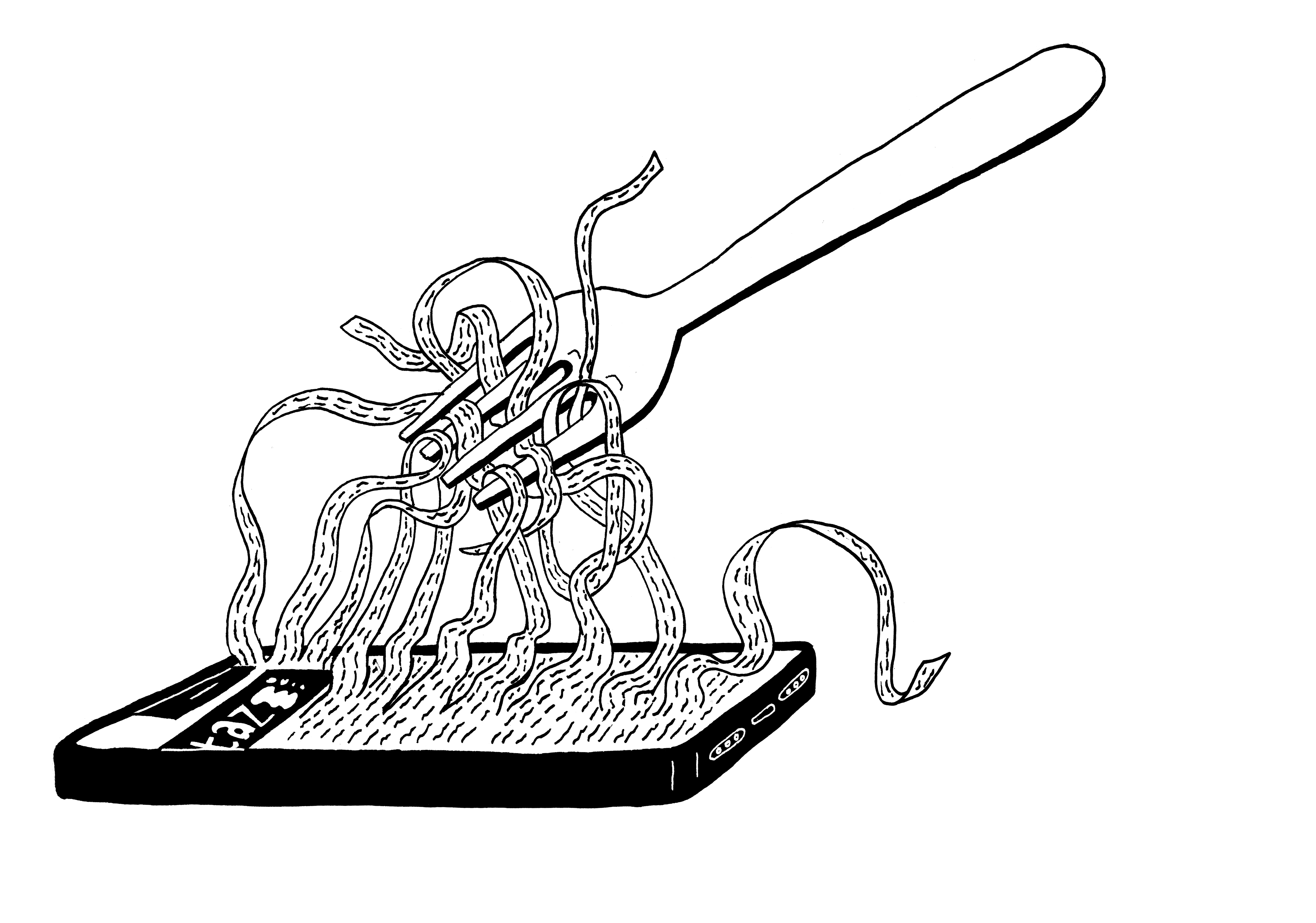
Erster Satz der Messenlehre: Die Länge der Buchtitel ist umgekehrt proportional zum Restalkohol.