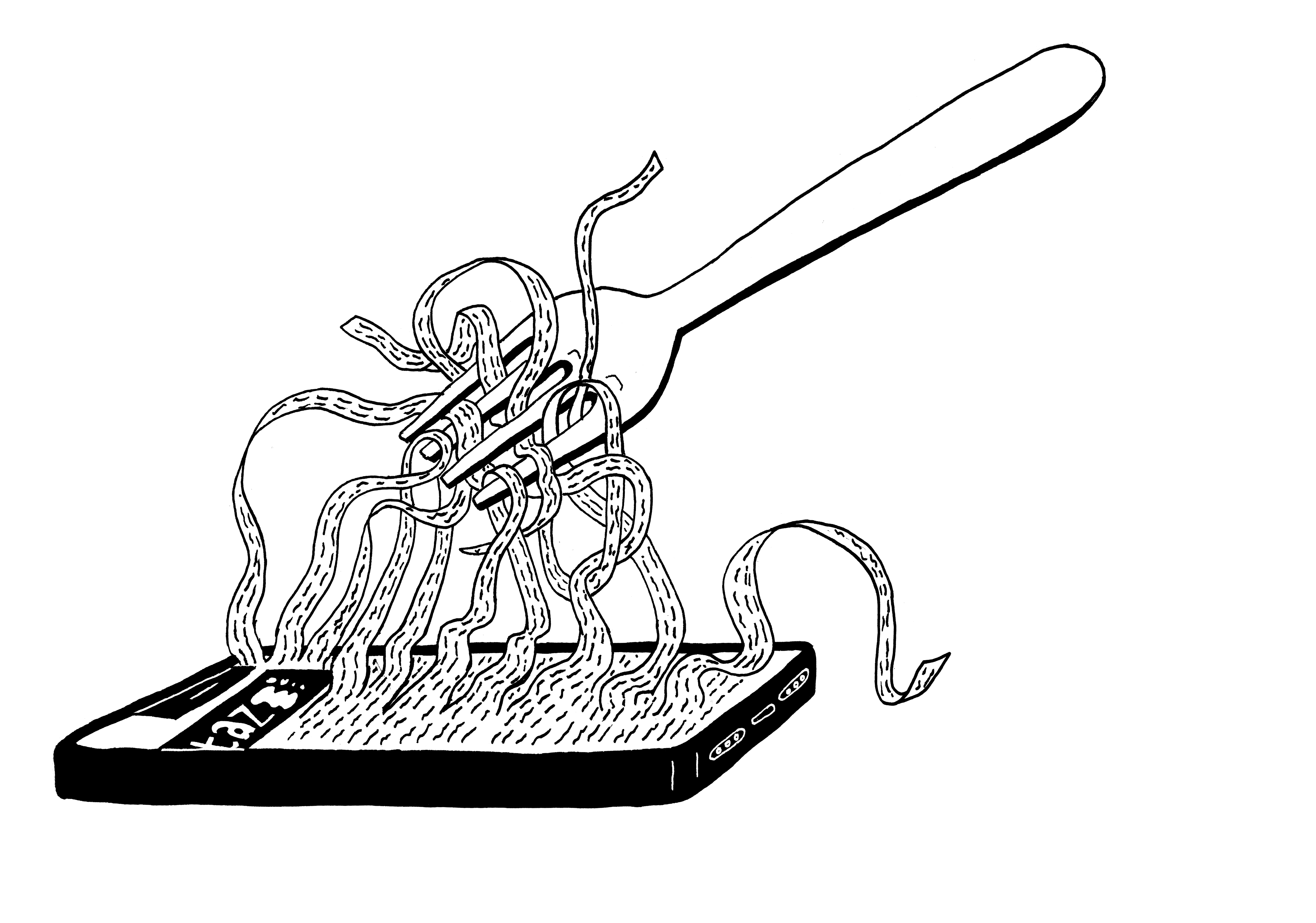Horst Seehofer surrt durch meine Timeline. Heimat hier, Islam dort. Stefanie Hertel ist an unserem Stand und gewollt ungewollt spricht sie genau über Horsts Themen. Moderatorin Peter Unfried stellt sie vor, was ich nur höflich und normal finde, schiebt dann aber gleich hinterher: „Stefanie Hertel vorzustellen, das ist wie Eulen nach Athen zu tragen.” Ich kenne das Sprichwort, habe es aber noch nie benutzt und wusste bisher nicht, was es bedeutet. Jetzt erschließt es sich mir. An dieser Stelle finde ich es jedoch nicht richtig, denn Mensch sollte jeden Gast vorstellen, und wenn es die Päpstin ist. Niemals irgendein Wissen beim Publikum voraussetzen, das ist meine Devise. Ich zum Beispiel dachte bis vor wenigen Minuten, dass wir eine hochkulturelle Autorin namens Stefanie Hertel eingeladen haben, die ich natürlich nicht kenne, weil ich unseren Kulturteil nie lese. Und als es dann tatsächlich die Stefanie Hertel ist, freue ich mich. Die kenne ich, meine Oma mag sie, und ich finde sie auch sympathisch.
Im Gespräch wird sie mir noch sympathischer. Sie ist Vegetarierin. „Volksmusik hat nichts mit Fleisch zu tun, ich singe ja nicht über die Fleischproduktion. Die Tiere liegen mir am Herzen.” Hach, Stefanie.
Dann geht es um Bayern und Heimat und Geflüchtete. Sie sagt: „Ausländer und Flüchtlinge müssen sich anpassen in Deutschland, sich in die Gesellschaft einfügen. Wenn sie hier keine Heimat finden, müssen sie wieder gehen. Denn ohne Heimat geht es doch nicht. Die, die sich einfügen, die müssen wir mit offenen Armen empfangen!” Ich verstehe ihre Haltung, sie will offen sein, weltoffen, tolerant, christlich. „Habe ich das Recht zu sagen: Deutschland gehört nur den Deutschen? Nein, habe ich nicht!”
Es sind klare Aussagen für eine Volksmusiksängerin, ich hoffe, diese Sätze kommen bei ihren Fans an.
Und doch denke ich: Nein. So ist es nicht. Niemand muss hier eine Heimat finden. Niemand muss dieses Land lieben. Niemand muss dankbar sein. Ich und jede Geflüchtete darf auf dieses Land schimpfen, wie sie will und wie ich will. Sich unwohl fühlen, heimatlos. Was ist denn mit all den Münchnerinnen in Berlin, die immer jammern, dass dort unten im Süden alles viel schöner sei, die Sonne wärmer, die Berge höher, das Bier leckerer, die Wiesn originaler, die Brezn knuspriger, das Lächeln ehrlicher, die Zähne weißer, die Wangen rosiger. Was ist mit denen? Die über Berlin motzen, es ist zu dreckig, zu laut, zu langsam, zu Stau, zu BER, zu unfertig, zu obdachlos, ins Berghain bin ich auch noch nie reingekommen? Die Berlinerinnen sind so unhöflich, nennen es Berliner Schnauze, ich nenne es rotzfrech, die haben keinen Anstand, die können nicht backen, die können nicht bauen, was können die eigentlich? Ich hab meinen Perlenohrring verloren, kannst du mal gucken, ob er bei dir in der Sofaritze liegt?
Die haben keine Heimat gefunden. Die fühlen sich unwohl. Die passen sich nicht an, die fügen sich nicht ein. So what? Das müssen wir als Gesellschaft aushalten. Die Liebe zum Mutterland steht nicht im Grundgesetz. Deniz Yücel durfte die Deutschen beschimpfen, wie er wollte – die Deutschen haben sich trotzdem dafür eingesetzt, dass er aus dem Gefängnis kommt. So einfach ist es.
Und was ist mit all den Nazis, die ihr eigenes Land nicht mehr erkennen? Die ihre Töchter nicht mehr auf die Straße lassen, weil sofort ein Nafri kommt und sie angrapscht? Die die Schilder der Geschäfte nicht mehr lesen können, weil vielleicht auf Englisch oder Türkisch geschrieben? Die sich unwohl fühlen, weil die Muezzinin ruft, weil Frauen mit Kopftuch ganz frei auf der Straße rumlaufen, weil kleine Jungs „wallah” rufen? Die erkennen ihre schöne Heimat nicht mehr, die fühlen sich nicht mehr heimisch. Raus mit denen? Nein, leider nicht. Auch die müssen wir aushalten.
Dann begibt sich Stefanie wieder auf ebeneres Terrain, spricht von ihrer Oma, die immer so viel Haarspray benutzt hat und ganz toll gekocht. Und da werde ich innerlich weich, denke an meine Oma, die aus Franken kommt, und die Fränkinnen bezeichnen sich nicht als Bayerinnen, die wollen anders sein, und doch gehören sie zu Deutschland, und diese Oma, die benutzt auch immer wahnsinnig viel Haarspray. Auch immer Taft, so wie Stefanies Oma. Sie geht einmal in der Woche zum Friseur, der wäscht ihr die Haare und rollt sie ein. Danach hat sie eine Queen Mum-Frisur auf dem Kopf, die dank Taft eine Woche lang hält. Und wenn der Wind die Haare zerzaust, dann sagt sie mit rollendem R: „Der Oma ihr Hoaaar, des is heut‘ furrrrchboaaaar.“