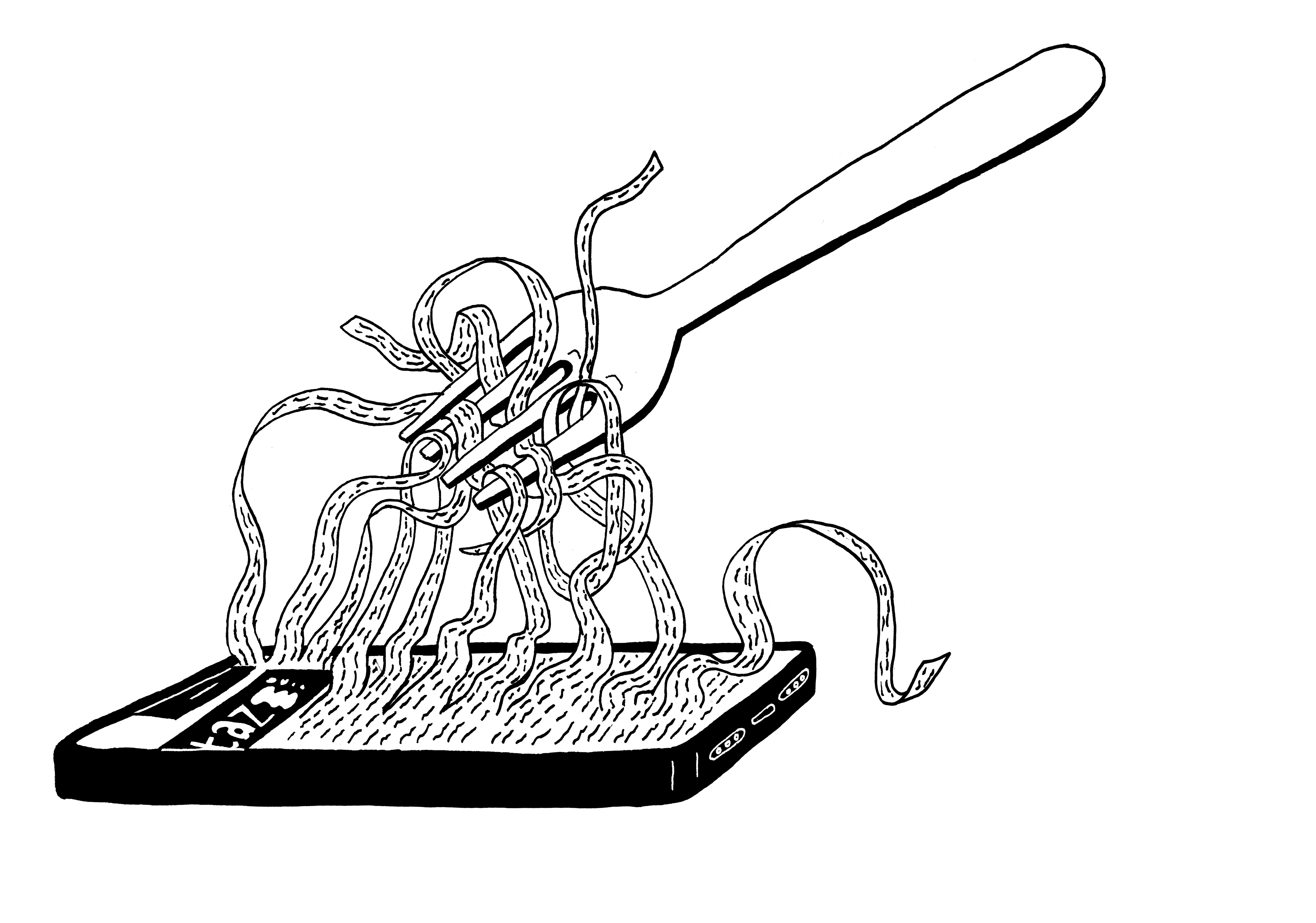„Wenn die beiden da nicht wären, die Ndrangheta hätte mich schon längst ausgeschaltet.“ Es war einer von vielen starken Momenten bei der taz-Veranstaltung „Mafia, Staat, Zivilgesellschaft“ am vergangenen Mittwoch, als Claudio La Camera das sagte. Er meinte damit Staatsanwalt Michele Prestipino und seinen Polizeichef Renato Cortese, die es ihm und dem Team des „Museums der Ndrangheta“ ermöglichen, der mafiösen Duchdringung der Gesellschaft kulturell etwas entgegenzusetzen.
Prestipino eröffnete den Abend. Und wer hätte besser als der Staatsanwalt, dem der legendäre Boss der sizilianischen Cosa Nostra ins Netz ging, darlegen können, wie sehr viel tiefer verwurzelt die Ndrangheta in der kalabresischen Gesellschaft ist als die Mafia auf der Insel. Gerade deswegen seien Initiativen wie die La Cameras entscheidend. Was die Umsätze des Syndikats angeht, hielt sich Prestipino zurück. In italienischen Medien würde oft mit Zahlen um sich geworfen, die in seinen Ermittlungsakten keine Bestätigung fänden – er wisse nur, wieviel seine Leute beschlagnahmten.

Renato Cortese schilderte, wie das Leben des Einzelnen in der Provinzhauptstadt Reggio bis ins Detail bestimt sei von der Organisierten Kriminalität: Selbst wer nur sein Haus neu streichen wolle, müsse sich an die Bosse wenden – sie entscheiden, welcher Maler zu welchem Preis den Auftrag übernehmen darf.

Hier ist ein Grundstein gelegt worden für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Initiativen, die sich in so unterschiedlichen Realitäten wie Kalabrien und Ostdeutschland bewegen. Auf anderen Feldern gibt es diese Zusammenarbeit schon: Am Nachmittag waren die Gäste aus Italien bei Bernd Finger eingeladen. Finger ist Leiter der Abteilung Organisierte Kriminalität beim Landeskriminalamt Berlin und hat zusammen mit der italienischen Palamentsabgeordneten Laura Garavini den Anstoß zur Gründung von „Mafia? Nein, danke“ gegeben – einer Initiative gegen Schutzgelderpressung und andere mafiöse Aktivitäten.
Von Ambros Waibel, Meinungsredakteur der taz