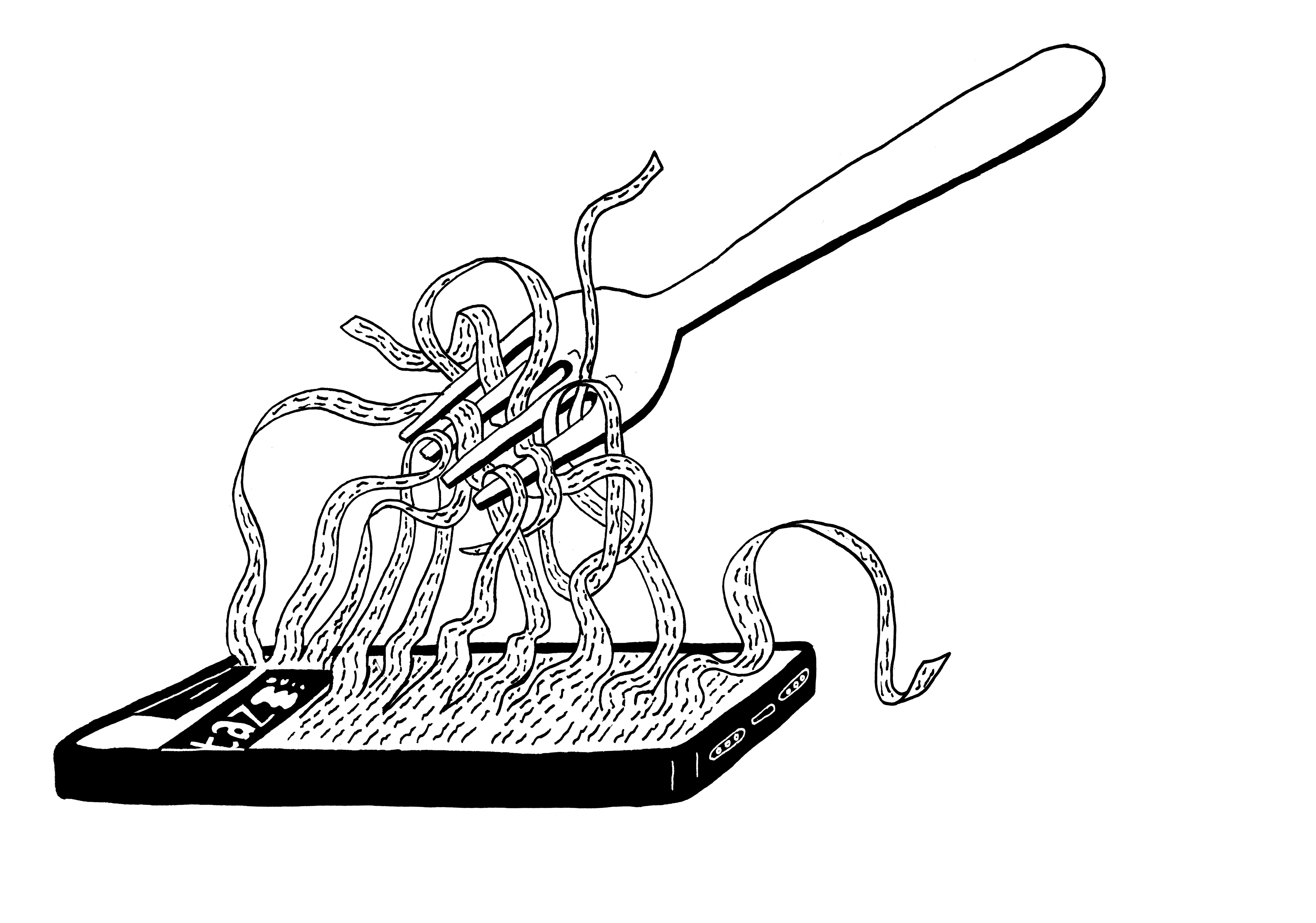_
17. Februar: James, please stay with us
Barbara Hammer tot, Frederick Wiseman tot, zum Glück lebt James Benning noch. Sonst verfiele das US-Doku- & Avantgarde-Kino auf der Berlinale vollends der intellektuellen Langeweile, narrativen Mittelmäßigkeit & formalen Provinzialität.
16. Februar: Gestörte Totenruhe
Um es kurz zu machen (denn mehr kann mensch hier einfach nicht sagen): Barbara Hammer hat diesen kitschigen und konventionellen Mist, der Brydie O’Connors dokumentarisches Memorial-Stück BARBARA FOREVER ist, in keiner Weise nicht verdient.

Ich verstehe, warum das Berlinale-Forum diesen Kram programmieren musste, aber es ist weder Barbara Hammer noch der Sektion in irgendeiner Form würdig.
16. Februar: Arschloch-Faktor Made in USA
Es ist schon erstaunlich, mit welcher Chuzpe sich US-amerikanische Filmemacher:innen im Jahr 2026 vor ein Berlinale-Publikum stellen und mit dem Brustton der Überzeugung und reichlich übersteuertem Sendungsbewusstsein die Palästina-Solidaritäts-Schlager runterdudeln, während sie zugleich mit ihren Steuergeldern – wie keine Nation sonst auf der Welt (nicht mal Deutschland) – Netanjahus Kriegsmaschine finanzieren. Und einen von Bibis größten Fans und Nachahmern nicht nur numerisch, sondern per Popular Vote(!) ins Weiße Haus befördert haben. Vom geradezu ungebremsten Import israelischer „Siedler“-Produkte gar nicht erst zu reden.
Natürlich, in den USA ist alles mindestens eine Nummer größer als anderswo, das gilt offenkundig auch für den Arschloch-Faktor.
Aber vielleicht ist es Zeit, dass „die Amis“ zur Abwechslung mal etwas vom ultimativen Tätervolk, den Deutschen, lernen, nämlich wann man einfach nur die Fresse zu halten hat? Weil man mehr als jede Nation, jedes Volk sonst, Komplize ist in diesem grausamen Todesreigen in Nahost.
Eingedenk Tricia Tuttles jüngsten Statements sind manche Filmemacher:innen vielleicht besser damit beraten, wirklich ausschließlich ihre Filme sprechen zu lassen.
15. Februar: We need to talk about … cancer
You have become so emotional unavail …, aber weiter kommt Ivys Mutter nicht mehr mit ihrem Satz. Ivy hat den Essenstisch bereits türenschlagend verlassen.
Schottland irgendwann im Heute. Ivy ist 17 und seit zehn Monaten in Remission von eine Leukemie-Erkrankung. Ihre Eltern sind besorgt, denn Ivy hat sich seit der Erkrankung abgekapselt von der Welt. Ihre Idee Ivy wieder ins Leben zurück zu bekommen: Ein Sommercamp für von Krebs belastete Jugendliche. SUNNY DANCER.
Ivy ist überhaupt nicht begeistert von diesem Vorschlag. Überhaupt ist sie von wenig zu begeistern und die meiste Zeit vor allem eines: anti. Ein störrischer Teenager auf der Schwelle zur Erwachsenen, aber eben gesundheitsbedingt mit jeder Menge Gepäck, dass das Bild des wütenden Teenagers deutlich anders konnotiert. Was Ivy selbst aber auch nocht nicht verstehen will.
Wut und Ablehnung
Wo Ivys Mutter nicht weiterkommt gelingt es dem Vater, seine Tochter zu überreden. Widerwillig lässt sie sich auf die Fahrt zum Camp ein. SUNNY DANCER in der Regie und geschrieben von George Jaques ist das, was man im Filmgenre-Alphabet eine Coming-of-Age-Geschichte nennt. Junger Mensch an der Schwelle zum Erwachsensein muss Hürden überwinden, um sich dabei bzw. dadurch selbst neu zu entdecken und zu erfinden. Der Weg ist steinig, das Ende klar: Ein verändertes, ein neues Selbst.
Ivys altes Selbst hat jede Menge Wut und viel Ablehnung im Bauch. An jeder Ecke wittert sie Peinlichkeiten und Gesichtsverlust, allen voran verursacht durch ihre Mutter. Und dieses Krebskindercamp riecht ihr sehr stark nach einer Freak-Show. Da steht sie drüber. Selbstverständlich. Trotzdem bleibt sie. Erstmal.
„SUNNY DANCER durchzieht dabei ein verblüffender, fast musikalischer Rythmus aus hellen und dunklen Momenten und Gefühlen. Ein Rhythmus, der sein Publikum einlädt, sich anzuschließen“
Coming-of-Age meets Krebs-Drama. George Jaques weiß genau, welche Klischees und Vorurteile seine Geschichte in sich birgt, kennt das Cringe-Potenzial und die Fallstricke des Genres und darüber hianus. Und er spielt damit, er vermeidet sie nicht, er inkorporiert sie. Und bricht sie mit erstaunlicher Präzision im richtigen Moment.
Volles Tempo. Keine Kompromisse
SUNNY DANCER durchzieht dabei ein verblüffender, fast musikalischer Rythmus aus hellen und dunklen Momenten und Gefühlen. Ein Rhythmus, der sein Publikum einlädt, sich anzuschließen, quasi emotional mitzuntanzen, mitzufühlen, mitzuleiden, mitzulachen, mitzulieben. Klug, aufrichtig, ehrlich.
Ivy trifft im Camp auf eine Clique anderer Jugendlicher, die schon öfter dort Zeit verbracht haben. Und wie wir schnell lernen ist das eine Gruppe, der längst auch der Ruf von Unagepasstheit und Chaos nachhängt. Ivy bleibt auf Abstand. Macht zunächst weiter wie bisher, is(s)t für sich allein. Doch diese Clique gibt keine Ruhe. Halb widerwillig, halb freiwillig schließt sie sich ihnen an. Denn eigentlich ist Ivy eine von ihnen. Volles Tempo. Keine Kompromisse.

Der Cast um Bella Ramyes und ihre Ivy verpasst dieser Gruppe eine faszinierende Lebendigkeit. Sie entwickeln eine Präsenz in ihren Figuren die vollständig im Moment steht und eine ungemein fesselnde Energie erzeugt. Diese Gruppe lebt. Da ist Chemie, da ist Subtext, diese Figuren sind mehr als ihre Funktion in der Story. Sie sind Menschen und man ist irgendwann einfach verdammt gerne mit ihnen zusammen in diesem Film.
Dunkelheit
Filmemacher George Jaques und sein Cast arbeiten hier natürlich tief im Genre, Coming-of-Age ohne Identifikationsfiguren gibt es nicht – aber hier ist auch ein Mut unterwegs, dem Publikum zuzumuten dorthin zu gehen, wo Coming-of-Age-Filme am Ende nicht unbedingt hinwollen. In die Dunkelheit.
„Chemo-Freaks“ – so werden Ivy und ihre Freundinnen auf der Dorfkirmes beschimpft, bevor es zur Prügelei kommt. Für die anderen Jugendlichen sind sie Aliens, markiert durch Krankheit. Im Camp dagegen ist Krebs keine Nachricht. Dort sind sie einfach Ivy, Jake, Ella, Ralph, Maisie und Archie. Und sie verbringen einen Sommer zusammen. Keiner muss sich erklären, keiner ist Alien. Zentraler ist die Frage, wann frau hier endlich jemanden zum Ficken findet? Das Leben ist schließlich kurz – jedenfall kann es sehr schnell sehr kurz werden.
SUNNY DANCER endet mutig und brutal. Der Film fordert einen hohen Preis. Von seinen Figuren. Vom Publikum. Krebs lässt sich nicht dauerhaft ausblenden, selbst im schönsten Sommer nicht. Und der Schmerz, den der Film transportiert, ist roh, echt, unausweichlich. Er verfolgt einen. Noch Tage später. Radikales Gefühlskino. Wahnsinn.
SUNNY DANCER, George Jaques, 106′, Vereinigtes Königreich 2026, Generation 14
14. Februar: 110 Minuten Werbepause
Würde man fragen, was dieser Film wirklich ist – eine dokumentarische Arbeit, ein Porträt, eine Annäherung – dann wäre die Antwort: Werbung. SIRI HUSTVEDT – DANCE AROUND THE SELF.
Dies ist ein Werbefilm von, mit, über, für Siri Hustvedt. Und Paul Auster, ihren verstorbenen Ehemann. Das sieht gut aus, so wie Werbung eben sein sollte. Das guckt man gerne an, auch wenn es weit mehr Zeit beansprucht, als nötig. Und man hört Hustvedt gerne zu, wenn sie sich als unmissverständliche Feministin und feministische Autorin verortet. Immer wieder angestupst von wohlwollenden Stichwortgeberinnen aus dem Freundes- und Familienkreis.

Doch es ist ebenso auch schrecklich banal. Es ist eine kaffeetischmagazinige, die Tiefe nur simulierende Untiefe, die diese Arbeit durchzieht. Der Film will echt und reich an Bedeutsamkeit sein. Aber er ist: egal.
Haufenweise Themen
Siri Hustvedt wird von einer Vergewaltigung im Haus ihrer ersten New Yorker Wohnung zu ihrem Text inspiriert – es ist: egal. Sie hat hysterische Anfälle und beginnt, den Ursachen und der Geschichte der (patriarchalen) Behandlung von Hysterie nachzuforschen – es ist: egal. Paul Auster, ihr Ehemann für über 40 Jahre, stirbt an Krebs – es ist: egal. Sie forscht mit Wim Wenders in Nordnorwegen über die Hexenverfolgung – es ist: egal.
Haufenweise schwere Themen stapeln sich in dieser Arbeit. Alle sind sie egal und werden mit geradezu mechanischer Präzision aneinandergenietet, ohne irgendwelche Resonanz ermöglichen zu können. Alles Oberfläche, besondere Hochwertigkeit insinuierende Ausstattungsmerkmale des Produkts Siri Hustvedt.
Aber wer diese verdammt perfekte Siri Hustvedt eigentlich ist? Wir haben 110 Minuten in diesem Film verbracht und sind keinen Millimeter weiter. Was für eine Zeitverschwendung.
14. Februar: Am Zaun scheitern
Man kann Anat Even und ihrer dokumentarischen Arbeit EFFONDREMENT kaum vorwerfen, es nicht zu versuchen. In ständiger Pendelbewegung zwischen dem, was vom Kibbuz Nir Oz übrig ist und der militärischen Sperrzone, die Gaza heißt, versucht sie näher an das heranzukommen, was hinter „dem Zaun“ passiert. Tatsächlich. Und weit darüber hinaus.

Sie verfolgt Panzer, schleicht sich heimlich auf Aussichtsposten, durchstreift das zerstörte Nir Oz, das einst auch ihr Ort war und wo heute IDF-Soldaten für den Einsatz üben. Auf der Tonspur stetiger Kriegslärm und ein Freund in Paris, der ihr im schwer pathetischen Grundton mit den Greatest Hits der globalen Anti-Israel-Bewegung das Ohr abkaut, wo sie eigentlich Halt und Sinn sucht im Wahnsinn der Realität.
Aber zwischen dmm pro-palästinensischen Totenkult ihres Diaspora-Freunds, dem Vogelzwitschern im abgebrannten Nir Oz und dem Dauerdröhnen der israelischen Kriegsmaschine bleibt der Erkenntnisgewinn am Ende dann vor allem eines: dünn.
13. Februar 2026: Erinnerungen sind ein mieser Verräter
Was führt dich an diesen gottverlassenen Ort, fragt der Bootsführer den Mann und einzigen Passagier in seinem kleinen Segelboot. Das ist meine Heimat, antwortet Hein. DER HEIMATLOSE.
Diese Heimat ist eine namenlose Insel im Meer (laut Abspann Drehort Norderney), das Festland außer Sicht. Eine kleine Dorfgemeinschaft lebt hier, alle kennen alle – außer diesen Neuankömmling. Der behauptet, einer von ihnen zu sein: Hein bzw. Heinrich.
Vor 14 Jahren hätte er die Insel verlassen, um nun zurückzukehren. Von einem freudigen Empfang kann indes keine Rede sein, niemand will ihn wiedererkennen. Nicht seine Schwester, nicht seine Mutter. Aber die ist dement und nimmt ihn als „Hein“ wahr, nicht als ihren Sohn.
Tückische Zeugen
Der vorgebliche Hein rührt die Gemeinschaft auf, rasch wird eine Versammlung einberufen und entschieden, zu Heins Missfallen, dass ein Dorfgericht darüber richten soll, ob Hein wirklich Hein ist. An drei Gerichtstagen hat er die Chance, durch seine und die Erinnerung der Anderen Beweis darüber zu führen, dass er kein Schwindler ist. Doch Jahrzehnte alte Erinnerungen sind tückische Zeugen. Nicht allein in ihrer Anfälligkeit für die Lüge.

DER HEIMATLOSE ist einer jener seltenen deutschen Filme, die innerhalb des Filmfördersystems existieren (Co-Produktion u.a. ZDF-Kleines Fernsehspiel) und sich dessen Triebkräfte der narrativen und formalen Normierung/Langeweile zu erwehren verstehen.
Mit 122 Minuten lässt sich Filmemacher und Drehbuchautor Kai Stänicke Zeit, seine Geschichte auszubreiten. Es ist ein störrisches Erzählen, ein Erzählen mit wenig Intention für eine einfache Zugänglichkeit. Wer etwa sind diese Figuren? Wie alt sind sie, wer gehört zu wem, wer heißt eigentlich wie? Es gibt nur Vornamen. Greta, Heide, Hein – Friedemann.
Rohes Bild
Andere Anker fehlen ebenso: zeitliche Zuordbarkeit, Jahreszahlen, Bücher, irgendetwas. Sprache, Werkzeuge und Kostüme liefern Indizien für eine Zeit vor der großen Industrialisierung, weit vor der Wende zum 20. Jahrhundert.
Der deutlichste Bruch mit filmischen Konventionen zeigt sich bei den Settings, wie eine Vogelperspektive (eine von vielen) gleich zu Beginn verdeutlicht: Das Dorf ist nur in vordergründigen Kulissen aufgebaut, hinter jeder Fassade blankes Holz und minimalstes Interieur – danach folgt schon die Dünenlandschaft. Keine Dächer, keine weiteren Wände, keine Hintergründe. Rohes Bild. Tag und Nacht.
DER HEIMATLOSE ist eine frappierende Kreuzung aus filmischer und theatraler Form. In seiner Wirkung aufs Publikum kompromisslos: Entweder man folgt diesem Szenario fasziniert, oder man steigt sehr rasch aus. Beides sind valide Optionen.
Risse in der Wand
Dranzubleiben bedeutet, sich von einem unterschwelligen Suspense anstecken zu lassen. Kai Stänicke verweigert uns für die längere Zeit des Films eine klare Erkennbarkeit dessen, was diese Story wirklich ist und wohin sie führen wird. Die Verhandlungstage nehmen ihren Lauf und nähren eher den Zweifel einer großen Lüge. Gleichzeitig drängen, wie kleine Risse in der Wand, (Erinnerungs-)Fetzen dessen durch, was genauso gut auch die Widerlegung aller Zweifel sein könnte. Es ist ein spannendes Spiel mit Erwartungshaltungen, Vermutungen – und Vorverurteilungen.

Diese Risse in der Wand legen noch etwas anderes frei: Hier geht es nicht allein darum, ob Hein wirklich Hein ist. Hier treffen drei Menschen aufeinander, die vor 14 Jahren mehr geteilt haben könnten als das bloße Zusammenleben junger Menschen in einem Fischerdorf. Hein – Greta – Friedemann. Allein, Friedemann tut viel dafür, sich daran nicht erinnern zu können. Und das macht Hein rasend.
Wenn die Wahrheit ein Happy End sein kann, dann hat DER HEIMATLOSE zweifelsohne ein Happy End. Aber es ist bereinigt von jeglicher Illusion. Und durchdrungen von einer bitteren Erkenntnis: „Wenn man nicht der sein kann, der man ist, muss man gehen.“
Was für eine bestechende Arbeit.
DER HEIMATLOSE, Kai Stänicke, 122′, DE 2026, Perspectives
13.Februar 2026: Gewerbegebietszombie
Liebe Tricia Tuttle, erlauben Sie bitte einen Vorschlag:
Behalten sie das Cinema Paris im Katalog der Berlinale-Kinos, buchen sie den Filmpalast und das Delphi Lux hinzu, ziehen sie Pressezentrum, Berlinale HUB und Servicecenter ebenfalls zur City-West um – und ersparen sie dem Festival endlich diesen Gewerbegebietszombie namens Potsdamer Platz.
Danke.
12. Februar 2026: Feministische Außenpolitik
„Es gibt keine guten Männer in Afghanistan“, sagt Naru zu ihren Kolleginnen. Kabul wenige Monate vor der erneuten Machtergreifung der Taliban und damit dem Zusammenbruch des vom Westen am Leben erhaltenen Systems einer irgendwie gearteten Form von Demokratie.
Naru, dunkle, mittellange Haare, ein bunt gemustertes Kopftuch sehr locker um den Kopf geschwungen, Jeansjacke, fährt mit ihrem kleinen Sohn zur Arbeit. Sie ist Kamerafrau bei Kabul TV. Der Weg zum Studio ist von Checkpoints und Sicherheitskontrollen gesäumt, kurz dahinter, im Erdgeschoss, der Betriebskindergarten. Sie gibt ihren kleinen Sohn ab und der Job beginnt.
Ihre Aufgabe, eine Call-in-Sendung im Frauenprogramm zu filmen, vor ihr die kräftig geschminkte Moderatorin und ein schmieriger Experte vor einem Greenscreen. Auf der Tonspur eine verzweifelte Anruferin, die von schwerer körperlicher Gewalt durch ihren Ehemann berichtet. Die Moderatorin richtet das Wort an den Experten, dessen Rat: Besser schminken. Willkommen bei NO GOOD MEN von Shahrbanoo Sadat.
Valentinstag
Naru, von der Filmemacherin selbst gespielt, hat genug von der Sendung, sie will einen anderen Auftrag, drängt ihren Chef, bis der ihr widerwillig ein Interview mit einem der älteren Redakteure zuweist: Qodrat. Was Naru zu diesem Moment noch nicht weiß: Der Interviewpartner, zu dem die beiden fahren, ist eine lokale Taliban-Größe. Sie bemerkt es erst, als der wutentbrannt aus dem Interview stürmt, weil das sowieso schon nur sehr leichte Kopftuch auf ihre Schulter runterrutscht.
„Jenes Land, das vor nicht allzu langer Zeit noch versuchte, die Idee einer feministischen Außenpolitik mit Leben zu füllen, ist an Afghanistan nur noch dann interessiert, wenn es Menschen abschieben kann“
Qodrat reagiert verärgert und setzt sie auf dem Rückweg zur Redaktion samt Kamera auf der Straße aus. Zur Strafe soll sie eine Umfrage zum Valentinstag machen. In den folgenden Minuten erleben wir, wie Naru sich redlich bemüht, Männer vor die Kamera zu kriegen und sie zum Valentinstag zu befragen, erfolglos. Mit den Frauen hat sie mehr Glück. Schnitt.
Um die Situation der Frauen in Afghanistan heute noch zu beschreiben, fehlen längst die Worte. Zu total, zu widerlich ist das Vorgehen der Taliban. Und jenes Land, das vor nicht allzu langer Zeit noch versuchte, die Idee einer feministischen Außenpolitik mit Leben zu füllen, ist an Afghanistan nur noch dann interessiert, wenn es Menschen abschieben kann. Frauen? Von Merz, Wadepfuhl, Dobrindt und Co. muss nicht erwartet werden, dass sie ihre Ämter nutzen werden, um dem Leid irgendetwas entgegenzusetzen.
Americas longest war
Die große Weltpolitik findet in NO GOOD MEN sowieso nur in einem einzigen Moment statt, wenn die Fernsehbilder Joe Bidens Ansprache zeigen, die den Rückzug der USA aus Afghanistan verkündet. „It’s time to end America’s longest war.“
Naru nimmt Joe Biden zur Kenntnis.
Ob es ihr egal ist oder ob sie nicht sehen will, was dies bedeutet – Shahrbanoo Sadat lässt ihre Figur hier in einer spannenden Ambivalenz. Eine Ambivalenz, die auf eine Realität jenseits von Weltmachtspielen weist: Für Afghanistans Frauen ist seit Ewigkeiten jeden Tag Krieg, und die Anwesenheit des Westens hatte allenfalls theoretische Verbesserungen gebracht.
Wie funktioniert Hoffnung unter solchen Umständen? Ist das überhaupt eine realistische Kategorie? Shahrbanoo Sadat versucht zumindest eine Skizze dessen, was Hoffnung für Afghanistans Frauen hätte sein können, und Naru ist dabei die zentrale Figur.
Sie ist alleinerziehende Mutter, in Trennung lebend. Sie beißt sich im Job durch, erarbeitet sich ihre Position, wagt sogar eine Art Romanze mit ihrem deutlich älteren Kollegen Qodrat. Und sie konfrontiert Wachmänner, wenn diese sie und ihre Taschen nicht durchsuchen, aber die ihrer männlichen Kollegen schon.
Respekt und Gleichbehandlung
Das ist keine „aufmüpfige Frau“, es ist eine Bürgerin, die fest daran glauben will und dafür streitet, dass sich die afghanische Gesellschaft in eine bessere Zukunft entwickeln könnte. Die den dauersuizidalen Zustand chronischer Verantwortungslosigkeit genauso wenig akzeptieren mag wie die Tatsache, von Männern bestenfalls Ignoranz spüren zu bekommen.
Naru ist eine Frau, die sich herausnehmen muss, was jeder Frau automatisch zustehen – sollte: Sie will gesehen werden, sie will Respekt und Gleichbehandlung. Die hierfür zugrundeliegende Szene mit den Wachmännern ist in diesem Land ein alltäglicher Moment, an dem sich doch das ganze Elend Afghanistans exemplarisch spiegelt. Wenn man Sicherheit vernachlässigt und Frauen nicht mal zugestehen will, Selbstmordattentäterinnen sein zu können.
25 Jahre später
NO GOOD MEN endet bitter. Für ein Happy End ist hier kein Platz. Wie auch? Die Welt hat beschlossen, vor Afghanistan die Augen zu verschließen und allen voran vor dem Schicksal der Frauen. Für sie ist Ausweglosigkeit, Stand heute, der einzige Ausweg.
Shahrbanoo Sadat setzt dem in ihrer Arbeit eine filmische Vision von Hoffnung entgegen. Aber eben, das ist nur Kino. Derweil, genauer, vor 25 Jahren, hat der Westen schon einmal einen unsagbar schmerzhaften Preis dafür bezahlt, Afghanistan vergessen zu wollen.
NO GOOD MEN, Shahrbanoo Sadat, 103′, DE/FR/NO/DK/AF 2026, Berlinale Eröffnungsfilm 2026