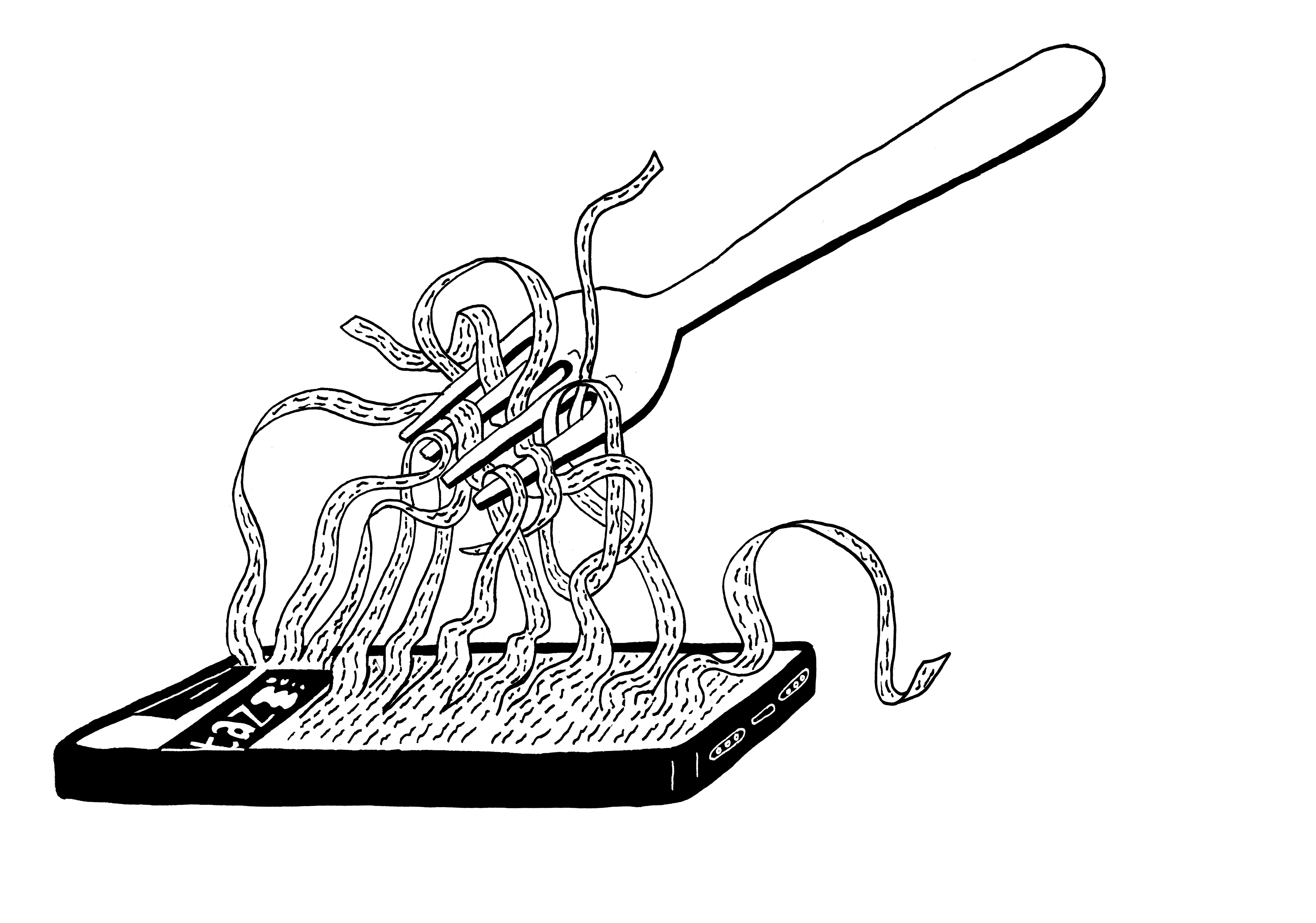Maykäfer, flieg!
Der Vater ist im Krieg,
Die Mutter ist im Pommerland,
Und Pommerland ist abgebrannt.
(dt. Kinderlied aus »Des Knaben Wunderhorn«)
VORBEMERKUNG
Im Sommer 1989 hat meine Großmutter Klara Heinke nach über 40 Jahren Schweigen ihre Erinnerungen an die zunächst gescheiterte Flucht mit ihren Kindern aus Pommern Anfang 1945, die Rückkehr in ihren erst russisch, dann polnisch besetzten Heimatort Rummelsburg (heute: Miastko) und schließlich an die Ausreise nach Schleswig-Holstein im Sommer 1946 aufgeschrieben.
Ich habe den Text nicht gekürzt und nur an wenigen Stellen leicht verändert bzw. ergänzt. Der neutrale Leser mag dem Bericht vorhalten, dass er einseitig eine Opferperspektive einnimmt und nicht auf die Vorgeschichte und Ursachen dieser Katastrophe eingeht. Zu diesem berechtigtem Einwand möchte ich anmerken:
Der Ehemann meiner Großmutter und Vater ihrer drei Kinder war Soldat bei der SS und kurz vor den geschilderten Ereignissen gefallen.
Dieser für meine Großmutter fraglos große Verlust (sie hatte nie wieder eine ernsthafte Beziehung) wird in dem Bericht ebenfalls weder erwähnt noch beklagt. Beschrieben wird dagegen der Kampf einer Mutter um das nackte Überleben, um das Leben ihrer Kinder, d.h. auch um das Leben meiner Mutter. Wie jede wahre Geschichte ist die hier erzählte also ganz und gar einmalig. Und doch haben Millionen von Menschen ähnliches erlebt.
Anders als ihre Kinder hat meine Großmutter niemals wieder ihre alte Heimat besucht. Sie hat bis zu ihrem Tod in der holsteinischen Kleinstadt Kellinghusen gewohnt. Dort hat meine Mutter meinen Vater, einen gebürtigen Holsteiner, kennengelernt. Dort wurde ich geboren.
KLARA HEINKE — LEBENSGESCHICHTE (AUFGESCHRIEBEN FÜR DIE NACHWELT) – Teil 2
…
Vom Schlachthof bekamen wir öfter Fleisch; ich weiß, ich habe mal 100 Bratklopse gebraten, aus Rindfleisch, die waren hart wie ein Stein, aber uns haben sie geschmeckt. Außerdem wurde Kuheuter abgekocht, in Scheiben geschnitten und gebraten, alles in Rinderfett. Mein Vater hat dann die Klopse an bekannte Familien verteilt.
Eines Tages war unser Haus in der Bahnhofstraße 2 voller russischer Offiziere, wir mussten alle raus. Ich ging zur Kommandantur, und da bekam ich zwei deutsche Gefangene als Hilfe für den Umzug, dazu natürlich ein russischer Soldat als Bewachung. Wir konnten den deutschen Soldaten noch etwas anzuziehen geben, aus unserer »Fundgrube«.
Das Haus ging also in russischen Besitz über. Wir zogen in die Mühlenstraße zu Schneidermeister Teifke. Das Ehepaar wohnte dort, war auch zurückgekehrt. So langsam sah man wieder Rummelsburger.
Wir hatten eine 5-Zimmerwohnung, unter uns war die polnische Miliz. Da bekam erst meine Schwester, dann ich, Typhus. Ohne Arzt kamen wir durch. Ich war drei Tage an der Himmelstür, aber Petrus hatte mit mir Mitleid.
Einer der Miliz-Herren wollte bei uns wohnen, der hatte die »deutsche Sauberkeit« im Krieg genossen. Ich gab ihm ein Zimmer ab, dadurch hatten wir nachts vor Polen und Russen Ruhe. Der Pole war immer zwischen Berlin und München geflogen; er hat bei den Heinkel-Werken gearbeitet, sagte er.
Inzwischen mussten die Ostpreußen-Frauen mit ihren Kindern und sehr viele andere Ostpreußen, auch Deutsche, die keine Rummelsburger waren, die Stadt verlassen. Sie hatten kein Wohnrecht. Das war im Herbst. Wir hatten an der »Eisernen Brücke« Kartoffeln gepflanzt, wir mussten ja an den Winter denken. Auch die wurden uns genommen, als wir sie einmieten wollten.
Inzwischen hatten wir die Kuh einem polnischen Schlachter angeboten, halbe – halbe. Es hat geklappt. Als wir die Hälfte abholten (es war natürlich nicht die Hälfte) auf dem Hof von Schlachter Klotz, war vorn im Laden ein großes Palaver. Die Schlachtersfrau schrie: »Schnell raus!« und wir zogen mit unserer Hälfte ab, mit dem Ziehwagen, die fünf Kinder oben auf. Sie sangen russische Lieder, um alle abzulenken. Sie hörten diese Lieder ja jeden Tag. Und so kamen wir in unsere Wohnung. Es gab ein Schlachtfest. (Der Pole wurde kurzfristig festgenommen, aber nicht unsertwegen.) Da er uns aber um das Rinderfett betrogen hatte, wagte meine Schwester noch mal einen Gang zu ihm, und siehe, sie bekam statt dessen Butter. Wir machten Wurst; sie wurde, da wir ja nicht räuchern konnten, an die Rückseiten der Bettstellen gehängt, Nägel wurden eingeschlagen, und so trocknete unsere Wurst. Sie war hart wie ein Stein, aber es wurde daraus ein Mittagessen. Ein Wunder, wir waren jetzt acht Personen, dass wir nicht verhungert sind. Das restliche Fleisch wurde gepökelt. Unser Vater hatte immer einen guten Einfall.
Nun ging ein Transport in den Westen, der erste, natürlich mit den Rummelsburger Kommunisten, an der Spitze unser kleiner Superintendant »Gensichen«. Da ist jeder sich selbst der nächste, auch ein Pastor.
Inzwischen wurden Läden aufgemacht, aber wir besaßen noch keine Zlotys.
Der Herr Katschke, der so lange bei der Kommandantur als Straßenältester tätig gewesen war, machte mir das Angebot, es zu machen. Dieses Amt übertrug er mir. Jeden Vormittag mussten wir zu einem Dolmetscher, der uns sagte, was in den leeren Häusern noch zu sammeln war. Ich musste mir dann Frauen schnappen, und wir mussten los; dabei gab es gar nichts mehr zu sammeln, zuletzt waren es, wenn ich mich recht erinnere, Bleistifte. Ich habe mich gedrückt, wo ich konnte.
Außerdem hatte ich eine Stelle bei polnischen Offizieren, dort habe ich gekocht, wenn es etwas zu kochen gab. Die haben auch oft Kohldampf geschoben! Das waren ungefähr zehn Mann und eine Frau; fragt mich nicht, wie die rumgehurt haben. Gott sei Dank brauchte ich nichts zu befürchten, sie waren nett zu mir. Eines Tages, ich war gerade in der Küche, da wurde die ganze Bagage abgeführt. Nach einer Woche stand der Bursche des einen Offiziers wieder vor meiner Tür und holte mich. Es war ein netter Junge, konnte gut deutsch, ich hatte ihn »Erich« getauft.
Ja, und nun rückte Weihnachten 1945 immer näher. Inzwischen durften wir bei Frau Kühnelt in der Mühlenstraße, die einen Polen bei sich wohnen hatte, Radio hören (Herr Kühnelt war Taxifahrer, sie hatte eine kleine Landwirtschaft). Der Pole ließ uns allein, wir sollten hören. Ich sagte ihm auf den Kopf zu: »Sie waren einmal ein Deutscher, aber nach dem letzten Krieg haben sich ihre Eltern zu den Polen bekannt.« Er gab es zu. Ich kannte nämlich seinen Cousin, der in Rummelsburg wohnte (er wohnte mit seinem Vater auf einem Flur, er hieß Kidrowski). Er hat auch meine letzten Klamotten bekommen, als wir raus mussten.
Für meine Arbeit bei den Russen bekam ich zu Weihnachten 1200 Zloty. Was war ich glücklich, so konnten wir uns einen Kuchen backen. Das war in den ganzen Monaten eine einzige Zuwendung.
Da die Russen ja in dem städtischen Haus, in dem ich früher wohnte, ihre Verwaltung eingerichtet hatten, musste ich dorthin, um mein Weihnachtsgeld abzuholen. Bei dieser Gelegenheit ging ich eine Treppe höher in meine Wohnung, weil ich wusste, in meinem Schlafzimmer hatte sich ein russischer Offizier wegen einer deutschen Frau erschossen. Mein Gott, war ich schockiert! Das ganze Zimmer war von der Decke bis zum Boden mit rotem Inlett tapeziert, zwei Stühle, die an der Wand standen, waren mit dem Lenin- und dem Stalinbild dekoriert, dann war noch ein Schreibtisch und ein Stuhl ebenso verkleidet. An sämtlichen Zimmertüren waren Vorhängeschlösser, an der Toilettentür war ein übergroßes Schloss, so eines sah ich noch nie. Ich fragte mich, was das wohl zu bedeuten hatte. Im selben Augenblick stand eine Russe neben mir; in Angst eilte ich die Treppe herunter. Ich erklärte ihm, dass dies mal meine Wohnung war.
Im Frühjahr wurde meine Schwester als Schreibkraft im polnischen Rathaus eingesetzt, um die Ausweisungen zusammenzustellen, natürlich ohne Lohn und Brot. Da wir jetzt an einer Straßenecke wohnten, konnte sie uns, Gott sei Dank, auf die erste Liste setzen, musste aber eine Nachfolgerin bereitstellen, was wir auch schafften. Es war Hildegard von Kolschinski, eine Sekretärin vom Rummelsburger Rathaus. Sie ging dann beim nächsten Transport raus.
Einige Tage vor unserer Ausweisung kamen drei Polen in zivil und nahmen mir die Schlafzimmermöbel weg. Was nun? Meine Schwester war im Rathaus, ich heulte, als sie nach Hause kam. Wir waren acht Personen, ohne Betten. Sie war immer resoluter als ich. Also, wir hin zu den »Höchsten« von Rummelsburg, sie saßen im Finanzamt. Es war dort fast alles wieder hergestellt. Vorher hatten dort die Russen ihre Pferde untergestellt, sie hatten die Schubfächer als Futterkrippen benutzt. So etwas muss man gesehen haben. Der Raum war mit unseren, ich meine mit Rummelsburger Polstermöbeln ausgestattet. Ein Dolmetscher kam, und wir trugen unser Anliegen den »Hohen Herren« vor. Er sagte uns Geld zu. In dem Moment kam der »Ober-Klauer« herein; als er uns sah, bekam er Schaum vors Maul, aus Wut. Er musste uns Ersatzmöbel schicken, obwohl wir nur noch wenige Tage dort waren.
Am Morgen der Ausreise stand er an der Tür mit 850 Zloty. Nicht viel Geld, aber wir lächelten, was nicht oft vorkam, hatte ich doch für mein Schlafzimmer bei Becker in Stolp 850 Reichsmark bezahlt, als ich heiratete. Wie die Zahlen sich ähneln!
Am Morgen den 23. Juni 1946 war es nun so weit, es ging zum Bahnhof. Wir trafen noch Trude Vergin und Frau Kaschuberth, die hatten beschlossen, dort zu bleiben, was sie später bitter bereut haben. Meine Schwester hätte sie sicher auf die Liste gesetzt, aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich, manchmal auch seine Hölle. Wir waren froh, dieser Hölle zu entrinnen.
Am Bahnhof gingen die Schikanen weiter, unser kleiner Wagen wurde uns weggenommen. Endlich setzte sich der Güterzug in Bewegung, unser Ziel kannten wir nicht. Nach Polen? Nach Sibirien? Es war alles möglich. Aber als wir in Stettin-Scheune ankamen, hatten wir Hoffnung auf den Westen.
Im Zug wurden wir noch einmal beklaut. Es gab eigentlich nichts mehr zu nehmen, denn unser Gepäck durfte nur für die Familie 15kg betragen, und so viel hatten wir nicht einmal. Wir Frauen wurden von den Polinnen von Kopf bis Fuß abgetastet, Schuhe und Strümpfe mussten ausgezogen werden. Und trotzdem habe ich meine beiden guten Uhren gerettet. Eine trage ich heute noch, und die geht und geht noch auf die Minute. Das war noch Wertarbeit. Wo ich die wohl versteckt hatte? (In dem Zwickel des Schlüpfers meiner kleinen Roswitha.)
In Stettin mussten wir einige Tage bleiben, bei Hunger und Durst. Wir waren hinter Gittern; trotzdem bin ich unten durch gekrochen, bin zu einem Laden gelaufen und habe dort Brot für mein »Möbelgeld« geholt, natürlich unter Herzklopfen.
Dann ging es über Lübeck nach Segeberg. Ankunft etwa zwischen dem 01. und 05. Juli 1946. Dort nahm uns der Engländer in Empfang, mit der Läusespritze. Außerdem wurde die Parteizugehörigkeit geprüft. Dann ging es in einen heilen Zug, denn bisher waren es Güterzüge oder Züge mit zerschnittenen Sitzen. Es ging zum Lockstedter Lager, genannt Lo-La, heute Hohenlockstedt, wieder hinter Gitter. Dort haben wir wieder furchtbar gehungert, bis man herausbekam, dass sämtliche Lebensmittel von einem Deutschen unterschlagen wurden. Nach uns kam ein Transport, in dem war eine Rummelsburgerin mit Namen Hedwig Burzlaff, sie hat es geschafft, sie ist mit dem »Wasser«-Essen nach Itzehoe gefahren, und da kam es heraus. Dieser Kerl lebt heute noch in Itzehoe. Wie die Hedwig das geschafft hatte, aus diesem Lager rauszukommen, ich weiß es nicht.
Nun ging es wieder in einen Zug, der uns endlich an ein Ziel bringen sollte. Wir fuhren immer Lo-La, Mühlenbarbek – Kellinghusen, hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück, wer weiß, wie oft. Man bedenke, die Strecke war genau 9 km! Keiner wollte uns haben, angeblich war alles überbelegt. Na endlich – wir wurden in Mühlenbarbek ausgeladen; ja und nun wohin? In einen gut gesäuberten und gekalkten Kuhstall! Mühlenbarbek war, ich schreibe bewusst war, ein Dorf mit reichen Bauern. Heute nach 43 Jahren, da ich dies schreibe, gibt es keine Kuh mehr im Ort, keine Meierei, nichts.
Also, wir waren nun im Kuhstall mit einigen anderen Flüchtlingen, nicht nur Rummelsburger. Dort hat uns alle dann noch eine Deutsche bestohlen. Ja, da kann man den Glauben an die Menschheit verlieren. Aber, wie gesagt, der Kuhstall war sauber. Die Kühe kommen ja immer rechtzeitig im Frühjahr auf die Weide und bleiben auch nachts draußen, das war uns neu. Das muss man den Holsteinern lassen, über die Sauberkeit ging nichts. (Die heutige Generation hat nachgelassen.) Es wurde alles gescheuert, nur der Schornstein auf dem Dach nicht. Ich machte unsere Bäuerin immer darauf aufmerksam.
Vom 10. bis 25. Juli 1946 waren wir im Kuhstall auf Stroh und Fußboden, aber wir waren froh, endlich in Sicherheit zu sein. Der Bauer stellte uns jeden Morgen eine Kanne Blaumilch und eine Kanne Buttermilch hin. Wir bekamen Lebensmittel-Marken, und das Leben erschien uns nach langer Zeit wieder »lebenswert«.
Am 25. Juli 1946 bezogen wir bei Bauer Voss die Altenteilwohnung, zwei Zimmer und Küche mit Wasserleitung und Abfluss. Das war schon etwas! Toilette: Treppe runter, ums Gehöft und siehe da: da war das Herz-Häuschen!
Dort auf dem Bauernhof haben wir allerlei lernen müssen. Ich wollte sogar Kühe melken lernen, aber dafür war ich zu dumm. Die Kuh hat mich nicht anerkannt und trat mich (auf den Fuß). Ich habe heute noch das Andenken. Aber Kartoffeln sammeln, Rüben hacken, Flachs ziehen, das habe ich einige Zeit machen müssen, bis alles seinen geregelten Gang ging. Auch das hat man überstanden.
Die Kinder kamen auch wieder in Ordnung durch die Schule in Mühlenbarbek; ein Lehrer und einhundert Kinder. Der Lehrer Schulz kam aus Schlesien, er war ein prima Lehrer. Er gab meinem Rolf unentgeltlich Nachhilfeunterricht, weil er sah, er war ein sehr guter Schüler und hat fast zehn Jahre überhaupt keinen Unterricht gehabt. Rolf ist ihm heute noch dankbar dafür, und Rolf hat ihn auch immer besucht, bis er starb. Unsere Kinder haben sich mit den Einheimischen gut vertragen; wir begrüßen uns heute noch mit allen »Barbekern«.
Es gab auch Schulspeisungen, und wir bekamen Geld und B-Bezugscheine, die galten für einfache Kleidung, aber nicht für Mäntel und Schuhe, die so nötig waren.
Ich fuhr zweimal in der Woche nach Hamburg, auf dem Trittbrett oder im eingepferchten Vorraum des Zuges, es war grausam.
Unser alter Herr Bürgermeister Delfs sorgte immer für B-Bezugscheine. In Itzehoe haben die Beamten schon gefragt, ob wir die Scheine fressen. Dem Herrn Delfs möchte ich heute noch danken. Ich hatte bei ihm »einen Stein im Brett«, wie man so schön sagt. Ich bekam diese B-Scheine sogar für Matratzen für zwei Betten. Ja, und so standen wir, meine Schwester und ich, auf dem Hauptbahnhof in Hamburg und konnten die Dinger nicht in die S-Bahn und später in den Zug bekommen, die Züge waren ja immer überfüllt. Und wieder half uns der liebe Gott. Ein Soldat in schäbiger Uniform, das gab es noch, kam den Bahnsteig entlang. Ich sagte laut zu meiner Schwester: »Der Mann sieht aus wie Hans von Puttkammer«. (Er hatte in Rummelsburg am Markt ein großes Eisenwaren- und Haushaltswarengeschäft.) Eine scharfe Drehung von Herrn von Puttkammer und ein Ausruf: »Das ist er auch!« Und wir lagen uns in den Armen. Nun hatte alle Not ein Ende. Er brachte uns mit unseren Matratzen auf den Weg. Im Zug rief er alle Passagiere auf: »Setzt euch Kinder, so warm und weich habt ihr noch nie gesessen!« Ja, das war noch ein Offizier der alten Schule.
Inzwischen wohnten wir sieben Jahre in Mühlenbarbek, und die Kinder gingen schon einige Jahre in Kellinghusen zur Schule, in Wind, Regen und Schnee, fünf Kilometer hin, fünf zurück. Ich machte auch in Kellinghusen Dienst. So ging es nicht weiter!
Jetzt wurde in Kellinghusen gebaut. Hin in die Höhle des Löwen, zum Bürgermeister. Die Wohnungen waren aber nur für Kellinghusener Bürger vorgesehen. Ich habe es trotzdem geschafft, 1953 in einen Neubau zu ziehen, mit Hilfe der Bürgermeister von Mühlenbarbek und Kellinghusen; denn unser Rolf war schon in Ausbildung bei der Post. Auch das habe ich geschafft, denn die Stellen waren knapp, und selbstverständlich nahm man nur Einheimische.
Am 20. Juli 1953 war es dann so weit, (welch ein historischer Tag), wir zogen ein. Mit dem Trecker fuhr uns unser Bauer hin. Ich hatte die Wohnung vorher schon mit meinen Möbeln, Teppich und Gardinen eingerichtet, alles war bezahlt. Was waren wir glücklich!
Ja, die Wohnung, 40 qm, kostete 39,90 DM; Einzahlung 1.900,00 DM, 1.000,00 DM vom Lastenausgleich und 900,00 DM mussten wir armen Teufel, und das 1953, selbst aufbringen. Aber wir hatten ein Bad, warmes und kaltes Wasser in Küche und Bad, und endlich die lang ersehnte Toilette, was sehr, sehr viele Einheimische noch nicht hatten. Die liefen noch lange Jahre danach aufs Plumpsklo, und das wurde dann aufs Land geschüttet. Ich muss mich heute noch übergeben, wenn ich daran denke, das mussten wir ja auch in Mühlenbarbek machen. Nach einigen Jahren bekamen wir das eingezahlte Geld zurück.
So, das war es!!!
Ich habe dies nach 43 Jahren geschrieben, für die unvergessene Heimat, zur Erhaltung der Erinnerung.
Was nicht aufgeschrieben wurde, hat es nicht gegeben oder ist vergessen.
Die letzten Reste aus unserer Zeit sind verkommen und verfallen, und ich denke mit Wehmut im Herzen an mein liebes Heimatstädtchen Rummelsburg in Pommern.
Die Vergangenheit war wieder lebendig, alle Schrecken und Erniedrigungen, und ich habe versucht, niederzuschreiben, wie es war!!!
Klara Heinke / Kellinghusen im Sommer 1989
© Foto und alle Texte: Fred Hüning