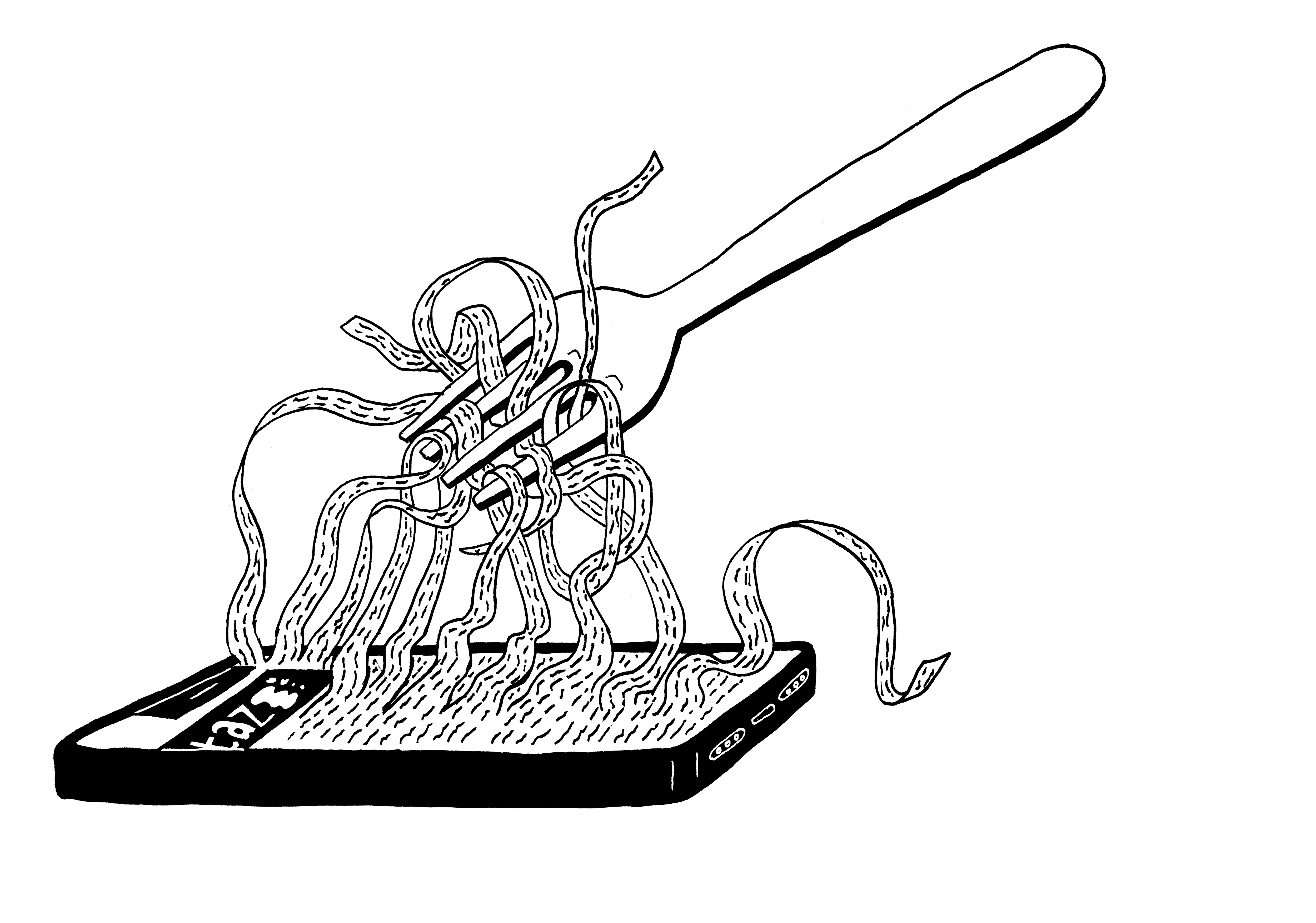Vor einigen Wochen gab es vor dem Berliner Berghain ein interessantes Vorkommnis: Tesla-Chef Elon Musk lehnte einen Besuch des Berliner Nachtclubs mit der bei Twitter veröffentlichten Begründung ab, dass er das Wort Peace hasse, welches auf der Wand des Berghain gesprayt war:
Frieden. Frieden? Ich hasse dieses Wort. Diejenigen, denen der Frieden am Herzen liegt (mich selbst eingeschlossen), brauchen es nicht zu hören. Und diejenigen, denen Frieden nicht wichtig ist? Nun …
Ganz unabhängig von der Tatsache, dass man eher davon ausgeht, dass Musk an der Tür abgewiesen wurde (aber zu eitel ist, um dies zuzugeben), lohnt es sich – der intellektuellen Spekulation zuliebe – erst einmal davon auszugehen, dass Musk ehrlich und aufrichtig meinte, was er getwittert hat. Zunächst fällt die offensichtliche Obszönität von Musks Statement auf, welche konkret darin besteht, dass das Wort Peace verunglimpft wird in einer Situation, in welcher der Weltfrieden so gefährdet ist, wie seit langem nicht mehr.
Was bedeutet Frieden wirklich?
Musk suggeriert mit seiner Aussage zudem, dass er es eh nicht nötig habe, dauernd zu hören, was Frieden wirklich ist – da er ohnehin weiß, was Frieden bedeutet. Aber ist es tatsächlich so einfach? Sollte Musk sich wirklich anmaßen zu wissen, was Frieden wirklich bedeutet? Oder (noch) konkreter formuliert (unter der Annahme, dass Musks Position nicht nur irgendeine partikulare Position repräsentiert, sondern vielmehr ein derzeit allgemein vorherrschendes Empfinden): Sollten wir, in den EU-Staaten und anderen westlich geprägten Ländern, uns wirklich anmaßen, zu wissen, was Frieden wirklich bedeutet?
Ich beziehe mich an dieser Stelle nicht ausschließlich auf die zunehmend besorgniserregende Kriegsrhetorik, von welcher unsere gesellschaftlichen Debatten in den letzten Wochen heimgesucht wurden. Vielmehr möchte ich an dieser Stelle auf ein Dilemma hinweisen, vor welchem wir derzeit alle stehen: Wie können wir das Erbe eines originären Pazifismus verteidigen, welcher jegliche Form der kriegerischen Auseinandersetzung ablehnt, ohne dabei die Menschen in der Ukraine im Stich zu lassen? In diesem Zusammenhang scheinen wir es mit dem Unmöglichen zu tun haben. Die Unmöglichkeit besteht darin, alle Waffen niederzulegen ohne die ukrainische Bevölkerung der Gefahr des russischen Aggressors auszusetzen. Es scheint in diesem Zusammenhang nur eine Lösung zu geben: Es bedarf einer Verunmöglichung des Unmöglichen.
Aber wie lässt sich eine derartige Verunmöglichung des Unmöglichen gewährleisten? Anders gefragt: Wie bringen wir es fertig den Frieden zu schützen, ohne die ukrainische Bevölkerung dem Unfrieden zu überlassen?
Die Einlösung der vergangenen Hoffnung
An dieser Stelle könnte eine Passage von Adorno und Horkheimer aus der Dialektik der Aufklärung weiterhelfen:
Nicht um die Konservierung der Vergangenheit, sondern um die Einlösung der vergangenen Hoffnung ist es zu tun.
Vielleicht sollte diese Passage für die derzeitige weltpolitische Lage, mit welcher wir uns konfrontiert sehen, so umgedeutet werden, dass die Art von Pazifismus, an welche viele von uns geglaubt haben, nicht mehr konserviert werden sollte. Aber nicht – und hier liegt die Paradoxie – um das Erbe des Pazifismus aufzugeben (nach dem Motto: „Jetzt ist es mit dem Pazifismus vorbei. Wir waren zu naiv und müssen jetzt kämpfen“), sondern vielmehr um Raum für einen wirklich authentischen Pazifismus zu schaffen. Um dieses scheinbar Unmögliche möglich zu machen, sollten wir uns vielmehr – ganz im Sinne von Adorno und Horkheimer – um eine Einlösung der vergangenen Hoffnung bemühen. Diese vergangene Hoffnung besteht genau genommen darin, den Raum für einen wirklichen und andauernden Frieden zu ermöglichen. Man mag dies natürlich jetzt als eine schlichte Naivität beiseite schieben und behaupten, dass dies angesichts der derzeitigen geopolitischen Lage mehr als unrealistisch sei.
Hier gilt es jedoch präzise zu sein und die Aussage von Adorno und Horkheimer mit der Aufmerksamkeit zu analysieren, die ihr gebührt. Die Tatsache, dass an einem vergangenen Zustand festgehalten (sprichwörtlich: dass dieser konserviert) wird, obwohl dieser nicht erhaltenswert ist, impliziert zugleich, dass es eine Hoffnung gab, welche in diesem Zustand nicht eingelöst werden konnte. Wir müssen also die komplette Rahmung ändern, um die Einlösung der vergangenen Hoffnung – eo ipso: einer Welt, welche sich dem Ideal des Friedens annähert – zu gewährleisten.
Die Selbstkritik ist mächtiger als manche Waffe
Wie können wir dieser scheinbar utopischen Vorstellung näher kommen?
Vielleicht, indem wir uns der Einsicht gewahr werden, dass die größte Waffe im Kampf gegen Putins Ideologie die Selbstkritik ist. Sie ist das, was Putin und sein Herrschaftsregime am meisten fürchten. Diese steht nämlich für den europäischen Gedanken der Aufklärung selbst (Menschenrechte für jeden Menschen, egal welches Geschlecht, welche Herkunft etc.).
Dieses emanzipatorische Erbe, welches nicht zuletzt auch all die Protestierenden in der russischen Bevölkerung und die Ukrainer selbst antreibt, können wir am besten verteidigen, wenn wir uns selbstkritisch fragen, ob wir unseren Idealen auch immer gerecht geworden sind.
Über den (Un-)Nutzen von Whataboutismen
Derzeit gilt es als besonders problematisch, wenn man im Kontext des Kriegs in der Ukraine die argumentative Strategie des whataboutism verwendet. Die Kritik, die in diesem Zusammenhang häufig zu hören ist, lautet dann, dass es unangemessen sei, auf die Verbrechen von NATO-Staaten aufmerksam zu machen, wenn Putin derzeit einen derartig brutalen Angriffskrieg gegen die ukrainische Bevölkerung fährt. Diesem Argument gilt es jedoch insofern zu widersprechen, als es darauf ankommt, mit welcher Intention man dieses argumentative Manöver des whatabout?… benutzt.
Nutzt man dieses Argument lediglich, um Putins Angriffskrieg zu rechtfertigen (nach dem Motto: „wir sollten mal lieber still sein, denn die westlichen NATO-Staaten haben auch schon so einige Kriegsverbrechen begangen“), dann ist diese Kritik an der whatabout-Argumentationslinie mehr als gerechtfertigt. Nicht zuletzt, da Putins Angriffskrieg einzig und allein seine Schuld ist. Es gibt jedoch noch eine andere Art und Weise, mit welcher sich die whatabout-Strategie argumentativ nutzen lässt. In diesem Zusammenhang weist der US-amerikanische Philosoph Ben Burgis in einem Essay im Current Affairs Magazin treffend auf Folgendes hin:
Aber wenn man nicht wenigstens die Frage „Was ist mit…?“ stellt, ist es einem einfach nicht ernst damit, moralisch konsistente Maßstäbe anzulegen. Sich über die Missetaten anderer Mächte zu entrüsten und sich gleichzeitig zu weigern, in den Spiegel zu schauen, ist das, was Wladimir Putin tut, wenn er gleichzeitig den amerikanischen Imperialismus verurteilt und Krieg führt, um einen weniger mächtigen Nachbarn in der Einflusssphäre seines Landes zu halten. Das sollten wir besser machen.
Fähigkeit zur Selbstkritik
Burgis bringt in der hier zitierten Passage präzise auf den Punkt, warum die whatabout-Strategie mehr ist als nur eine billige (und ideologisch verblendete) Verteidigung von Putins Handeln. Vielmehr ermöglicht diese Strategie es uns dem emanzipatorischen Erbe – welches die Visionen vieler Protestierender, welche auf der ganzen Welt um ihre Rechte kämpfen, leitet – ohne Widersprüchlichkeiten gerecht zu werden. Diese Form der Selbstkritik würde uns der Einlösung einer vergangenen Hoffnung, ganz im Sinne von Adorno und Horkheimer, einen entscheidenden Schritt näher bringen. Nicht zuletzt, da wir in diesem Fall wirklich beweisen würden, dass die Fähigkeit zur Selbstkritik wirklich etwas ist, das wir – im Gegensatz zu Putin – für uns in Anspruch nehmen können.
So sollten wir beispielsweise nicht nur Kritik an der staatlichen Zensur in Russland üben, sondern uns darüber hinaus auch fragen, warum wir es zulassen, dass Julian Assange bald möglicherweise an die USA ausgeliefert wird, wo ihm für die journalistische Offenlegung von US-amerikanischen Kriegsverbrechen bald 175 Jahre Knast drohen. Wir müssen, anders formuliert, zeigen, dass es uns mit unseren Werten ernst ist.
In einer Fernsehdebatte, welche kürzlich zwischen dem CDU-Politiker Norbert Röttgen und dem ehemaligen Linken-Politiker Oskar Lafontaine stattfand, war etwas interessantes zu beobachten.
Nachdem Lafontaine seine (durchaus berechtigte) Sorge bekundet hat, dass Menschen mit geringem Einkommen bald, aufgrund der steigenden Preise, noch weniger Geld haben werden, lautete Röttgens Gegenargument, dass es anmaßend von Lafontaine sei, den Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, zu unterstellen, dass diese nicht bereit seien, ihren Gürtel für die leidenden Menschen in der Ukraine bald noch enger zu schnallen. Um sein Argument emotional zu untermauern, hat Röttgen dann noch darauf hingewiesen, dass Babys in der Ukraine sterben und Menschen vom Krieg verstümmelt werden. Man kann an dieser Stelle nur mutmaßen, ob Röttgen das extra gemacht hat. Nichts desto trotz hat Röttgen jedoch nichts anderes gesagt als: „An alle Menschen in Deutschland mit Existenzängsten. Wagt es nicht, euch zu beschweren! Denn sonst seid ihr indirekte Befürworter des Angriffskrieges! Schweigt und applaudiert, dass wir diskussionslos 100. Mrd. für die Aufrüstung mobilisiert haben.“
Die Einlösung einer vergangenen Hoffnung
Der Fehler an diesem Argument ist, dass dieses von einem Widerspruch ausgeht, der eigentlich nicht vorhanden sein sollte. Es geht davon aus, dass das Leid von Menschen, welche (bei uns und weltweit) in prekären Verhältnissen leben, von jenem Leid der ukrainischen Bevölkerung als getrennt zu betrachten ist. Die Einlösung einer vergangenen Hoffnung würde jedoch diesen Widerspruch auflösen. Sie würde bedeuten, dass jegliche Form des Leids – sei es nun erzeugt durch kriegerische Auseinandersetzungen oder durch prekäre ökonomische Verhältnisse – eliminiert gehört aus dieser Welt. Auch wenn es derzeit unmöglich scheint, das Unmögliche möglich zu machen, sollten wir uns von dieser Idee leiten lassen. Selbstvergewisserung und Selbstkritik, welche ermöglicht, dass wir nach moralisch konsistenten Maßstäben handeln, wäre der erste Schritt in die richtige Richtung. Unsere Aufgabe besteht – ganz einfach gesagt – darin, den Visionen, welche den Widerstand der ukrainischen Bevölkerung gegen den russischen Aggressor antreiben – ohne Widerspruch gerecht zu werden. Wer behauptet, jetzt sei nicht die richtige Zeit für Selbstkritik, liegt klar falsch. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.

Von Florian Maiwald, Philosophie-Doktorand an der Universität Bonn. Er veröffentlicht im Freitag, The European, Pressenza und Unsere Zeitung.