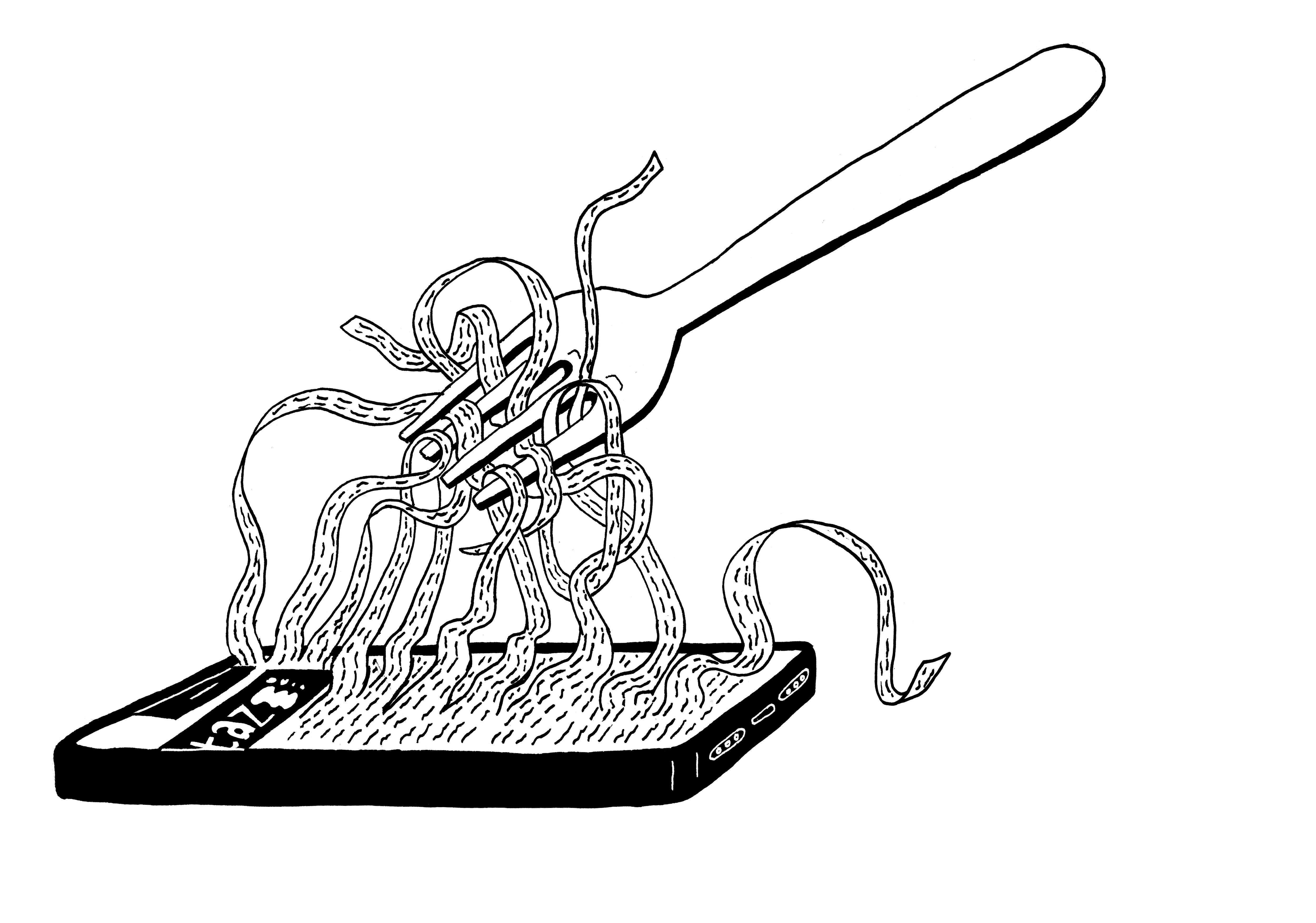Gestern fuhr ich mit dem Metronom von Bremen nach Hamburg. Dort wollte ich ins Literaturhaus, zur Lesung von Markus Berges. Er würde dort sein neues Buch „Irre Wolken“ vorstellen, hatte ich gelesen. Da er aus Köln stammt, ich ihn aber dort nie gesehen habe, dachte ich, dass es eine gute Idee sei, dafür einmal von Bremen nach Hamburg zu fahren. Das Hamburger Literaturhaus ist in einem phantastisch-prächtigen Gebäude aus der Gründerzeit untergebracht und wurde von der Zeit-Stiftung mitfinanziert. Ein Café im Eingang lud dazu ein, sich ein Getränk mitzunehmen. Da die Schlange vor der Theke aber lang war und ich nicht wusste, ob ich im Zuschauerraum, wo freie Platzwahl war, noch einen guten Platz bekommen würde, nahm ich davon Abstand, vor Beginn etwas zu trinken und setzte mich schon mal. Den Autor habe ich während der vierzig Jahre, die ich in Köln gelebt und als Autorin gearbeitet habe, nie gesehen bzw. von ihm nie gehört. Auch die Band „Erdmöbel“, für die er singt, kenne ich nicht. Die Lesung wurde erst am Schluss sehr beklatscht, vielleicht weil er auch ein paar Songs spielte, von denen ich mich auch fast mehr angesprochen fühlte als von der Lesung, die ein wenig zu schnell war und irgendwie fast schlechter als sein Buch, das ich jedoch noch in der Nacht begeistert verschlang.
Besonders nachdenklich machte mich die Beschreibung dessen, dass der Protagonist, identisch mit dem Autor, der genauso alt ist wie ich, mit 20 Jahren noch nie von jemandem in den Arm genommen worden war und auch nie jemanden in den Arm genommen hatte, als er das erste Mal mit einer Frau Sex hatte. Mir fiel wieder ein, dass wir uns untereinander ganz früher auch immer nur mit ausgestreckter Hand begrüßt haben. Nach der Lesung bestellte ich ein Glas Fanta an der Theke, an der jetzt niemand mehr stand. Die Hamburger waren alle nach der Lesung nach Hause gegangen, was ich verstehen konnte, draußen war das Wetter sehr unangenehm. Der Kellner wirkte eher wie ein distinguierter verrenteter Reeder als wie ein Kellner. Dass das Glas recht groß war, erstaunte mich. Als er den Preis sagte, dachte ich erst, ich hätte mich verhört. Aber ich beschwerte mich nicht, zahlte die 5,50 Euro und fühlte mich wie ein Krösus und nicht wie die arme Schriftstellerin, die ich in Wirklichkeit doch bin. Eine 1,5 Liter Flasche Fanta kostet 1,11 Euro bei Rewe, das habe ich eben nochmal nachgesehen. Nachdem ich die Fanta getrunken hatte, beschloss ich, nie wieder im Hamburger Literaturhaus etwas zu trinken. Die spinnen, die Hamburger! Hier ist der Song von Markus Berges und seiner Band Erdmöbel, der mir gestern am besten gefiel:https://www.youtube.com/watch?v=saxiE58iRFA
Am nächsten Tag fuhr ich mit dem Fahrrad durch den Bremer Regen zu meiner neuen Friseurin. Ich bin schon einmal bei ihr gewesen, vor drei Monaten. Jetzt hatte ich wieder einen Termin. Seltsamerweise konnte ich mich kaum an sie erinnern, sie sich hingegen an mich schon. Sie wusste noch genau, worüber wir letztes Mal gesprochen hatten. Ich hatte ganz vergessen, dass wir miteinander gesprochen hatten und hätte sie, hätte man mich befragt, als blond beschrieben. Sie war aber dunkelhaarig. Vielleicht bin ich einfach bei zu vielen Friseur*innen gewesen in den letzten Jahren und konnte sie mir deshalb nicht merken. Sie wusste auch meinen Namen noch. Ich ihren nicht mehr. Ich fragte nach: Jessica, sagte sie. Da fiel mir wieder ein, dass sie mir den Namen letztes Mal doch gesagt hatte. Und ich schämte mich dafür, dass ich ihn nicht behalten hatte. Dann fiel mir wieder ein, dass wir letztes Mal über Einkaufsmöglichkeiten gesprochen hatten und sie gab mir ein paar sehr gute Tipps für Märkte, die ich noch nicht kannte, weil ich neu in diesem Stadtviertel bin. Dann fragte sie mich, wie ich mich in Bremen eingelebt habe und wie meine neue Arbeit sei und sagte, sie selber würde ja auch in einem sozialen Beruf arbeiten, ohne Menschenkenntnis ginge es nicht als Friseurin und dass sie früher Obdachlosen die Haare geschnitten habe und genau wisse, wie die Menschen seien, schon wenn diese zum ersten Mal ihren Laden betreten hätten.
Wir sprachen dann über ihre angeheirateten türkischen Verwandten, ihren Bruder, der sich hatte beschneiden lassen, weil er eine deutsch-türkische Frau geheiratet hatte, die aus einem Clan in Verden kam, wofür sie kein Verständnis hatte, weshalb schon jahrelang kein Kontakt mehr war zwischen ihnen. Man kann sich seine Verwandten nicht aussuchen, sagte sie. Aber ihre Cousine, die habe es besser gemacht, die hatte auch einen Türken geheiratet, aber einen der aus der Türkei gekommen sei. Er spräche schon nach wenigen Jahren perfekt Deutsch und lebe hier wie ein Deutscher, esse sogar Schweinefleisch. Darüber entspann sich ein Gespräch über Deutschtürken und Islamfeindlichkeit. Und über die Medien, die vieles falsch darstellten. Am schlimmsten sei es ja in der Coronazeit gewesen, da seien die Videos auf Youtube, die die Wahrheit über Corona sagten, gelöscht worden, erzählte sie mir. Ich horchte auf. Hatte ich es hier mit einer Coronaleugnerin zu tun?
Bevor ich noch weiter nachfragen konnte, trat eine jüngere, hellblond gefärbte Frau mit türkischen Gesichtszügen zu uns und sagte sehr besorgt zu Jessica: Ich habe mich verschnitten. Kannst du mal kommen? Wie, verschnitten, fragte J. Na, ich habe etwas abgeschnitten, was ich nicht abschneiden sollte, sagte diese und guckte sehr ängstlich. Bitte komm und guck es dir mal an. Einen Moment, sagte Jessica und ging, nachdem sie mir noch eine Strähne eingepackt hatte, mit ihrer Kollegin nach hinten. Was dort besprochen wurde, bekam ich nicht mit, aber die Kundin musste ihre Frisur wohl nicht bezahlen. Das war der Moment, wo ich mir fest vornahm, mir Jessicas Namen beim nächsten Mal gut zu merken….
Wenig später wurde ich von hinten angesprochen. „Ich bringe Sie zum Waschen!“ Eine Frau brachte mich zum Waschbecken und fing an, meine Haare zu waschen. Immer wieder bemerkte sie, was ich doch für dicke Haare habe und was für ein Glück das doch sei, so dicke Haare zu haben. Über die dicken Haare kamen wir auf Genetik und unsere Eltern zu sprechen, sie erzählte mir, sie sei in den fünfziger Jahren geboren und sagte, sie hätte sich mit 3 Geschwistern ein Zimmer teilen müssen, damals sei es allen so ergangen, aber heute könne sie keine Räume mit vielen Menschen mehr aushalten. Während dieses Gesprächs über Familie, Haar und Genetik kam Jessica und erzählte meiner Kopfwäscherin, dass ich ein Buch geschrieben habe, das wusste sie wohl noch vom letzten Besuch. Wovon handelt es denn, fragte diese. Als ich ihr erzählte, dass es um Freundschaft gehe, nämlich um eine türkische Austauschschülerin, die ich 40 Jahre lang aus den Augen verloren und gesucht hatte, waren die beiden Frauen sehr begeistert. Das sei aber schön, sagte mir die haarewaschende Frau. Sie selber wäre auch gerne Künstlerin geworden, aber es habe ja gar keine Förderung gegeben damals. Und sie sei wie ihre Eltern auch auch immer ängstlich gewesen und habe auf ihre Sicherheit geachtet. Ihr Sohn sei aber schon Akademiker geworden, der lebe jetzt mit seiner Familie in München. Das ist aber doch schade, sagte ich. Sie sagte, ja, ihre Enkelkinder sehe sie nur sehr selten. Aber das mache nichts. Ihr Sohn sei querschnittsgelähmt, seit er mit 21 Jahren einen Unfall hatte. Und er hat Familie und Kinder? fragte ich erstaunt, weil ich schon meinte, ich hätte irgendetwas falsch verstanden und es gäbe noch einen Sohn. Ja, das habe geklappt. Und er arbeite sehr erfolgreich, jette in der Welt herum als Topmanager. Allerhand, sagte ich. Als ich aufstand und mich umdrehte, sah ich sie. Sie war um die siebzig Jahre alt, aber sehr chic und jugendlich angezogen. Ihre Haare kurz rasiert und extrem gefärbt, riesigen Modeschmuck um den Hals und an den Ohren und auf interessante Weise geschminkt. Ich hätte Künstlerin werden können, sagte sie noch einmal und erzählte mir, dass sie auch malen würde. Ich hätte sie am liebsten in den Arm genommen.
Am Schluss, nach zweieinhalbstündiger Färbung, ging ich zur Kasse und zahlte. 63 Euro. Ich gab fünf Euro Trinkgeld und konnte es nicht glauben; beim letzten Friseurbesuch in Köln hatte ich für dieselbe Art Strähnchenfärbung 220 Euro bezahlt, das Mal davor 180 Euro. Damals war allerdings das Warmwasser kaputt gewesen und die Friseurin musste deshalb das Wasser mit dem Teekocher erhitzen.
Was ist los hier in Deutschland, fragte ich mich, während ich meinen Regenmantel wieder anzog. Warum diese seltsamen Phantasiepreise, die man nicht nachvollziehen kann? Hat es etwas mit der Größe der Stadt zu tun? Und ich fühlte mich auf einmal sehr zu Hause in diesem KLEINEN Bremen, das so nette Friseurinnen hat, die mir doch eben noch gesagt hatten, wie sehr sie sich freuen würden, dass ich Bücher schreibe und dass das Gute an ihrem kleinen Salon sei, dass man sich dort zu Hause fühlen könnte. Ja, das fühlte ich mich genau in diesem Moment, als ich an der Candy Bar vorbeiging, die vorne im Eingang steht, voller leckerer Zuckersachen, gedacht für die Kinder, die sich die Haare schneiden lassen. Und steckte mir noch schnell ein Gummibärchen in den Mund, bevor ich wieder hinaus in den Bremer Regen ging. Und nahm mir vor, diesen Blog über meine Friseurinnen zu schreiben…