
Ein Schild am Zaun, auf dem ein massiver Hundekopf prangt. Daneben drei Stichworte und je eine römische Zahl. „Postbote: vier. Einbrecher: sechs. Nachbars Katze: drei“. An der Haustür das nächste Schild: „Cave canem“. Der gleiche Hundekopf. Eigentlich möchte man schon wieder gehen, bevor man das Haus von Olaf Petersen betreten hat. Egal. Nach ein Mal Klingeln geht die Tür auf, ein Mann, ein Händedruck. Kein Hund. „Ach, den hat meine Ex-Frau bei ihrem Auszug mitgenommen“, sagt er. Die Schilder hat sie wohl vergessen.
Das war 2006. Es war nicht nur die Zeit, als seine Frau ihn verließ. Olaf Petersen hängte auch seine Selbstständigkeit als Taxifahrer an den Nagel. Er wechselte zum Hansafunk 211211, seitdem fährt er vier Mal die Woche seinen VW Touran, immer nachts, etwa 200 km pro Schicht.
Auf seinen Wohnzimmertisch hat Petersen Becher mit Filterkaffee gestellt, Eis und Pflaumenkompott habe er auch da, sagt er. Es soll um die taz gehen an diesem Mittwochnachmittag, was liebenswert an ihr ist, und was hassenswert. Und warum Olaf Petersen 2003 so sauer wurde, dass er sein Abo kündigte. Um Jahre später wieder zu bestellen.
Er habe sich einfach so geärgert, dass der Hamburg-Teil verkleinert wurde damals. „Ich dachte, wenn viele kündigen, bekommen wir vielleicht die alten Hamburg-Seiten wieder.“ Er versuchte es mit anderen Zeitungen. Die Bild-Zeitung hatte er schon während der 68er-Demos aufgehört zu lesen, die Hamburger Morgenpost eignet sich höchstens fürs U-Bahn-Fahren, findet er. Und das Abendblatt? „Ja, das hatte meine Frau zeitweise abonniert. Ging gar nicht. Springer berichtet mir eindeutig zu einseitig, vor allem im Wahlkampf.“ Nach fünf Jahren Abstinenz und ein paar Probeabos hat er die taz dann wieder abonniert, 2008 war das. „Es gibt eben keine bessere Alternative in der Stadt.“
Olaf Petersen ist 66, die taz liest er vor allem, wenn er morgens von der Arbeit nach Hause kommt. Oder eben jetzt, gegen 17 Uhr, nach dem Frühstück. Seine Nachtschichten hinterlassen zunehmend Spuren. Schatten hat er unter den Augen, die Haut ist fahl, etwas müde blickt er durch seine Brillengläser. Vor einer Stunde ist er aufgestanden. „Dass der Schlafrhythmus so durcheinander kommt, ist ein echtes Handicap“, sagt er. „Und soziale Kontakte werden auch immer schwieriger.“ Wenn Petersen Schicht hat, steigt er um 22 Uhr in seinen Wagen, er fährt acht Stunden, dann trinkt er noch einen Kaffee mit Kollegen und ist meist erst um neun Uhr morgens im Bett. In seinem Schlafzimmer hängen schwarze Rollos.
Olaf Petersen ist in Berlin geboren, ein paar Jahre hat er in Wien verbracht, der Liebe wegen. Seit über 30 Jahren wohnt er jetzt in Hamburg. Er könnte nicht typisch-nordischer sein: Etwas mürrisch am Telefon, bedeutend freundlicher in persona, nur die Satzenden, die vernuschelt er manchmal, da muss man dann nachfragen.
Er hat nach seinem Hauptschulabschluss im Hamburger Hafen auf der Werft gearbeitet, aber „weil man als Facharbeiter nicht alt werden kann“, wie er sagt, ist er dann doch noch aufs Abendgymnasium gegangen. Mit 33 hat er sein Studium begonnen, Metall und Maschinentechnik, nach der Schufterei im Hafen hat er das freie Studentenleben sehr genossen. „Aber nach einiger Zeit war meine Arbeitshaltung nicht so gut.“ Er begann, Taxi zu fahren.
Olaf Petersen erzählt gern Geschichten vom Taxifahren. Zum Beispiel diejenige, als die Polizei auf der Reeperbahn die Taxen kontrollierte, von jedem Fahrer wollten die Beamten den Personenbeförderungsschein sehen. Und am Ende standen da fünf oder zehn herrenlose Wagen.
Überhaupt die Reeperbahn. Eigentlich hat Olaf Petersen diesen Ärger mittlerweile satt. Immer wieder Besoffene. „Wer nicht allein laufen kann, den nehme ich nicht mehr mit.“ Es gab da eine Nacht, da hat er sich einen wankenden jungen Mann ins Auto setzen lassen, Freunde von ihm hatten ihm die Adresse genannt und 20 Euro in die Hand gedrückt. Am Ziel hat er den Fahrgast noch zur Tür gebracht, und plötzlich kippt der einfach um, sagt Petersen, und schlägt sich den Kopf auf der Treppe blutig. „Was machst du dann, wenn du kein Blut sehen kannst? Ich habe natürlich den Krankenwagen gerufen, aber irgendwie ist das ja auch nicht mein Job“, sagt er.
Mit der Zeit hat er den Zugang verloren zu den ganzen Jugendlichen, je älter er wird, wird es nicht besser, sagt er, und je starrer im Kopf. „Manchmal verstehe ich sie auch nicht mit ihrem ganzen ,Ey Digga, Alder'“. Mag er lieber die Quatscher, die ihr Leben in 15 Fahrtminuten vor ihm ausbreiten, oder die Stummen? „Das kommt drauf an. Aber ich bin immer höflich und gehe auf ein Gespräch ein. Sonst gibt’s am Ende nur Stress.“
Angst hat er nur selten beim Taxifahren. Nur einmal, im Nachhinein. Er stand auf der Reeperbahn, vor der Nevada Rodeo Bar, und da haben sich zwei Indonesier in seinen Wagen gesetzt. „Zu Blohm und Voss“, haben sie gesagt. Als Petersen losfahren wollte, waren sie schon von der Polizei umstellt, in voller Montur. „Ich dachte, die durchlöchern uns jetzt“, sagt Petersen. Er hat keine Angst gespürt, war wie erstarrt. Erst später, da waren die Indonesier längst festgenommen, da hat er das blutige Messer gefunden. Es lag unter dem Beifahrersitz. Da wusste Petersen: Irgendwie war der Hamburg-Aufenthalt der Indonesier blutig verlaufen, und er sollte das Fluchtauto stellen. Da ist ihm doch schlecht geworden.
„Vielleicht sollte ich mal ein Buch schreiben, da kommt ja einiges zusammen in 30 Jahren“, sagt Olaf Petersen und drückt sich noch tiefer in das schwarze Ledersofa. Dunkel ist es hier unten im Einfamilienhaus, dabei hat er für das Treffen extra die Hecke draußen gestutzt.
Atom, Umwelt und der Arbeitsmarkt – das sind die Themen, die er in der taz besonders spannend findet. Je lokaler sie aufgegriffen werden, desto besser. „Deshalb liebe ich ja den Hamburg-Teil. Es ist doch mit das Wichtigste, dass man erfährt, was in der eigenen Umgebung passiert.“ Die Springer-Presse streue dem Leser da Sand in die Augen, findet er. Noch immer wünscht er sich mehr Hamburg-Themen im Blatt. Liest er jeden Tag die ganze Zeitung durch? Nein, sagt er. Aber die Hamburg-Seite, die schafft er immer.
Mit den Taxi-Kollegen redet er nie über taz-Themen, die lesen eher andere Zeitungen. Der Hansafunk sei zwar in der konservativen Ecke angesiedelt, „aber hier kann ich von der Arbeit auch leben“, sagt Petersen.
Mit der taz nord hat er sich mittlerweile eingerichtet, sagt er. Und eingerichtet ist seine Wohnung mit der taz. Auf Kante hat er sie gestapelt, eine taz auf der anderen, direkt neben dem Sofa. Ganz oben, auf Seite 1: „Explosion in französischer Atomanlage“.
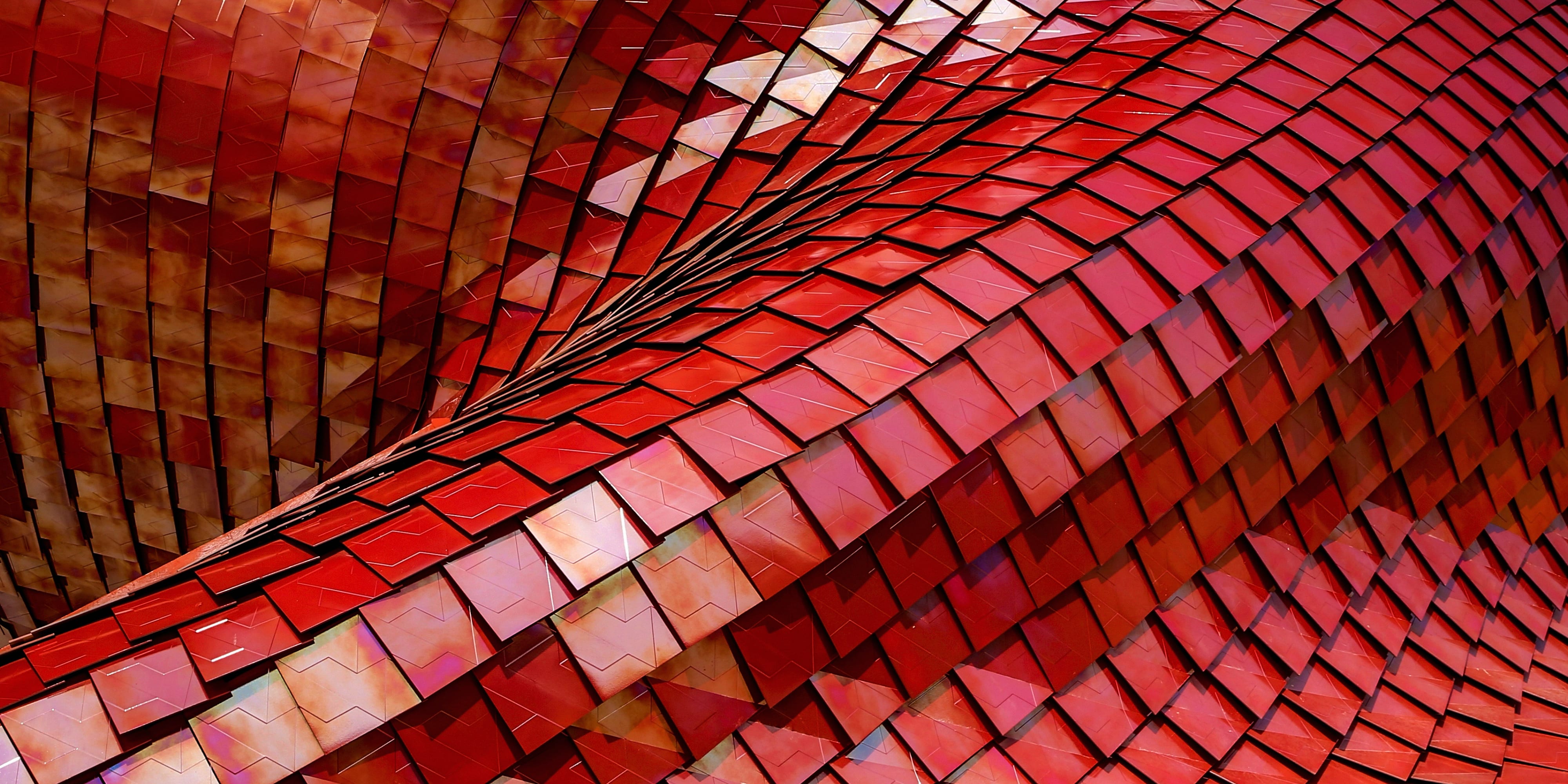



Danke an Olaf für die Offenheit.
Ich mache das auch, auf anderem Gebiet,
es ist nicht leicht.