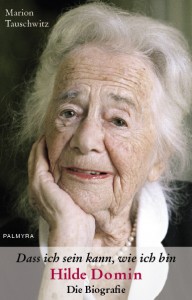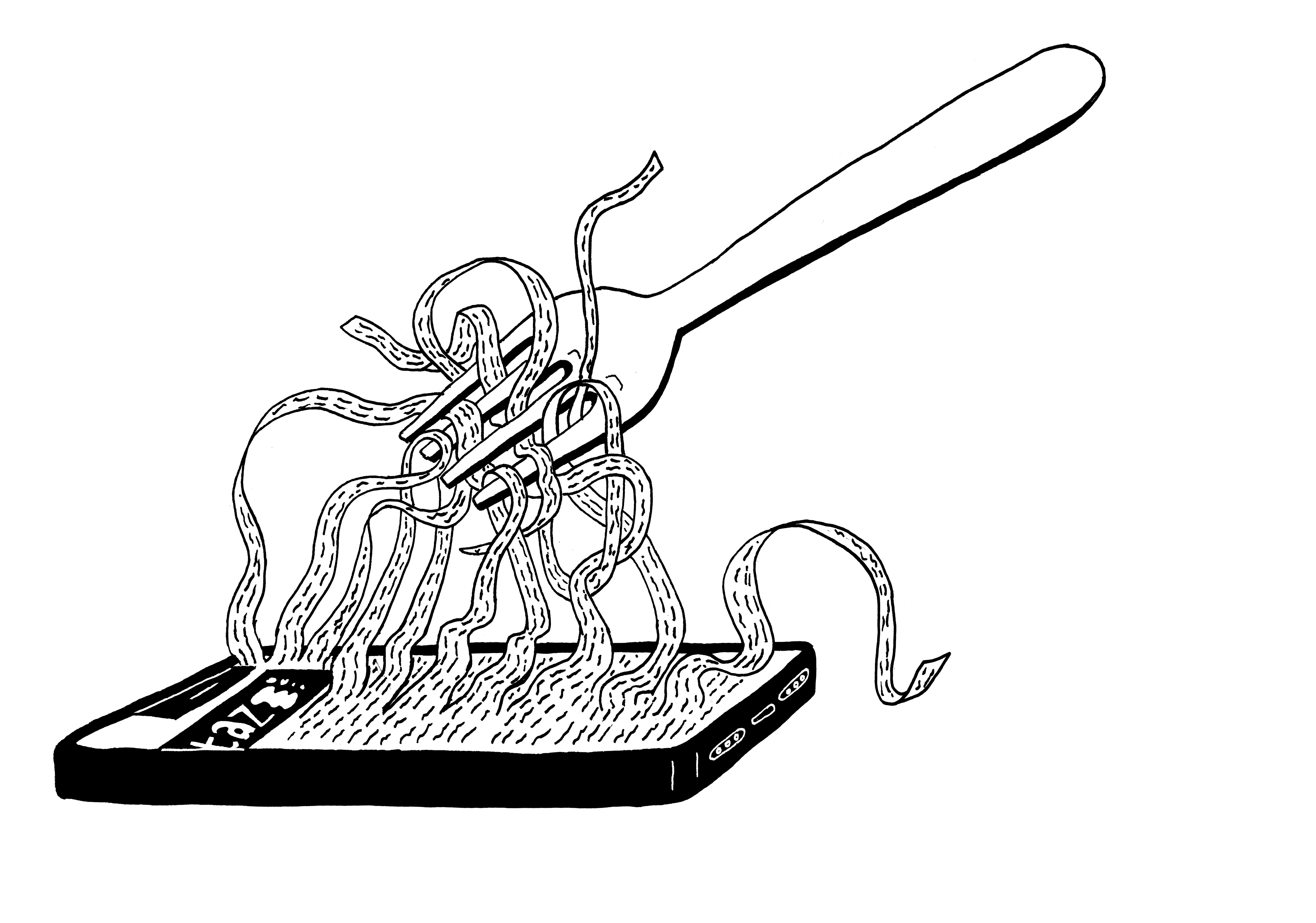„Ich nannte mich
Ich selbst rief mich
Mit dem Namen einer Insel.“1
Hilde Domin schrieb diese Zeilen 1954. Die damals noch unbekannte Lyrikerin leitete ihren Künstlernamen von Santo Domingo ab. Am 6. August 1940 war die gebürtige Kölnerin gemeinsam mit ihrem Mann, dem Archäologen Erwin-Walter Palm, mit einem Wasserflugzeug der Pan American Airways aus Puerto Rico kommend in der dominikanischen Hafenstadt San Pedro de Macoris gelandet. Aus Angst vor den deutschen Bombenangriffen und einer möglichen Invasion hatten die beiden ihr englisches Exil gegen die weit entfernte Insel eingetauscht. Am 27. Juli wäre Hilde Domin, die am 22. Februar 2006 in Heidelberg gestorben ist, 100 Jahre alt geworden. Hans-Ulrich Dillmann sprach mit der Domin-Biografin Marion Tauschwitz, die während der letzten fünf Lebensjahre Domins engste Mitarbeiterin war, über die Lyrikerin, deren Ängste und Verhältnis zu Judentum, Religion und Tradition.
Warum kommt in der Lyrik von Hilde Domin das Judentum nicht vor?
Tauschwitz: Judentum, erklärte sie immer wieder, habe in ihrem Leben keine Rolle gespielt; dennoch war Hilde Domin ein religiöser Mensch. In den Briefen, die ich ausgewertet habe, ist sehr oft die Rede von Gott, seiner Existenz, dem Leben nach dem Tod und ihrer Angst, die sie als theologische Furcht bezeichnete. Doch ist der bedingunslose Optimismus, der aus ihren Gedichten spricht und der unzerstörbare Glaube an das Gute im Menschen nicht doch Ausdruck des Judentums?
Was verstand sie unter theologischer Furcht?
Tauschwitz: Domin sprach von einem,,Urschrecken“, einem ,,Ronsdorfer Kinder-Schrecken“ in Bezug auf ihr Judentum. Damals war sie mit dem katholischen Kindermädchen in der Kirche, und der Pfarrer machte in der Predigt die Juden für den Tod von Jesus Christus verantwortlich. Das kleine Mädchen war so geschockt, dass es weinend aus der Kirche rannte. Der Gedanke, dass sie Teil des Bösen sein sollte, war ihr unerträglich.

Welche Bedeutung hat ihre Kindheit in dem jüdischen, wenn auch assimilierten EIternhaus in Köln gehabt?
Tauschwitz: Domins Antwort auf diese Frage, war: keine. Aber ihre Familie hat sehr wohl in einem jüdischen Umfeld gelebt, ihre amerikanische Verwandtschaft gehörte in New York zur „jüdischen Aristokratie“. Der Vater beschäftigte in seiner Rechtsanwaltskanzlei nur jüdische Urlaubs-Stellvertreter. Hilde Domin hat sich in ihrer Kindheit und Jugend in einem Netz von jüdischen Bekannten, Freunden und Verwandten bewegt. Ich glaube, dass das Judentum in ihrem EIternhaus eine weitaus größere Rolle gespielt hat, als Hilde Domin sich dies eingestehen wollte.
Aber warum hat sie immer einen weiten Bogen um alles Jüdische gemacht?
Tauschwitz: Ihr Kindheitserlebnis in einer katholischen Kirche muss man durchaus ernst nehmen: dort hatte der Priester die Juden für den Tod Jesu verantortlich gemacht und sie ist schreiend vor Schreck darüber aus der Kirche gerannt. Nicht unwesentlich mag die Haltung ihres späteren Mannes Erwin Walter Palm dazu beigetragen haben. Er stammte aus einem orthodoxen jüdischen Elternhaus, gegen das er sich abgrenzen wollte, das „jüdische Gemauschel“ und die „derbe jüdische“ Sprache ablehnte, ja Hilde Domin sogar verbot, jüdische Wörter zu benutzen.
Woran sie sich nicht immer gehalten …
Tauschwitz: Nein. „Das ist nebbisch“, schrieb sie einmal, um sich dann gleich darauf zu entschuldigen. „Du weißt, dass ich auf dies miese jüdische Wort nicht verzichten mag, übersieh es gnädigst“.
Erst in der Dominikanischen Republik ist die Dichterin Hilde Domin geboren worden. Was war der Auslöser?
Tauschwitz: Domins Geburt zur Dichterin erfolgte aus großer Not heraus und in erster Linie unter dem Eindruck ihrer Ehekrise. 1951 war die Ehe nahezu zerstört. Schreiben war für Hilde Domin ein Ventil, um dieser existenziellen Ausweglosigkeit zu entgehen. Dazu kam, dass ihre Mutter in Deutschland gestorben war, sie ihr nicht hatte helfen oder beistehen können. Schreiben war gegen das Sterben anschreiben, denn Domin fühlte sich in jener Zeit dem Tod nahe. Dennoch tragen ihre Gedichte eine hoffnungsfrohe Botschaft in sich und verströmen trotz allem Optimismus und Vertrauen. Die Zuversicht des Judentums thematisierte sie explizit in einem Schreiben an Charlie Chaplin, den sie 1953 in New York kennengelernt hatte. Sie hatte ihm 1960 ein Exemplar ihres ersten Gedichtbandes ,,Nur eine Rose als Stütze“ zugeschickt und berief sich im beigefügten Brief auf ihre gemeinsame Sicht des Lebens: »Wie könnten wir anders überleben, als gemäß unserer jüdischen Tradition hinter dem Tränenvorhang zu lächeln.« Das ist das innigste Bekenntnis zum Judentum, das ich von Hilde Domin kenne.
Als Hilde Domin und ihr Mann Mitte der 50er Jahre aus dem Exil wieder nach Deutschland zurück kamen, sind sie nicht gerade mit offenen Armen empfangen worden.
Tauschwitz: Ein Leser hat mir kürzlich sein Widmungsexemplar von Hilde Domin zugeschickt, in das sie geschrieben hatte: ,,Meine müden Fuße feierten Wiedersehen mit den alten Straßen.“ Sie ist also 1954 sehr freudig, ohne Vorbehalte zurückgekehrt. Doch man hatte Vorbehalte gegen die Rückkehrer. Es liest sich fast wie ein Vorwurf, wenn Marcel Reich-Ranicki 1995 in seiner Laudatio anlässlich der Verleihung des Konrad-Adenauer-Preises an Hilde Domin sagte, dass sie das Glück hatte, „die Zeit des ‚Dritten Reiches’ geradezu in einem Paradies zu verbringen“, während viele Exilanten aus Holland und Frankreich nach Ausschwitz oder Theresienstadt deportiert wurden. Und er konstatiert, dass die meisten emigrierten deutschen Schriftsteller nicht nach Deutschland zurückgekehrt, sondern im Ausland gestorben sind. Auch Erwin Walter Palm musste Erniedrigungen nach seiner Rückkehr einstecken. Er war ein stolzer Mann, musste in Deutschland um eine Anstellung an einer Universität betteln. Nicht umsonst reisten die Palms sieben Jahre nach der Rückkehr unstet zwischen Deutschland und Spanien hin und her. Er lebte mit dem Gefühl, sich quasi dafür entschuldigen zu müssen, zurückgekommen zu sein und überlebt zu haben.
Wie hat Hilde Domin das aufgenommen?
Tauschwitz: Auch sie litt darunter. Doch sie focht ihren eigenen Kampf. Heute wird gesagt, Hilde Domin kam zurück als große Dichterin. Das ist wohl nicht so glatt gewesen. Nach anfänglich begeisterter Aufnahme wurde sie in der deutschen Literatenszene gemobbt, wie wir heute neudeutsch sagen würden. Es hat lange gedauert, bis sie breite Anerkennung fand. Die Leserschaft hat Domins Gedichte allerdings immer schon geschätzt. Und von dieser Zuwendung zehrte sie. Sie sagte, dass sie ohne die Unterstützung ihrer Leser die Situation nicht ertragen hätte.
Gab es nicht sogar Proteste von Nazis, als sich beide in Heidelberg niederließen?
Tauschwitz: Ja, ab 1961 liest man in den Korrespondenzen immer wieder von nächtlichen Drohanrufen. Der damalige Generalbundesanwalt Fritz Bauer, ein Kommilitone aus der 50er-Jahren in Heidelberg, riet ihr, still zu halten. Domin erzählte, dass nachts Neo-Nazis mit Schäferhunden vor dem Haus im Hainsbachweg patrouillerten, die drohten, die Hunde auf die Mitbewohner zu hetzen, wenn die nicht dafür sorgten, dass „diese Juden hier ausziehen“. Auch 1984 noch wurden die Palms in ihrer nächsten Wohnung nachts überfallen und bedroht.

Warum hat dies Hilde Domin nie öffentlich gemacht?
Tauschwitz: Sie scheute die öffentliche Konfrontation, fürchtete, dass das Aufleben des Nazismus in den Sechziger Jahren den Juden angelastet werden würde. Sie hatte eine große Angst vor körperlicher Versehrtheit. Die ersten Berichte aus den KZs hatten sie so geschockt, schrieb sie, dass sie 15 Jahre lang beim Anblick von nackten Menschen immer sofort die Leichenhaufen in den KZs vor Augen hatte. Erst mit den Gedichten von Nelly Sachs konnte sie die vielen Toten endlich bestatten, verwandelte sich Bitternis in Schmerz. Doch die Angst vor antisemitischen Anfeindungen blieb.
Als am 2. Weihnachtsfeiertag 1959 in ihrer Vaterstadt Köln die Synagoge mit Hakenkreuzen beschmiert wurde, sollte sie aus Protest eine Lesung halten. Warum hat sie abgelehnt?
Tauschwitz: Sie lebte zu dieser Zeit noch in Spanien, hatte Angst vor Angriffen und fühlte sich in Deutschland noch nicht heimisch genug, um schon ihre Stimme zu erheben.
Hatte Domin für sich die Klassifizierung „jüdische Lyrikerin“ akzeptiert?
Tauschwitz: Sie hätte in vieler Hinsicht widersprochen, sie wollte nie in die Reihe jüdischer Dichterinnen gestellt werden. Wir waren 2004 in Neu Isenburg. Die Lesung war sehr erfolgreich, Hilde Domin in guter Stimmung. Beim Herausgehen fragte sie, „warum hängt denn mein Konterfei zusammen mit Rose Ausländer und Else Lasker-Schüler?“ Als man ihr zur Antwort gab, dass die Lesung in der Reihe „jüdische Dichterinnen“ lief, reagierte sie verärgert: „Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht gekommen.“ Sie wollte Dichter sein, keine Exil-Dichterin, keine jüdische Dichterin – was sie ja auch nicht war.
Buchhinweis: Marion Tauschwitz: Dass ich sein kann, wie ich bin: Hilde Domin – Die Biografie, Palmyra Verlag, Heidelberg, 2009, 576 S., 28 €.