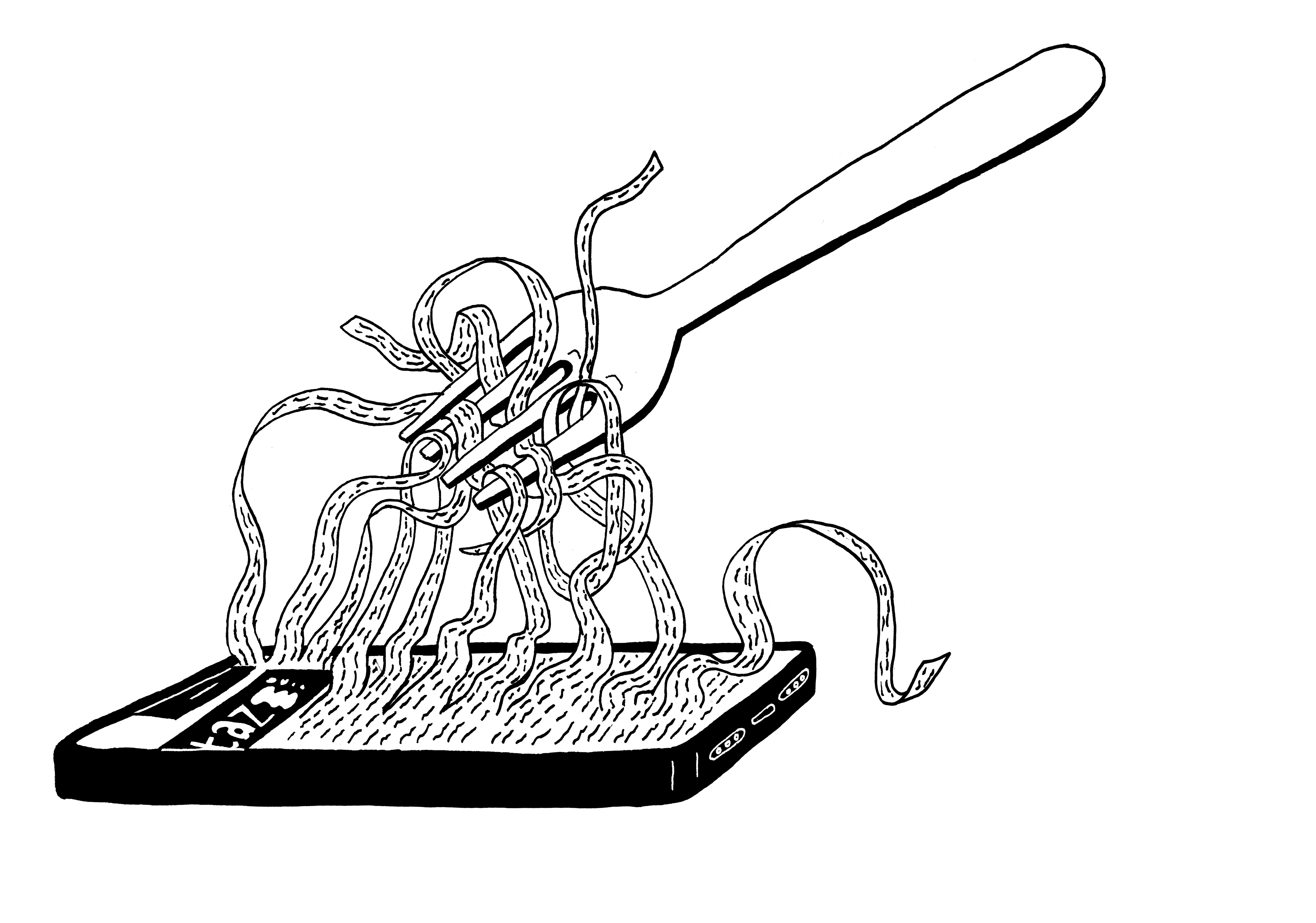Warum ist Obama schwarz? Man könnte es sich einfach machen und sagen, weil nach den Rassetrennungsgesetzen der USA, die zu seiner Geburt galten, jeder schwarz war, der „einen Tropfen schwarzen Blutes“ hatten; sowieso ein eher theoretisches Konstrukt, aber bei Obama dürfte der Anteil durchaus ununstritten sein. Ist es wichtig? Oh ja, es ist wichtig.
Es ist das einzige, was an ihm interessant und anders ist, deshalb hatte er auch die Unterstützung schwarzer Republikaner wie Colin Powell. Politisch steht er den Republikaner nicht so fern. Er beglückt die Wall Street, wird Guantanamo, wenn überhaupt, nur auf Kosten der Europäer schließen, stockt Truppen in Afghanistan auf und reduziert nicht wirklich die Truppen im Irak (die permanenten Basen bleiben); an die Krankenversicherung glaube ich, wenn sie meine erste Rechnung bezahlt. Nein, dass Besondere an Obama ist, dass er schwarz ist. Amerika redet über nichts anderes: Hat er sich im Fall des schwarzen Harvard-Professors, der von einem weißen Polizisten verhaftet wurde, eingemischt, weil er schwarz ist? Warum hat er Sonya Sotomayor ernannt? Ist er nicht wirklich Kenianer?
Amerika ist ein Land, dass von Rassen, Ethnien, Herkunft besessen ist. Natürlich haben alle die gleichen Rechte, teilweise erst auf dem Papier, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Es gibt eine gewaltige Bürgerrechtsbewegung, die dafür sorgt, dass alle rechtlichen Unterschiede und sozialen Ungerechtigkeiten beseitigt werden, unter anderem durch Affirmative Action, die schwarz- und braunhäutigen Menschen Quoten bei Jobs und an Unis garantiert. Demnächst landet so ein Fall vor dem Supreme Court, es geht um weiße Feuerwehrmänner, die sich benachteiligt fühlen. Affirmative Action ist umstritten, es gibt Argumente dafür oder dagegen, unumstritten ist, es ist Gesetzgebung, basierend auf Ethnizität (und nicht etwa, wie manche in Deutschland meinen, auf einem Status als Einwanderer).
Die meisten Amerikaner sind stolz auf ihre ethnischen Wurzeln und reden gerne darüber. Niemand fordert, man müsse verschweigen, dass John F. Kennedy der erste irischstämmige Katholik war, der Präsident wurde, obwohl es heute tatsächlich nicht mehr wichtig ist – viele Katholiken sind in hohen Staatsämtern. Auch Polen, Juden, Ukrainer, Koreaner sind stolz auf ihre Abstammung. Selbst kriminelle Banden rekrutieren ihre Mitglieder am liebsten aus der eigenen Volksgruppe (nicht ganz unverständlich, wenn man den Skandal in New Jersey anguckt; ein Italiener hätte nicht so schnell gesungen).
Früher nannte man Sklaven im Süden „Colored“, das schloss Mischlinge ein, im Norden „Negro“. Das galt als besser, deswegen gründeten Schwarze Institutionen, die „United Negro College Fund“ oder „Negro Baseball League“ hießen. Aber Negro klang manchen zu sehr nach „Nigger“. Mit der Black Panther Bewegung kam der stolze Schwarze auf, es hieß nun also „Black“. Heute ist es PC, African-American zu sagen, es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis irgendwer draufkommt, dass auch das rassistisch ist. Nennen Sie mal einen amerikanischen Juden „Israeli-American“, dann erleben Sie ihr blaues Wunder.
Ja, es wäre sehr schön, wenn es egal wäre, ob wer schwarz ist, oder Ukrainer, oder wo jemand, der Sebastian Edathy heißt, in seinem Kommentar nicht eigens betonen muss, dass er halb indischstämming ist, weil es völlig unwichtig ist. Aber das wird noch dauern. Auf dem Weg dahin können wir aber schon mit kleinen Schritten anfangen. Ich, zum Beispiel, finde es völlig egal, ob jemand, der im Prenzlauer Berg wohnt, in Schwaben geboren ist oder in Brandenburg. Und ich will nie wieder einen Artikel darüber lesen, der diese Unterschiede artikuliert.