Seit fast einem Vierteljahrhundert läuft mir immer mal wieder Henning Brandis über den Weg. Gelegentlich besucht er den Maoisten Christian Semler in der taz, wenn der nicht da ist oder gerade keine Zeit hat, begnügt sich Henning auch mit dem Aushilfsmaoisten Höge.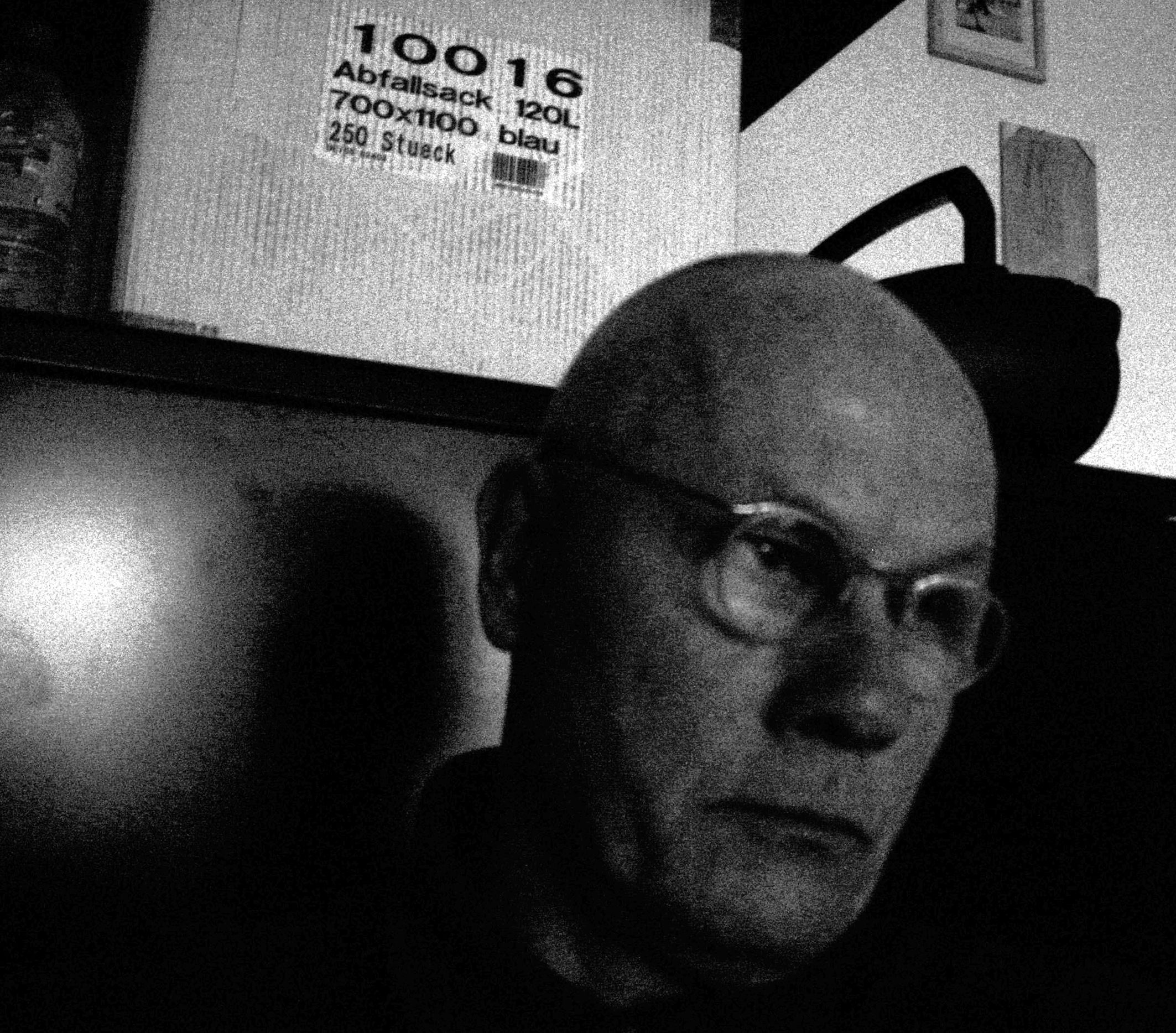
"aufs aergste gefasst bis das macht da", homage für samuel beckett, foto: natalja struve, 2004
Kürzlich sah ich mir eine Ausstellung von ihm an, da es zu spät war, anschließend noch darüber zu schreiben, ließ ich mir – rechtzeitig für die nächste Ausstellung, an der u.a. auch er beteiligt ist – seine Geschichte erzählen – für die holz-taz. Hier in dem von den redakteuren mit Jürgen Habermas so genannten „Zusatzmedium“ Internet nun die komplette Fassung davon:
1.
Bis zum 27. Februar 2010 zeigt die Berliner Galerie „Stella A.“ gesammelte Fluxus-Kunst, darunter Arbeiten von Joseph Beuys und Dieter Roth – zwei Lehrer von Henning Brandis, dem die Galerie zuvor eine Einzelausstellung gewidmet hatte:“par coeur pur“ (einfach so von Herzen).
Der gelernte Farbenlithograph Henning Brandis, 1944 in Göttingen geboren, studierte ab 1964 Kunst in Braunschweig und in Hamburg. 1966 starb seine Freundin und dann auch sein Vater, er ließ sich daraufhin mit „schweren Depressionen“ in eine Klinik einweisen, wo ihn eine Beschäftigungstherapeutin mit Leo Navratils Werk bekannt machte: einer Sammlung von Kunst von Patienten aus psychiatrischen Anstalten, „Art Brut“ später genannt.
Ab 1968 setzte Henning sein Studium bei Dieter Roth an der Kunstakademie in Düsseldorf fort. Kurz zuvor hatte dort Jörg Immendorff das Wort „Lidl“ gefunden. Im Rahmen einer „Lidl-Woche“ wurden Veranstaltungen u.a. mit George Brecht und Marcel Broodthaers in einem „Lidl-Raum“ organisiert (1973 sicherte der schwäbische Lebensmittelgroßhändler Dieter Schwarz sich den Namen „Lidl“ rechtlich ab). Henning Brandis eröffnete in Düsseldorf zusammen mit Erinna König u.a. den Lidl-Stützpunkt „Büro Olympia“ – ein angemieteter Laden, in dem sie bald eine von Majakowski angeregte Schaufenster-Agitation – u.a. gegen die Olympiade in München – entfalteten. Das Motto dafür stammte von Immendorff: „Viel Sand auf das Olympische Feuer“. Daneben setzte sich die Lidl-Truppe für inhaftierte IRA-Kämpfer ein, solidarisierte sich mit der „Indian Power“-Bewegung in den USA („Indianer sind meine Freunde!“) und Henning Brandis gestaltete zum 1. Mai einen eigenen „Erntewagen für Kuba“. Grundlage ihrer Aktivitäten war das Manifest: „Bevor man Omelette macht, muß man Eier zerschlagen!“
Nach der Akademieschließung im Mai 1969 gab Dieter Roth seine Lehrtätigkeit in Düsseldorf auf und Joseph Beuys übernahm seine Schüler. Beuys hatte zuvor zusammen mit Johannes Stüttgen und Bazon Brock die „Deutsche Studentenpartei“ (DSP) gegründet.
2.
In das „Büro Olympia“, wo inzwischen Bücher des März-Verlags und der „Neuen Kritik“ sowie Zeitungen der KPD/AO verkauft wurden, kamen Mieter aus den Stadtteilen Unterbilk und Derendorf und fragten: „Können Sie nicht auch was gegen Mietwucher unternehmen?“ Das führte schließlich dazu, dass der Laden 1970 in „Mietersolidarität Düsseldorf“ umbenannt wurde. Immendorff hatte dazu die Idee, kleine Papierhäuschen für Entmietete vor das Schauspielhaus aufzustellen, wo gerade die Premiere von Peter Weiss‘ Stück „Trotzki im Exil“ bevorstand.
Henning Brandis nahm 1972 eine Stelle als Kunstlehrer an einem Gymnasium an. Die KPD/AO bzw. deren Vorsitzender Christian Semler intensivierte den Kontakt zu Immendorff und dem Lidl-Laden: „Am 1. Mai 1971 waren wir schon in Dortmund, mit eigener ‚chinaroter‘ Seidenfahne, in deren Fängen,“ so Henning Brandis. Als sich an der Kunstakademie, wie bald an vielen Hochschulen, ein „Vietnam-Ausschuß“ (VA) gründete, sammelte er Spenden und verkaufte Plakate, Bücher, Button und Zeitungen, die von der KPD/AO-nahen „Liga gegen den Imperialismus“ kamen.
1972 wurde Joseph Beuys vom NRW-Wissenschaftsminister Johannes Rau fristlos die Professur gekündigt. Erinna König und Henning Brandis hatten da schon (als Maria und Josef Pinkterton) den Meisterschüler erhalten.
Henning Brandis „politisierte“ sich, die Kunst wurde dabei, wie er sagt, „etwas geschliffen“. Zwar unterrichtete er noch bis 1977 weiter, gleichzeitig beteiligte er sich jedoch intensiver an politischen Aktivitäten – u.a. an einer RAF-Solidaritätsdemonstration vor dem Kölner Knast und an Aktionen linker Schüler, mit einem Büchertisch und Plakaten für den VA und mit einem Videofilm auf dem „Vietnam-Kongreß“ der KPD/AO in Bonn 1973. Im Jahr darauf führte er in New York seine erste eigene politische Aktion aus: Im Supermarkt am Broadway hatte ihm eine Kassiererin aus Puerto Rico vom elenden, amerikabeherrschten Leben daheim erzählt: Mit einem innenbeleuchteten Karton demonstrierte Henning daraufhin abends auf dem Broadway für die „Freiheit der Puerto Rican People“. Später stellte er die Protestkonstruktion in einer Westberliner Galerie aus, die ein KPD/AO-Genosse von der Roten Zelle Germanistik der FU (Rotzeg) eröffnet hatte.
Seine „Düsseldorfer Malergruppe“ war von der maoistischen Partei inzwischen zum Kern ihrer „Initiative Sozialistischer Kulturschaffender“ (ISK) auserkoren worden. Diese konstituierte sich in der Kreuzberger Kneipe „Max & Moritz“ mit Sympathisanten aus Theater, Literatur, Musik und Film etc. – und verabschiedete ein „Manifest“. Anschließend fand im Rittersaal eines Schlosses bei Düren der erste ISK-Kongreß statt. Wenig später durchsuchte die Polizei die KPD/AO-Zentrale in Dortmund und beschlagnahmte die Adressenkartei. Gegen einige Abonnenten der Roten Fahne wurden Berufsverbote verhängt.
Henning Brandis zog sich 1975 aus allen politischen Aktivitäten zurück. Er blieb Lehrer, nach einer Unterrichtseinheit in der 9. Klasse über den Hungertod des RAF-Häftlings Holger Meins bekam er jedoch ebenfalls „Ärger“: Er wurde „als Kommunist am Gymnasium gebrandmarkt“: Stefan Aust interviewte für das ARD-Magazin „Panorama“ einen Schüler, der sich über diesen „kommunistischen Lehrer“ an seiner Schule besonders wortmächtig aufregte – ohne jedoch Schüler von Henning Brandis gewesen zu sein. Dieser mietete daraufhin für 25 DM zwei Stunden lang zweimalzwei Quadratmeter in der Düsseldorfer Jan-Wellem-Passage und inszenierte dort kurz vor der Bundestagswahl („Strauß gegen Schmidt“) einen „Radikalen Anlaß“. Während er den Passanten erzählte, „Ich bin denunziert worden!“, bastelte er aus Pappe einen Karton, den er sich über den Kopf stülpte. Um die „Überwachungs-Perfidie“ sinnfällig zu machen, photographierte er die Umstehenden durch ein Loch.
1977 kündigte er am Gymnasium, auf dem Hof veranstalteten die Schüler ein „Abschlußkonzert“, auf dem Henning zur Begleitung einer E-Gitarre einen „Slowest Blues as Possible“ sang. U.a. kam darin die Zeile vor: „This school looks like a concentration camp“. Die Lehrer waren konsterniert, seine Schüler lachten. Einer betreibt heute die Fünfzigerjahrekneipe „Honey Penny“ am Nollendorfplatz. Henning fuhr anschließend erst einmal zur „documenta“ nach Kassel: Dort traf er Joseph Beuys wieder.
3.
Wegen seiner „Aktion“ in der Einkaufspassage trat der „Creativ-Director“ der Düsseldorfer Werbeagentur GGK Michael Schirner an ihn heran. Über Schirner kam Henning 1977 in Kontakt mit dem Agentur-Mitbegründer Paul Gredinger, der Henning Brandis eine dreimonatige Anstellung als „Art Director“ anbot. Zum Konzept der GGK gehörte es, immer mal wieder Künstler zu engagieren, die ohne Rücksicht die Arbeit der Werbefachleute kritisierten. Vor Henning Brandis hatten bereits der Münchner Dichter Wolf Wondratschek und der Performancekünstler des Frankfurter „Bräunungsstudios Malaria“ Indulis Bilzenz diese Funktion in der GGK ausgeübt. Letzterer hatte dabei die Werber ständig mit dem marxistischen Begriff der „Faux Frais“ – wozu die Werbekosten zählen – traktiert, Henning Brandis zeichnete ihnen Ideen auf kleine Blätter und ließ sich Aktionen einfallen: z.B. eine Versteigerung von Photokopien.
Nach diesem gut dotierten Job fand er wieder zu den „schönen Künsten“ zurück. Während gegen die „Isolationsfolter der RAF-Häftlinge in Stammheim“ protestiert wurde, schloß er sich in seine Wohnung ein. Im „Deutschen Herbst“ 1977/78 beschloß er, Deutschland zu verlassen. Paul Gredinger vermittelte ihm eine erste Anlaufstelle in seinem Mailänder GGK-Büro. Bald darauf war Henning jedoch „ein richtiger, armer Emigrant“. Er fand einen Raum in einer psychiatrischen Anstalt, wo er drei Mal in der Woche mit Patienten Kunst machte. Daneben beschäftigte er sich mit der italienischen Antipsychiatrie und der „Prinzhorn-Sammlung“: Bilder, Texte und Skulpturen von „Geisteskranken“.
1978 lernte er die in Westberlin lebende Künstlerin und Dramaturgin Natalja Struve kennen, die damals gerade zusammen mit Walter Pfaff als Regisseur Heiner Müllers „Hamletmaschine“ aufführen wollte. Als sich dieses Projekt zerschlug, schrieb Henning mit Natalja ein Stück: „Der Geist des Hürli“, währenddessen pendelte er zwischen Düsseldorf, Hamburg, Hannover und Westberlin. In der „Paris-Bar“ traf er noch einmal Joseph Beuys. Beuys war in Westberlin nicht besonders gelitten. Im „Zwiebelfisch“ z.B. machte sich der Kreis um Oskar Huth, Otto Schily und den Satanisten Jes Petersen über Hennings Beuys-Begeisterung lustig. Umgekehrt mochte Beuys die Westberliner Bauunternehmer-Kunstsammler nicht. Einer der größten, Erich Marx, stellte später den Beuys-Adlatus Heiner Bastian als Kunstberater ein, der ihm zum Kauf von Beuys-Werken riet. Während diese hierbei konservativ verwertet wurden, machte sich ab 1987 ein anderer Beuys-Schüler daran, ihren politischen Gehalt zu sichern: Johannes Stüttgen – mit seinem „Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland“.
1982 versuchte Beuys zwischen beiden Polen in Westberlin noch selbst die Balance zu finden (er starb 1986). In der „Jungle World“ erinnerte kürzlich der Vorsitzende des Neuen Berliner Kunstvereins Marius Babias an dieses „Ereignis“: „Als Joseph Beuys in diesem Jahr die Ausstellung ‚Beuys, Rauschenberg, Twombly, Warhol‘ mit Werken aus der Sammlung des Berliner Bauunternehmers und Rehakliniken-Betreibers Erich Marx in der Berliner Nationalgalerie eröffnete, tobte in Berlins Stadtteilen Kreuzberg und Schöneberg der Hausbesetzerkampf. Es herrschte akuter Wohnungsmangel, da die Immobilienspekulanten die Häuser lieber leer und herunterkommen ließen, als sie auf Dauer zu vermieten, zumal die Mieten gesetzlich niedrig gehalten wurden. Diese Mietpreisbindung war soziales Regulativ und politisches Instrument zugleich; das insulare Berlin sollte für Zuzügler attraktiv gehalten werden. Eine Sanierung mit staatlichen Zuschüssen brachte den Spekulanten bei Weiterverkauf instandgesetzter Häuser höhere Gewinne ein. Wohnungssuchende besetzten kurzerhand leerstehende Häuser, setzten sie instand und verhandelten mit den Eigentümern um Verträge. Die sogenannte Berliner Linie, von der regierenden SPD getragen, bevorzugte zunächst die Besetzer; aber nach und nach setzten die Eigentümer ihre Interessen durch und die Häuser wurden polizeilich zwangsgeräumt. Indem Beuys einerseits die Hauspatenschaft des besetzten Hauses Bülowstraße 52 übernahm und sich sogar mit den Besetzern der zum Marx-Besitz gehörenden sogenannten Villa Schilla solidarisierte, andererseits aber am Abend desselben Tages auf der Vernissage die Huldigungen seines Sammlers vor geladenem Publikum entgegennahm, vollbrachte er eine diplomatische Meisterleistung.“
Ebenfalls 1982 hielt Henning Brandis im „Realismus-Studio“ der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst“ (NGBK), das damals von Barbara Straka geleitet wurde, eine Rede über die Maler Albert Oehlen und Werner Büttner. Inspiriert vom Malmaterial-Philosophen Max Dörner und dem Beuys-Merksatz „Das ganze Elend fängt schon damit an, dass einer sich Keilrahmen und Pinsel kauft,“ kam er auf die Bilder der Jungen Wilden zu sprechen, die diese wie schnelle Brötchen buckten. Über deren schnellebigen Hype, gepusht von Westberliner Galeristen und Kuratoren wie Wolfgang Max Faust, machte er sich solidarisch lustig. „Die Paris-Bar wurde zum absoluten Muß der Kunstwelt,“ frohlockte der Maler Markus Lüpertz noch 1996 in dem Berlinalefilm „Wüste Westberlin“, aber 2005 ging die Bar trotzdem pleite.

"konzert fuer schenkelbass und piano forte", st.petersburg 1991 foto: bernd sinterhauf
4.
Der GGK-Mitgründer Gredinger beendete die Arbeit in seiner Düsseldorfer Werbeagentur und zog wieder in die Schweiz zurück. Die von Henning Brandis gesammelten Arbeiten nahm er in sein dortiges „Depot“ mit. Henning selbst pendelte weiter zwischen Westdeutschland und Westberlin hin und her – in Hamburg traf er sich u.a. mit Albert Oehlen, zu seinen Anlaufpunkten in Westberlin gehörten die FU-Seminare von Dietmar Kamper und Jakob Taubes sowie die Heinrich-Heine-Buchhandlung im Bahnhof Zoo. An den Bahnhof, wo sich einst der Schriftzug „Palm-Zigarren“ befand, hängte er einmal ein Transparent – mit einem den Eisenbahnern in Ost und West gewidmete Hausbesetzerspruch: „Wir geben erst Ruhe, wenn die Schweine im All sind“.
1981 mietete er zusammen mit Natalja Struve, die inzwischen bei der feministischen Zeitschrift „Courage“ arbeitete, einen Veranstaltungsort am Klausener Platz, den sie „MBXI“ nannten (nach den Schrifttypen der IBM-Schreibmaschine in der „Courage“-Redaktion). Dort fanden dann „Lectures“, Ausstellungen und „Aktionen“ statt. Die Arbeiten beider könnte man als „Biographic Art“ bezeichnen, Henning nahm sein „Material“ jedoch vornehmlich von außen auf – in seiner „Scrap-Book“-Mentalität (den Hausarrest von Aung San Suu Kyi beispielsweise), während Natalja es eher innen suchte – und dann „Installationen“ daraus machte, ein Wort, das Henning bis heute nicht mag, weswegen er seine, manchmal nur postkartengroßen Arbeiten lieber Collagen nennt.
Bis 1992 arbeitete er mit Natalja Struve zusammen, zwischendurch trat er auf Einladung von Michael Schirner in dessen neugegründeter „Werbe- und Projektagentur“ auf, wo er das vom Fluxus und den Situationisten inspiriertes „Hürli“-Stück vorlas. Anschließend schweißte er den Text in Plastik ein und deponierte ihn in seinem „Kunstkeller“ in Berlin.
Ein andern Mal hielt er im Schöneberger „Fischbüro“ einen Vortrag – über Insekten. Diese hatte er zuvor in seiner Wohnung gefangen. Für den Vortrag klebte er sie mit Tesafilm an die Wand – und befragte sie dann einzeln: „Was habt ihr bei mir zu suchen gehabt?“ Überhaupt klebt er gerne seine Fundstücke wie in einem Herbarium auf Papier – und bezeichnet einige seiner Arbeiten auch als „Überklebungen“. In diesen Jahren entwickelte Henning Brandis eine sogenannte künstlerische Gentechnik, die er „Sektion der Passim-Clonisten“ nannte, deren einziges Mitglied er war.
1989 bekam er eine Stelle als künstlerischer Mitarbeiter bei der Berliner „Lebenshilfe“, wo er mit geistig Behinderten („Hindys“ von ihm genannt) arbeitete. Daneben kam er über eine taz-Kleinanzeige mit der Kölner „Schule für Kunsttherapie“ in Kontakt, wo er ab 1990 Seminare abhielt. Zuvor hatte der spätere Leiter der Berliner „Kunstwerke“, Klaus Biesenbach, ihn zu einer Ausstellung in 37 leerstehenden Wohnungen und Werkstätten in Berlin-Mitte eingeladen. In einer stellte Henning dann Arbeiten seiner „Hindys“ aus und veranstaltete Aktionen.
Natalja Struve hatte 1982, nach dem Tod ihrer Mutter, begonnen, sich intensiv mit der Geschichte ihrer Familie auseinanderzusetzen, die ursprünglich aus Schleswig-Holstein stammte, aber zuletzt aus Leningrad bzw. St. Petersburg kam. Von dort war Natalja Struve 1941 mit ihren Eltern erst nach Riga und dann nach Deutschland geflohen. Zuletzt beschäftigte sie sich mit dem Petersburger „Smolny“ – einem ehemaligen Mädchengymnasium, dass dann Sitz der ersten Sowjetregierung wurde: „Revolutionäre und adelige Mädchen lebten für eine kurze Zeit Wand an Wand“, schrieb Natalja, nachdem sie u.a. Interviews mit einigen noch lebenden „Smoljanken“ geführt hatte. Heute ist der einst als Kloster geplante Gebäudekomplex Verwaltungssitz der Stadtregierung. Außerdem befindet sich dort die Bibliothek des Sozialrevolutionärs Peter Struve – ein Großonkel von Natalja Struve.
5.
1993 trennten sich Henning und Natalia, im Jahr darauf verließ er die Kölner „Kunsttherapie“ und die Berliner „Lebenshilfe“. Er hatte 1989 den in Charlottenburg für „dezentrale Kulturarbeit“ Zuständigen Mathias Niehoff kennengelernt, dabei war eine neue „kunsttherapeutische Initiative“ ins Auge gefaßt worden. Henning eröffnete schließlich in der Schustehrusstraße ein Atelier namens „Zinnober“. Seine Hindys kamen dort drei Jahre lang zu künstlerischem Arbeiten zusammen, später zeigten sie diese in drei Ausstellungen in Charlottenburg. Henning hatte inzwischen die Vipassana-Meditation kennengelernt und „praktizierte“ sie täglich. Er lebte in dieser Zeit als Nomade in verschiedenen Meditationszentren und Klöstern – zehn Jahre lang: „Ich machte mich auf die Suche nach einer Verbindung von Meditation und Kunst.“ 1993 eröffnete er in der „Kulturbrauerei“ des Prenzlauer Bergs eine Dépendance der Kölner „Kunsttherapie“. „Der Bedarf dafür schien riesengroß“: 120 Leute meldeten sich zum ersten Kurs an, 30 nahmen dann daran teil. Auch in dieser Einrichtung hielt es ihn drei Jahre. Zwischendurch lebte er u.a. eine Weile im „Buddhistischen Haus“ in Frohnau, das damals und noch immer von Mönchen aus Sri Lanka verwaltet und u.a. von thailändischen Prostituierten finanziert wurde. Der dortige Abt, Bhante Devananda, bot jeden Montag einen Meditationskurs an.
Hennings Großvater arbeitete bis 1910 für eine jüdische Firma in Colombo, wo dann auch Hennings Vater geboren wurde, der ihm ein Album mit Photos von dort vererbte. Dieses Album schenkte Henning dem Abt, der es einem Museum in Colombo übergab. Neben Devananda, den Henning noch immer bei Gelegenheit aufsucht, wurden zwei weitere Meditationslehrer für ihn wichtig: Fred von Allmen, der „Einsichts-Meditationen“ und Joseph Goldstein, der „Schweige-Retreats“ anbietet. Außerdem frequentierte Henning gelegentlich das evangelische „Haus der Stille“ am Kleinen Wannsee und die Neuköllner Philip-Melanchthon-Kirche des Pfarrers Thomas Ulrich und seiner Frau Helga, die ebenfalls – als Vipassana-Schüler – Meditationen anbieten, u.a. „achtsames Gehen“.
1993 hatte Henning erstmalig das östlich von Bordeaux gelegene „Plum Village“ (Pflaumendorf) des vietnamesischen Mönchs Thich Nhat Hanh besucht, an dessen „Summer Retreat“ damals schon 300 Leute teilnahmen. Irgendwann stellte Henning dem Mönch in einem privaten Gespräch die Frage: „What is the essence between meditation and art?“ Der Mönch zeigte aus dem Fenster seiner Kammer und sagte: „Kuck dir diesen Baum an – und verneige dich!“ Henning bedankte sich und ging.
1998 bekam er durch Vermittlung eines GGK-Mitarbeiters ein kleines Haus – in einem andalusischen Dorf namens Cazorla, wo er dann eine Weile lebte. Rückblickend empfindet er die Zeit dort jedoch als „am falschen Ort“ verbracht. 1999 kehrte er nach Berlin zurück, nahm wieder auf Einladung von Natalja Struve sein Domizil bei ihr und begann eine Psychotherapie in der psychiatrischen Klinik des Theodor-Wenzel-Werks in Zehlendorf, später mietete er ein Atelier am Rüdesheimer Platz.
Er lebte jedoch weiterhin nomadisch, 2001 u.a. eine Zeitlang in der Obdachlosen-Kommune des Jesuiten Christian Herwartz in der Naunynstraße. Inzwischen war Hennings Mutter gestorben. Er ging noch einmal zurück nach Hannover, um – wenn auch quasi verspätet – Abschied von ihr zu nehmen. In Berlin hatte und hat er seit seiner letzten Therapie einen psychologischen Begleiter mit dem er freundschaftlich verbunden ist: den pensionierten Therapeuten Berge.
6.
2004 fragte ihn Barbara Straka, die damals Leiterin vom „Haus am Waldsee“ in Zehlendorf war und heute Präsidentin der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig, ob er sich nicht an der Ausstellung über „Walter Benjamin – Schrift, Bilder, Denken“ beteiligen wolle. Die Installation „Der Geist auf Rädern“ bestückten dann Natalja Struve und er gemeinsam, wobei sie sechs Fächer eines rollenden „Gestells“ unter sich aufteilten. Dessen unterer Teil stammte aus einer Bäckerei in Hannover, dessen oberen Teil hatten Studenten der HdK-Bildhauerklasse von Bernhard Heiliger zusammengeschweißt (Natalja Struve war mit dem 1995 verstorbenen Bildhauer verheiratet gewesen). Die Regalfächer bestanden aus Glasresten von Schaufensterscheiben des KaDeWe, die 1982 bei einer Demonstration von Hausbesetzern zu Bruch gegangen waren. Auf der obersten Ebene hatte Henning „Material“ aus „Walter Benjamins Aktentasche“ ausgebreitet, die dieser bei sich trug, als er 1940 nach Spanien flüchtete und dann in den Pyrenäen Selbstmord beging. Die Tasche war irgendwann nach seinem Tod verschwunden und es hatten sich etliche Gerüchte um sie gerankt.
2005 war Hennings Beziehung zu Natalja wieder derart gefestigt, dass sie eine Ausstellung von ihm in ihrer Wohnung erwog: „6121. Kleine Proben in Euro“ dann genannt. Die Zahl bezog sich auf einen Satz von Paul Gredinger, den er im Zürcher Café „Odeon“ geäußert hatte, nachdem Henning ihm euphorisch von seinem Besuch der „Art Basel“ einen Tag zuvor erzählt hatte: „Mensch, du bist jetzt 61, aber aufgedreht wie 21“. In der Ausstellung hingen Hennings Arbeiten an drei weißen Wänden, die „bricollage sédatif“, „borderline case“ und „The dark continent“ hießen. Mit letzterem bezeichnete Freud einst die Frauen. Die Adornoschülerin Elisabeth Lenk hielt einen Einführungsvortrag. Paul Gredinger erwarb anschließend die drei Wände – „komplett“.
2008 bekam Henning von Mathias Niehoff, der inzwischen Leiter der „Villa Oppenheim“ des Charlottenburger Kulturamts geworden war, die Möglichkeit, einen großen Teil seiner neueren Arbeiten in der „Villa“ zu zeigen. Die Ausstellung hieß: „Wo ‚dunkle Energie'“. Niehoff erklärte dazu dem Publikum: „In seinen eigenwillig-experimentellen Arbeiten geht Henning Brandis dem von Astrophysikern diskutierten Phänomen der ‚Dunklen Energie‘, der vermuteten Ursache für das sich kontinuierlich ausdehnende Universum, mit künstlerischen Mitteln nach“. Dazu zählten dann auch drei „Künstlergespräche“ – mit Axel Bäse, Leiter der Berliner „Kunstkanzlei“, über die „Kunst der Freundschaft“, mit dem Kölner Kunsttherapeuten Peter Rech über die Frage, „ist die Gesellschaft noch krankheitsfähig“, und mit Barbara Straka über Wanderungen in Riddagshausen „zwischen Klosterteichen und Mandelkern“ – mit letzterem waren die Amygdala gemeint: ein Teil des Limbischen Systems in unserem Gehirn.
Im Herbst 2009 bat ihn der Fluxus-Sammler Michael Behn um eine Ausstellung – in seiner Galerie „Stella A.“ in der Gipsstraße in Mitte, die Henning dann mit einer Fütterung seiner Kunstschildkröte „Héctor“ eröffnete. Neben einer Reihe von Pflanzen waren auf den collagierten Fundstücken dort auch zwei Vögel, ein ganz kleiner Jagdhund, eine traurige belgische Schäferhündin, ein weisser Traumkormoran und die Idee eines Ur-Mammuts als solche zu erkennen. Eine der Arbeiten ist der Produktion gewidmet – mit einer Forderung der Situationisten: „Abolition du travail aliene!“ (Guy Debord).
Zu seiner Ausstellung „6121“ hatte Elisabeth Lenk ausgeführt: „Wenn Henning alarmiert ist, oder sagen wir neutraler inspiriert, setzt er meist einen Anfangspunkt. Dieser Anfang könnte ein Ding sein, er ist oftmals ein Ding. Mit einem Fundstück, könnte man verallgemeinernd sagen, setzt bei Henning die inspirierte Reihe ein. Ich hatte Gelegenheit, ihn dabei zu beobachten. Den Anfang machte ein Rinderknochen. Henning legt seine Sequenzen oftmals wie eine Patience am Boden. Bald kam ein seltsamer Faden hinzu, den er auf Anhieb einen Rosenkranz nannte, der aber bei näherem Hinsehen auch die Zopffrisur eines Mädchens hätte sein können. Auffällig war nur, dass es jedes Mal aussah, als hätte Henning mit einem Tropfen Tinte gespielt bis der sich in lauter winzige Tropfen vervielfachte. All diese Gegenstände hatten die Tendenz sich zu verwandeln, vor allem das Ausgangsobjekt, von dem ich sprach. Kaum hatte es sich präsentiert, folgte eine ganze Reihe nach, die Henning bereits im Vorfeld als Sequenz kennzeichnete, indem er sie in griechische Buchstaben faßte. Eine Henningsche Reihe besteht demnach aus einem Ausgangspunkt, alpha, dem paarweise beta, gamma und dann delta, eta folgen. Das Dingalphabet kann nun, muß aber nicht, im Kopf des Betrachters ein Märchen auslösen oder besser den beschreibbar gewordenen Teil eines Märchens, dessen Rhythmus sich wiederholt wie ein Skatspiel oder eine Partie Schach.“
Im Katalog der Ausstellung „Wo ‚dunkle Energie'“ schreibt der Dramaturg Axel Bäse: Das „Rätsel“ ist ihm „das Sichtbare, das sich im Moment der Entdeckung in zarte oder heftige, versunkene oder zirkulierende Materialien, archaische Rückformungen, Farben mit feinsten Glissandi, säkulare Tonsetzungen, verschlüsselte Codes und Zeichen aus fernsten Zeiten und in Zwischenräume voller Stille verwandelt.“
Im Sommer diesen Jahres hat Henning Brandis seinen verstorbenen Lehrern Dieter Roth und Joseph Beuys gedacht – und dazu eine kleine „indianische Gabe“ im Charlottenburger Schloßpark verbuddelt.

"strumpffalke", 2005, monotypie auf karton und norwegersocke, 59x52,5,foto: natalja struve
„Wir aber wollen uns erinnern. 10 Jahre Galerie Stella A.“: Gipsstraße 4, 10119 Berlin-Mitte, Mi. – Sa.: 14°° – 19°° Uhr.
————————————————————————–
Ebenfalls vor einiger Zeit traf ich Wolfgang Dreßen – auf einem Anarcho-Treff im „Neu York“ des Bethanien-Südflügels in Kreuzberg. Er lehrte zuletzt an einer Düsseldorfer Hochschule und ist nun – emeritiert – der Partei „Die Linke“ in Düsseldorf, wo Sarah Wagenknecht in den Bundestag gewählt wurde, beigetreten. Zuletzt schrieb ich – rechtzeitig – über eine Ausstellung von ihm in Aachen. Man könnte sie als ein Großes Kunststück in einer Kleinstadt bezeichnen.
Als er mich telefonisch darauf aufmerksam machte, verstand ich nur „Isaak und der weiße Elefant“. Es ging ihm bei dieser Religions-Schau über Bagdad, Jerusalem, Aachen um „Toleranz versus Dialog“ – am Beispiel von drei Kulturen in der Zeit um 800, die Zeit um 2003 mischte dabei notwendigerweise mit..
„Ex Oriente – Isaak und der weiße Elefant“ erwies sich als eine der größten Ausstellungen, die es jemals in Aachen gab – dazu noch im so genannten Krönungssaal des Rathauses und im Dom, wo sich bis dahin noch nie eine Ausstellung ausbreiten durfte. Und dann ist der Ausstellungsschwerpunkt „Bagdad“ derzeit auch noch politisch so aufgeladen, dass es die Aachen-Touristen scharenweise zu diesem städtischen Topevent zieht. Zudem gab es anfangs jede Menge Ärger – und damit Publicity.
So hatten sich zum Beispiel im Internet-Meinungsforum zur „Ex Oriente“ auch fundamentalistische Islamisten zu Wort gemeldet. Das brachte dem Ausstellungsmacher Wolfgang Dreßen, ehemals zum undogmatischen Flügel des SDS gehörender Politologe aus Berlin, eine schriftliche Abmahnung von den „Antideutschen“ ein, die sich als Linke verstehen, gleichzeitig eine radikale Unterstützerposition der Regierungen Bush und Scharon für sich reklamieren, für die sie vor allem in den Zeitschriften Konkret, Jungle World und Bahamas warben. Ihren Vorwurf, er schüre damit den Antisemitismus, schickten sie dann auch gleich an seine Vorgesetzten, den Rektor der Düsseldorfer Fachhochschule, den Minister für Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen sowie an den Aachener Bürgermeister und den Bischof der Domstadt. Via Internet bekam Dreßen dafür Schützenhilfe von Rechten, die die „zionistische Hetze“ gegen die Ausstellung beklagten. Das Internetforum wurde daraufhin vom Minister geschlossen. Dreßen beklagte darüber hinaus einige weitere „Akte der Zensur“: So sei von kirchlicher Seite ein Video des israelischen Künstlers Eyal Sivan entfernt worden, in dem der sich kritisch mit der „religiösen Besetzung“ der Stadt Jerusalem auseinander setzte. Der Leiter des städtischen Kulturamtes warf Dreßen anschließend vor, er habe eigenmächtig das Video gegen eine andere Arbeit des Israelis ausgetauscht und das habe man nicht hinnehmen wollen. Am Ende fielen noch einige weitere Arbeiten zeitgenössischer Künstler dem Dissens zum Opfer – und die drei Kuratoren, aus städtischem Kunstamt, Dom und Fachhochschule Düsseldorf, zerstritten sich.
Worum geht es aber nun in ihrer Ausstellung? Im Jahr 797 schickte Karl der Große, der damals noch nicht der Größte war, eine dreiköpfige Friedensmission mit wertvollen Geschenken in die Kulturhauptstadt Bagdad, wo der inzwischen ebenfalls als groß geltende Kalif Harun al-Raschid herrschte (wie in „Tausendundeiner Nacht“). Nach fünf Jahren kehrte einer aus der fränkischen Freundschaftsexpedition lebend nach Aachen zurück: ihr Mitbürger, der jüdische Kaufmann Isaak. Als Gegengeschenk brachte er einen weißen Elefanten vom Kalifen mit, den Karl der Große bald auf seinen Feldzügen gegen die Sachsen einsetzte. Diese erneute beschwerliche Reise gen Norden überlebte das Tier nicht. Die erste Etappe hatte es, seinen unbekannten Führer und den Aachener Gesandten Isaak von Bagdad nach Jerusalem, von da aus nach Tunesien und von dort mit dem Schiff nach Ligurien geführt, dann weiter durch Frankreich bis nach Aachen.
In der schon 1996 konzipierten Ausstellung, die eigentlich zuerst in Köln gezeigt werden sollte, hat sich Wolfgang Dreßen, der an der Düsseldorfer Fachhochschule über Rechtsextremismus forscht und lehrt, auf die drei Städte Bagdad, Jerusalem und Aachen konzentriert. Sie symbolisieren für ihn die drei Religionen – Islam, Judentum und Christentum. Bagdad hatte damals allerdings 1,5 Millionen Einwohner, Aachen dagegen nur etwa 500, und in Bagdad – einer blühenden Handelsmetropole – fanden alle Religionen Respekt: Hier residierte nicht nur der jüdische Exilarch, sondern hier praktizierten auch Zarathustra-Anhänger, Manichäer, Christen und Buddhisten – gegen eine geringe Sondersteuer. Ohnehin war die Stadt am Tigris händlerisch eher nach Osten, nach Persien, Indien und vor allem China ausgerichtet, philosophisch aber zehrte man auch vom alten Griechenland. Ansonsten kamen aus dem Westen, genauer gesagt aus Osteuropa, vor allem Sklaven. Aus dem Reich des Aacheners, dessen Thron – aus Marmorplatten, die vermutlich aus der Jerusalemer Grabeskirche stammen – noch immer im Dom steht, wurden Jagdhunde und seltsamerweise Schwerter in den Orient exportiert.
Vielleicht versteht man jetzt, warum der rheinische Waffenexport nach Bagdad auf eine lange Tradition zurückblicken kann, die gepflegt werden will. Dreßen wollte nun mit der Ausstellung die lange Reise des Isaak „praktisch und politisch nachvollziehen“. Dass die Dom-Schatzkammerverwaltung davon begeistert war, beruhte seiner Meinung nach auf einem bloßen „Missverständnis“: Sie verstanden den Plan als Dialog, während es dem Projektmacher dabei eher um Toleranz ging. Und die Stadt machte dann mit, weil die Kirche zugesagt hatte: „Sie wollten eine Religionsausstellung“. Die Herbeischaffung der Original-Exponate wurde von der Lottostiftung Nordrhein-Westfalen finanziert. Sie stammen aus Berlin, Paris, Wien, Jerusalem und St. Petersburg: Handschriften, Landkarten, Schmuck, Stoffe, Keramik, Glas, Waffen und Devotionalien aus den Jahren um 800. Im Krönungssaal sind sie den Schaubereichen Palast, Basar und Alltagsleben in Bagdad zugeordnet. In der Dom-Schatzkammer und im Kreuzgang geht es vornehmlich um die heiligen drei Schriften und die Bedeutung von Jerusalem für die drei Buchreligionen. Im Dom schließlich wird das Karolingerreich thematisiert – bis hin zu den elfenbeinernen Überresten von Abul Abbas, dem Elefanten. Die dazwischen platzierten Arbeiten zeitgenössischer Künstler wurden aus dem Topf der Kulturstiftung des Landes bezahlt. Da dieses Geld jedoch nicht pünktlich kam, bat Dreßen die Künstler inständig, „einfach schon mal anzufangen“.
Ein weiterer Sponsor, der bereits die Aachener „Krönungsausstellung“ 2000 großzügig finanziert hatte, die Arzneimittelfirma Grünthal (Contergan), wollte mit der „Ex Oriente“ nichts zu tun haben – und konzentrierte sich stattdessen auf eine Art Gegenprojekt: „Der Aachener Dom – das Erbe des Abendlandes“. Während man in Berlin gegen Betonwände läuft, stößt man beim gediegenen, aber über die Jahrhunderte flexibel gewordenen Aachener Bürgertum laufend auf Gummiwände, meint Wolfgang Dreßen, der auf Ausstellungserfahrungen in beiden Städten zurückgreifen kann, wobei „derzeit in Aachen noch das Entsetzen überwiegt, aber es hat ja geklappt“.
Im Gegensatz etwa zu seiner „Aktion-3-Ausstellung“ – über die Enteignung jüdischen Vermögens, die in Berlin von der Humboldt-Universität kurzerhand verboten worden war. Nun hat er Teile davon in die Aachener Ausstellung eingearbeitet, und zwar die Dokumente, die Enteignungen von Aachener Juden betreffen. Gleich daneben im Dom hat der Berliner Künstler Lutz Dambeck eine Hütte im Maßstab 1:1 aufgebaut, wie sie der Radikalökologe Theodore Kaczinsky im Wald von Idaho besaß, wo er als so genannter Una-Bomber seine Briefattentate vorbereitete. Ist dies ein Beitrag über die Kehrseite der Toleranz: den Terrorismus? Etliche andere zeitgenössische Beiträge mussten dafür gestrichen oder zumindest so unglücklich platziert werden, dass man sie nun leicht übersehen kann. Im Rathaustreppenaufgang zum Krönungssaal hängen die Porträtfotos der bisherigen Träger des „Karlspreises“ (Kissinger, Reagan, Lübke), dazwischen wollte die Hamburger Fotografin Karin Plessing Porträts von ganz normalen Menschen aus der christlichen, jüdischen und muslimischen Kultur hängen, aber das war, wie auch so manches andere in diesen den Rheinländern quasi heiligen Räumen, „technisch nicht möglich“.
Erwähnt sei ferner die multimediale Installation des in der Schweiz lebenden irakischen Regisseurs Samir („Forget Bagdad“), die den Ausstellungstechnikern im Krönungssaal zu umfangreich dünkte und deswegen in einen Ratsherrensaal abgeschoben wurde. Ihr Titel lautet „White Elephant on a Flying Carpet“ und thematisiert unter anderem die letzten Kriegsbilder aus dem Irak sowie die Plünderungen der Museen von Bagdad. Ein Begleitprogramm zur gesamten Ausstellung, das ebenfalls Bögen zur aktuellen Situation schlagen sollte, wurde dagegen aus Geldmangel gestrichen. Und gleich bei der ersten Dialog-Veranstaltung kamen die vom Bischof eingeladenen Diskutanten, Moshe Zimmermann und Julius Schoeps, dem Domherren derart aktuell, dass er von weiteren derartigen ökumenischen Experimenten Abstand nahm. Unter anderem hatten seine jüdischen Gäste die Enteignungen der Palästinenser in Israel angesprochen. Wolfgang Dreßen meint: Die Kirchenleute waren sehr mutig – sie wollten aber partout nicht in der Gegenwart ankommen, wo nach dem 11. 9. zum ersten Mal nach 1945 zum Beispiel alle Daten von muslimischen Studenten in Deutschland überprüft wurden. Und, so darf man vielleicht hinzufügen, wo die Mehrzahl der Massenmedien sich freiwillig in den Dienst des Transatlantikpakts gegen Bagdad gestellt hat. In der Ausstellung findet man dazu eine Computeranimation der Geopolitik des Ölgeschäfts.
——————————————————————————————————–
Ein anderer Freund, Cam Carotta, beschäftigte sich jahrelang mit dem Neuen Testamten – und wagte dann die Frage: War Jesus Cäsar? Am Anfang dieses echten Weihnachts- und Millenniumsgeschenks stand ein Verdacht: Handelt es sich beim Christentum um einen umgemünzten Cäsarenkult? Ist das Evangelium Jesu nur eine neu verfasste Vita Cäsars – des einst als Gott verherrlichten Divus Julius? Der in Freiburg lebende Autor Francesco Carotta, genannt Cam, hat sich lange mit den lateinischen, griechischen und aramäischen Texten befasst und legt eine Fülle von Beweisen dafür vor, wie aus den cäsarischen „Siegesmeldungen“ im römischen Bürgerkrieg die „guten Botschaften“ Jesu wurden. Dieses hübsche Überraschungsei dreht die Christusforschung, die sich nur noch um Jesu-Realia bekümmert, wieder um: Hier geht es um Texte. Die Bibel hat sich in einen Buchladen verwandelt und der Glaube in Lesewut. Bei der Diskussion des Buches – unter anderem über die Internetadresse www.carotta.de – halten sich denn auch die Theologen eher bedeckt. Einige TV-Kultursendungen haben den Autor jedoch bereits für ihre Jahresendzeit-Ausgaben eingeplant. Die Archäologin Erika Simon schreibt im Nachwort: „Die enge Verflechtung dieser Religion mit dem Römischen Weltreich wurde von Seiten der historischen Forschung schon immer unterstrichen. Das Buch knüpft an diese Tatsache an, geht aber weiter und deckt neue … Zusammenhänge auf… Im Gegensatz zu Jesus war Cäsar ein Heerführer, doch unter römischen Soldaten erfolgte … die frühe Verbreitung der christlichen Religion.“ Auch die heilige Geschichte Cäsars ist uns nur über die Werke späterer Autoren bekannt. Carotta liest die Texte als „Vitae Parallelae“, als parallele Lebensbeschreibungen also. Während es bei Plutarch zum Beispiel heißt: „Pompeius war in Rom und rüstete auf. Währenddessen forderte Metellus Scorpio Caesar auf, seine Soldaten zu entlassen“, steht bei Markus (1,4): „Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden.“ Carotta schreibt dazu: „Wir haben gesehen, dass die Taufe für lustratio steht bzw. für ein als dilutum missverstandenes dilectus, also für Rüstungen und Aushebungen, dass hinter ,predigte‘, kéryssón, Caesar steckt, hinter der ,Buße‘, metanoias, Metellus, hinter den ,Sünden‘, (h)amartión, armorum, Waffen, Armee. Nach demselben Muster ist hier Rom zur Wüste geworden: Romae – erémó, ,in Rom‘, ,in der Wüste‘.“ Um gleich die Frage im Titel des Buches zu beantworten: War Jesus Cäsar? „Nein, Jesus war nicht Cäsar: Jesus ist Divus Iulius.“ Im Übrigen ist das Oberhaupt der Römischen Kirche noch heute Pontifex maximus. Mit der feierlichen Beendigung der Bürgerkriege war bereits aus dem „imperium populi romani“ das „imperium Divi Iulii“ – das „Reich Gottes“ – geworden. Mit einem Cäsarenkult, der bis Indien reichte, mit eigenen Priestern und Liturgien. Es war ein monotheistischer Gott, den Brutus da erstochen hatte. Und seine Umwandlung vollzog sich in einer Art Transkription. Erwähnt sei dazu die Polemik um Catos Selbstmord – zwischen Cicero und Cäsar. Man kennt ihre Schriften nur aus der Sekundärliteratur. Cäsar warf danach Cato vor, „er habe seine schwangere Frau Marcia dem reichen und betagten Horrensius abgetreten, um sie bald danach als reiche Witwe wieder zu heiraten, dadurch aus schnöder Habgier die Ehe zu einem Geldgeschäft erniedrigt … Nur zur Tarnung habe er Trauerkleider getragen.“ Carotta schreibt: Tatsächlich war dann „die von der reichen Witwe angeschaffte Erbschaft zu Catos persönlicher Kriegskasse geworden. Der Evangelist Markus wird Cäsars Polemik gegen Cato im Anschluss an den Afrikafeldzug vorgefunden haben. Nicht zufällig finden wir den Kern jener berühmten Polemik, in typischer Abwandlung, nach den bösen Weingärtnern, i. e. nach der Meuterei der Veteranen, wieder“. Dort (12,38-40) heißt es: „Und er lehrte sie und sprach zu ihnen: Seht euch vor vor den Schriftgelehrten, die gern in langen Gewändern gehen und lassen sich auf dem Markt grüßen und sitzen gern obenan in den Synagogen und am Tisch beim Mahl; sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete …“ Wieder und wieder wurde der Diskurs um das Mittelmeer getrieben, wenn man so sagen darf – auf Eseln. Mir hat an diesem Parforceritt am besten gefallen, wie dabei aus großen Bürgerkriegsepisoden kleine Heilungen wurden (er kam, sah und heilte) – und vice versa. Wobei dem ursprünglichen Text – der Wahrheit – nicht immer Gewalt angetan werden musste. So urteilte Markus über den Anteil der Gnade an der Heilung: „Wenn du kannst – alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ Dies ist laut Carotta „eine gute markinische Übersetzung“ des Angebots von Cäsar an Cato: „in fidem et potestatem se permittere“. Des Euhemeros‘ Gedanke – „Die Götter von heute sind die guten Herrscher von gestern“ – hat sich damit nach Meinung des Autors am Beispiel von Cäsar und Jesus bestätigt. „Mit der Konsequenz“ – am Vorabend des Jubiläumsjahres 2000 -: „dass uns runde 100 Jahre abhanden gekommen sind. Seit der Geburt des tatsächlichen Jesus – vom leidigen Problem des Jahres 0 (null) abgesehen – sind wir im Jahr 2099.“ Einmal mehr wird damit die 1989 aufgestellte These des Medienkritikers Jean Baudrillard bestätigt: „Das Jahr 2000 findet nicht statt!“
——————————————————————————————————
Über eine koreanische Freundin lernte ich die koreanische „Scene“ in Berlin kennen. Außer der koreanischen Frauengruppe gibt es hier inzwischen eine Arbeiter- und eine Studenten- sowie eine Kulturgruppe. Dort werden koreanische Tänze und Musik angeboten und Sprachkurse für die zweite Generation organisiert. Die dabei aktive Ex-Krankenschwester Jeong-Soh Rippel lud mich neulich zur Eröffnung des neuen „Zentrums für koreanischen Seon-Buddhismus“ in die Kreuzberger Oranienstraße 22 ein. Dort befand sich früher ein koreanisches Reisebüro. Der Eröffnungszeremonie – mit dem koreanischen Koan-Zen- Meister Seong Do – war eine aufwendige Restauration der zentralen Buddhafigur vorausgegangen: In strenger Klausur, verbunden mit Gebeten, hatte eine koreanische Künstlerin die Statue 14 Tage lang neu vergoldet. Dann wurde sie im Meditationsraum aufgestellt, umgeben von einem kleinen Buddha, Blumen, Obst, Kerzen und zweimal 30 roten Lämpchen in Lotusform. Der Zeremonie des „Augenöffnens“ durch drei singende und glöckchenklingelnde Mönche wohnten etwa 100 Leute bei. Meister Seong Do sagte auf englisch: „Der lebendige Zen-Geist, den wir hier gefunden haben, hat uns sehr bewegt, ebenso das Internationale.“ Anschließend begannen 30 Leute ein zehntägiges Jong Maeng Cheong Chin: eine Intensivmeditation, bei der sie sich rund um die Uhr im buddhistischen Zentrum versammelten. Morgens gingen sie als erstes mit Besen hinaus in den Görlitzer Park, um laut Frau Shu „etwas Gutes zu tun“, d. h. die Wege zu fegen – und gleichzeitig der eigenen Erleuchtung näherzukommen. Denn wenn man diese nicht erreichen kann, „dann wird jeder Grashalm zur Falle“.
——————————————————————————————————–
Eine andere Freundin nahm mich einmal mit zu einem Ritual der Brüdergemeine in Herrenhut bei Görlitz: Dabei versammelt sich die Gemeinde Ostermorgen bei Sonnenaufgang mit ihrem Bläserchor auf dem dortigen Friedhof und erinnert sich bei lauter Musik ihrer Toten:
Die zölibatären Katholiken mußten die Jesuiten erfinden, nachdem die Protestanten angefangen hatten, ihre Avantgarde auf natürliche Weise zu produzieren: in ihren Pfarrhäusern. Besonders die kinderreiche Herrenhuter Brüder war darin erfolgreich: Ohne sie gäbe es die halbe deutsche Romantik nicht und auch die Studentenbewegung wäre sehr viel ärmer gewesen. Mit Friedrich Schleiermacher, der das Geistige mit dem Geistlichen verband, könnte man von „Herrnhutern höherer Ordnung“ sprechen. Die pietistischen Brüdergemeinen stammten von den böhmischen Brüdern ab, die immer wieder vertrieben wurden und ihrerseits aus der Hussitenbewegung kamen, die als Reaktion auf die Verbrennung des Theologen Jan Hus auf dem Konzil in Konstanz 1415 entstand. Drei Kreuzzugsheere, die gegen sie aufgeboten wurden, schlugen die Hussiten zusammen, wobei sie erstmalig Bauernwagen und Pistolen einsetzten. In ihrer Hochburg Tabor setzten sie Kommunismus und Kommunion wieder ineins. Alles Geld und Gold wurde aus dem Verkehr gezogen – und gegen Waffen eingetauscht. Dies war der eigentliche Beginn der Bauernkriege und der Reformation – wie Luther selbst 100 Jahre später einräumte. Im Prager Arbeiterbezirk Zischkow errichteten die Kommunisten dem Kommandeur der Hussiten Jan Zischka zu Ehren neben einem Militärmuseum das größte Reiterdenkmal der Welt.
Das Hauptquartier ihrer Nachfolger – der Brüdergemeine – ist seit 1722 und bis heute die Siedlung Herrnhut in Sachsen, wo der fromme Graf von Zinzendorf ihnen Land zur Verfügung stellte. In Hessen erlaubte ihnen der Graf von Büdingen ebenfalls die Errichtung einer Siedlung – namens Herrenhag. Nach Protesten „seiner“ Bauern gegen die „Kommune“ hob sein Sohn jedoch das Niederlassungsedikt auf, die dortige Brüdergemeine wanderte daraufhin nach Amerika und Holland aus. In Holland gibt es, ebenso wie in Berlin – in Mitte und im Böhmischen Viertel von Neukölln – viele Herrnhuter-Gemeinden. Und die ehemalige niederländische Kolonie Surinam wurde sogar fast flächendeckend von ihnen missioniert. Sie versuchten es aber z.B. auch in Sibirien, Mongolei und Grönland und Alaska – die Exponate ihres Missionsmuseums in Herrnhut, „Völkerkundemuseum“ heute genannt, zeugen davon. In Kasachstan führten sie den Senf ein, im Himalaya die Kartoffel. Bei der diesjährigen Bundestagswahl bekam die CDU in Herrnhut 48,3% und die SPD 11%.
Die Kleinstadt „im Herzen der Oberlausitz“ hat derzeit noch 2722 Einwohner. Sie ist berühmt für ihre „Gartenhäuser“, aber auch als bescheidener Sitz des noch bescheidener lebenden Bischofs der „weltweiten Brüdergemeine“. Sein jüngster Sohn wurde nach der Wende Sprecher der Gauck-Behörde, ein Enkel spielt Schlagzeug in einer „Jesusband“. Zu DDR-Zeiten hat man einen klotzige Schule in die Ortsmitte von Herrnhut gebaut – die nun ein privates „Zinzendorf-Gymnasium“ ist. Eine weitere „Zinzendorf-Schule“ wurde 2002 in Gnadau in Sachsen-Anhalt eröffnet: „Mission vor der Haustür“ nennt man das. Daneben wird noch in Nicaragua, Tanzania, Albanien, Malawi und Lettland missioniert.
Der Spiegel spricht von „seriöser Entwicklungsarbeit“, sieht diese aber 2004 gefährdet, weil sich in Herrnhut ein Missionsverein niedergelassen hat, „der von Colorado Springs in den USA, der Metropole evangelikaler Fundamentalisten, gesteuert wird“ – in personam „von Fred Markert, einem religiösen Haudegen und Chefplaner der ‚Strategic Frontiers‘, der eine Art Missionsarmee zur Bekehrung von Nichtchristen in aller Welt aufbaut und dessen Armee-Jargon auch der Ableger in Herrnhut übernommen hat. Seine Schule, in der inzwischen Missionare für ‚Kurz- und Langzeiteinsätze‘ trainiert werden, taufte er ‚Feuerschmiede‘. Auch er träumt von einer ‚weltweit vernetzten Armee Gottes‘. Und bedient sich dazu des guten Namens ‚Herrnhut‘ sowie des entwendeten Briefpapiers der Brüdergemeine“.
In den letzten Jahren wurden die Herrnhuter, ausgehend von den Brüdern in Prag, auch noch von einem Schisma heimgesucht – das sich bis in Eigentumsklagen vor Gericht niederschlägt: Es geht dabei um Charismatik versus nüchterne Frömmigkeit. Ein Dualismus, an dem sich auch schon die Romantiker – u.a. mit Friedrich Schiller – abarbeiteten. Einmal im Jahr berichten die deutschen Intelligenzblätter über die Herrnhuter – wenn die in ihrer Kirche die Losungen für das nächste Jahr aus einer Trommel ziehen. Die Tagessprüche aus der Bibel werden hernach als Jahreskalender verkauft. Daneben sind auch noch beleuchtete Herrnhuter Advents- und Weihnachtssterne wahre Verkaufsschlager.
——————————————————————————-
Über eine kurzzeitige Liebschaft lernte ich die Berliner Ökonomie kennen. Die „Berliner Ökonomie“ changiert zwischen Kunst und Religion. Sie hat zwar eine ähnliche Reichweite wie die „Weimarer Republik“, konzentriert sich aber quasi-natürlich in der altneuen Hauptstadt – und ist eine Art Kampfbegriff von unten – gegen die neue so genannte „Berliner Republik“. Berlin wird schon seit Beginn von Auswärtigen heimgesucht: „Wanderungswellen, die gegen Europas und Deutschlands Grenzen branden, zum großen Teil von Schlepperbanden geschleust,“ wie der Altberliner Wolf-Jobst Siedler schreibt, der jedoch die alten der Stadt wohltuenden „Zuwanderer“, wie etwa Westpreußen, Hugenotten und Juden, sauber von den Emigranten der „Dritten Welt“ unterscheiden will, die seiner Meinung nach „die Misere der Hilfsarbeiter und der Arbeitslosigkeit“ in Berlin und Drumherum bloß „vermehren“. Seine Unterscheidung ist ebenso geopolitisch kalkuliert wie künstlich. Berlin war schon immer ein Anziehungspunkt für Verlierer und Versager aller Art. Zuletzt, nach 1961, zogen vorwiegend junge Schwaben und Rheinländer in den Westteil. „Rheinländer raus, Ausländer rein“, steht seit 1986 an einer Brandmauer in Kreuzberg. „Der Bau der Mauer hat auch sein Gutes gehabt: die schlimmsten Leute haben damals die Stadt verlassen,“ so Wolfgang Neuss, selbst ein begnadet Gescheiterter. Die meisten, die stattdessen kamen, hatten im Rechnen ein Fünf, aber im Malen eine Eins gehabt, dann womöglich noch den Wehrdienst verweigert und anschließend nicht mehr gewußt „Was Tun?“
Der Westberliner Senat lockte überdies mit der Rückerstattung von Umzugskosten, verbilligten Flügen nach Hause und Freikarten für den Botanischen Garten. Seit der sogenannten Wende kommen auch noch die ganzen sozialistischen Einheits-Verlierer aus der Partei, den Massenorganisationen und den Ministerien der DDR dazu. Dann all die im Westen gescheiterten Unternehmensberater, Konkursritter und Manager. „Was meinen Sie, wen wir in die Treuhand geschickt haben? Einen 50jährigen, der die Stelle eines jüngeren blockierte und zwei junge Leute, für die es nach ihrer Ausbildung keine Verwendung im Haus gab,“ verriet mir der Bankmanager Jesus Comesana aus Frankfurt am Main. Auch die Landesregierungen schickten reihenweise ihre überflüssigen Kader aus den Kanzleien nach Osten und viele Konzerne gaben sofort leichtherzig ihre bislang bloß mit Repräsentationsaufgaben betreuten Adligen an den „Aufschwung Ost“ ab. In einer Bonner Diskussion mit ostdeutschen Betriebsräten verstieg sich Heiner Geißler zu der Behauptung, „in der Treuhand sitzen aber doch nicht nur Verbrecher!“ – er meinte wahrscheinlich ‚,Versager“. Die andere Seite hatte jedoch anscheinend auch nicht gerade erste Sahne in Marsch gesetzt, jedenfalls beteuerte einmal ein IG Metall Pressesprecher, daß vor allem die „schwierigen“ und im Grunde fertigen Kollegen „mit Alkoholproblemen und sonstwas“ in den Osten gegangen seien. Man ist nur allzu leicht geneigt, dies in der allgemeinen Erfolgsorientiertheit des Westens für ein Manko Berlins bei seiner Metropolen-Werdung zu halten. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Der stetige Zustrom an Verlierern hat zu einer ganz eigenen Ökonomie in Berlin geführt. Ich bin mir dabei mit dem Neuköllner Künstler und Hobby-Mathematiker Thomas Kapielski („Einfallspinsel gleich Ausfallspinsel“) einig, daß das Funktionieren der Stadt schon lange nicht mehr auf dem Prinzip des Energieverlustes basiert – und somit eine real existierende Widerlegung des Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik ist. Dieses Phäno- men wird „Berliner Ökonomie“ genannt. Es geht dabei nämlich genaugenommen um einen kalkulierten Verlust, d.h. um Geschäfte (im allerweitesten Sinne) ohne abschätzbaren Gewinn und ohne Risiko. Wobei das Prolongieren unter Umständen bis zum Jonglieren mit Rückstellungen aus heißer Luft gehen kann und dann auch schon mal ins „Kriminelle“ lappt. Aber im Grunde ist diese „Berliner Ökonomie“ genauso „gesund“ wie, sagen wir, die Lüneburger Heide oder Maastricht. Wehr-Wirtschaftsexperten sprachen früher von einem „preußisch-protestantischen Potlatsch“ (PPP), aber das Phänomen geht inzwischen weit darüber hinaus.
Dazu ein (thailändisches) Beispiel. Sie – „Oy-Siemens genannt – hatte vor acht Jahren bereits ihren Vornamen – von „Viel Glück von Buddha“ in „Unterwegs die Sache gut machen“ – geändert, mit Erlaubnis ihrer Mutter. Das war primär ihren Querelen mit der hiesigen Ausländerbehörde geschuldet gewesen: ‚,New name, new game!“ Zuletzt wohnte sie im Wedding, schaffte aber in einem kleinen „Club“ in Hessen an, den zu pachten sie mit dem italienischen Hausbesitzer locker vereinbart hatte. Immer wenn sie nach Berlin kam, ar- beitete sie wegen der Abstandssumme noch in der Weddinger „OK Girls“-Bar und besuchte regelmäßig das Wat Thai: ein Able- ger des Klosters Wat Saked in Bangkok, das erst in einer Drei- zimmerwohnung in der Glasgowstraße domizilierte und dann in der Potsdamer Straße 147. Zwei Bonzen und vier Bonzinnen, letztere ungeschoren, „praktizieren“ dort, d.h. verrichten die Gebete und Zeremonien.
Es gibt dort einen Spendenbaum, auf den man grüne Zwanzigmark-Scheine spießt. Außerdem sieht man immer wieder junge Thai-Frauen damit beschäftigt, Geschenk-Pyramiden zusammenzustellen und hübsch einzupacken. Sie bestehen aus so nützlichen Dingen wie Dosen mit Brechbohnen, Bananen, Marsriegel, Büchsensprite, Nudeln. Dusch-Gel, Ketchup und Kaugummi, enthalten aber auch Räucherstäbchen, Kerzen und Tempo-Taschentücher. Diese Dinge werden von den Spenden- geldern gekauft, nach einer Wunschliste der Mönche und Nonnen, und ihnen dann als Pyramiden überreicht. Das Einpacken dieser Geschenke geschieht sehr gekonnt und liebevoll.
Auf einem kleinen Tisch lagen eines Tages photokopierte Flugblätter, auf denen man seinen Namen und noch etliche weitere eintragen konnte sowie eine zu spendende Geldsumme. Sie war a jenem Tag besonders gut gelaunt: ihre Vorhaben ließen sich alle gut an und versprachen, noch besser zu werden, außerdem hatte sie einige Tage zuvor beim Kartenspielen gewonnen. Die Pechsträhne vom vergangenen Jahr schien überwunden, Buddha sei es gedankt. Sie nahm deswegen im Überschwang gleich mehrere Flugblätter. Immer wenn sie in den darauffolgenden Tagen Zeit hatte, übertrug sie die (thailändischen, deutschen, italienischen und türkischen) Namen ihrer besten Freunde, Kinder und Ver- wandten aus ihrem Adreßbuch auf die Spendenlisten. Darunter waren auch viele Bekannte, die ihr größere Geldsummen schul- deten und sie nicht zurückzahlen konnten. Obwohl sie mittler- weile wütend auf etliche dieser Leute war, ließ sich nicht leug- nen, daß sie das Glück besonders nötig hatten. Sie hatte deswe- gen auch nicht vor, die hinter deren Namen eingetragenen Spen- densummen auch wirklich von ihnen einzutreiben. Sie wollte die gesamte Spendensumme selbst zahlen – alles in allem 1400 DM, etwa 30 DM für jeden, wobei sie sich selbst mit 100 DM belastet hatte und ihre Mutter in Bangkok mit 40 DM. Die ausgefüllten Spendenlisten steckte sie in ihre Handtasche. Spätestens am 6. Juni, bei einer großen Feier im Wat Thai, wollte sie das Geld übergeben. In der Zwischenzeit zerschlugen sich jedoch unerwartet ihre hessischen-Club-Plane. Sie fuhr zurück nach Berlin und mußte sich erst einmal neu sammeln. D.h. sie blieb die meiste Zeit in ihrer kleinen Weddinger Wohnung und ihre Koffschmerzen wurden immer schlimmer. Sie ging nicht mehr ans Telefon und dann auch nicht mehr arbeiten. Schließlich bot ein Freund an, ihr die 1 400 DM für das Wat Thai zu geben. Da er aber auch nicht viel Geld besaß, lehnte sie ab: „Es ist nicht gut, wenn man sich die Spende abriringen muß, dann bringt sie kein Glück“. Gleichzeitig klagte sie aber: „Wenn ich bis zum 6. nicht hingehe, I can forget Wat Thai for ever“.
In der Vergangenheit hatte sie immer reichlich gespendet, allein fünf der dort stehenden großen Buddha-Statuen stammten von ihr. Da sie in Berlin nicht mehr arbeiten wollte, ja noch nicht einmal mehr auf die Straße gehen wollte, telefonierte sie mit allen möglichen Freundinnen, die in westdeutschen Bars oder Clubs arbeiteten – und traf jedesmal irgendwelche vagen Arbeitsbeginn-Verabredungen, ließ es sich dann aber jedesmal wieder von ihrem Bekannten und ihren zwei Kindern ausreden, dort auch wirklich hinzufahren. Dafür versuchte sie anschließend umso verbissener, ihre Außenstände in Berlin und Bangkok einzutreiben – ebenfalls per Telefon, aber ebenfalls vergeblich: entweder waren die Schuldner nicht erreichbar oder gerade nicht flüssig. Schließlich ließ sie sich überzeugen, erst einmal wieder nach Bangkok zu fliegen – zurück auf Los! Um von dort aus ein neues „business“ in Angriff zu nehmen, das sie dann nach Berlin (zurück-)ausdehnen könnte. Jemand versprach ihr wenig später auch einigermaßen zuverlässig, dafür das nötige Fluggeld aufzutreiben sowie eine kleinere Summe darüberhinaus.
Dummerweise stellte sich dann heraus, daß dieses Geld erst einen Monat später, im Juli, zur Verfügung stehen würde und sie also erst nach dem 6. Juni fliegen könnte. Drei Wochen lang zappelte sie in Gedanken zwischen diesen drei unbefriedigenden Möglichkeiten: auf wenig Glück bringendes aber pünktliches Spendengeld zurückgreifen; hastig das Geld in irgendeiner westdeutschen Nachtbar anschaffen gehen (sogar ein Angebot aus Tel Aviv ließ sie sich kurz durch den Kopf gehen – 20 000 DM im Monat sollte sie dort garantiert verdienen, „aber anschließend bin ich tot – hun- dertprozentig!“); oder doch nach Bangkok fahren, wenn auch nicht mehr rechtzeitig vor dem demütigenden Verstreichenlassen des letzten Termins für die Spendenübergabe im Wat Thai. Sie wurde immer stiller, hing apathisch am Fenster und schaute auf die Straße. Gelegentlich sprach sie sogar davon, daß sie am liebsten sterben würde und daß es das Beste wäre, sie würde aus dem Fenster springen (man glaubte ihr das nicht so recht, obwohl alle sehr besorgt um sie waren). Dann bekam sie auch noch ein entzündetes Auge, wollte aber nicht – mit fremdem Krankenschein – zum Arzt gehen, sondern kurierte sich stattdessen selber – mit Tabletten, Salben und einer über dem Herd sterilisierten Stecknadel. Und dann verkaufte ihr der Imbiß an der Ecke auch noch einen schlechten Döner, woraufhin sie sich zwei Tage lang erbrechen mußte. Sonst hatte sie mit leichter Hand für sich und ihre Kinder immer die tollsten thailändischen Gerichte zubereitet, jetzt mißlang ihr sogar Spaghetti mit Tomatensoße und Hackfleisch. Als jemand sie in ein neues thailändisches Restaurant in Charlottenburg einlud, ja, sie geradezu dort hinzerrte, nörgelte sie die ganze Zeit übers Essen, über den Preis und die Bedienung (das Lokal hatte auch tatsächlich einen deutschen Besitzer, was sie, die früher selbst ein Restaurant in Moabit besaß, sofort bemerkt hatte). Ein anderer Bekannter lud sie zur Ablenkung auf seine Arbeitsstelle – das Völkerkundemuseum. Alle seine Kollegen waren dort furchtbar nett und höflich zu ihr, aber sie, die nicht gerade perfekt Deutsch spricht, hatte bald das Gefühl, daß alle bescheid wußten und sich über sie lustig machten oder sie bemitleideten oder beides. Auf jeden Fall hielt sie es nicht lange dort aus und aufmunternd war es schon gar nicht.
Am 4. Juni wa- ren die Ausweglosigkeiten schließlich so weit gediehen, daß sie entschlossen alle drei Möglichkeiten in Angriff nahm. Für den Montag verpflichtete sie sich, in einem neuen Club im Prenzlauer Berg zu arbeiten. Außerdem nahm sie sich fest vor, drei Wochen später nach Bangkok zu fliegen, wo sie Kraft, Ideen und Geld sammeln wollte, um zwei Monate darauf noch einmal ihre hessische „Club“-Idee angehen zu können. Am übernächsten Tag, am Sonntag, wollte sie erst einmal die Spendengelder – zusammen mit ihrem Anteil an einem großen Essen – im Wat Thai – übergeben. Ihr Bekannter besaß an dem Tag jedoch nur einen Verrechnungsscheck über 900 DM. Als erstes lieh er sich 500 DM von einem Kumpel, der das Geld seinerseits von seinem Girokonto abhob. Mit dem Scheck ging er zu seiner Firma, wo man ihm dafür – „einmalige Ausnahme“ – Bargeld aushändigte. Die gesamte Summe (in hundertern und fünfzigern) tauschte er anschließend bei einer Bank in grüne 20-Markscheine um. Sie hatte derweil ihre Tochter zum Wat Thai geschickt, wo man ihr 44 Umschläge gab, die speziell für die Spendengelder gedruckt und mit einem großen runden Stempel des Klosters versehen worden waren. Dann klemmte sie sich noch einmal ans Telefon und es gelang ihr, vier Freundinnen zu überreden, ebenfalls am kommenden Sonntag dem Wat Thai eine bestimmte Summe zu spenden, so daß sie anschließend einigermaßen mit sich zufrieden sagen konnte: „Ich habe 2 400 DM gespendet, das ist doch gut!“ Der Sohn mußte dann später noch im Videoshop gegenüber sowie im Lottoladen nebenan einen Batzen Zwanziger in Zehner umtauschen. Anschließend saß sie mit ihrer Tochter auf dem Teppich und sortierte das Geld, verglich es mit ihrer Liste, klebten die Umschläge zu und versah sie mit der Spendensumme sowie mit dem Namen des jeweiligen Spenders. Ihr Bekannter wurde davon so angesteckt, daß er noch 100 DM – für sich – dazu legte. In der darauffolgenden Nacht bereitete sie das Essen vor. Und früh am morgen nahm sie sich von ihrem letzten Geld ein Taxi und fuhr mit drei Töpfen sowie den Spenden-Umschlägen ins Kloster, wo sie dann wie immer guter Dinge war, wenn auch vielleicht etwas stiller und zweifelnder als sonst. Dies fiel aber nur denen auf, die in den Tagen und Wochen davor näher mit ihr zu tun gehabt hatten.
Im übrigen war es an diesem 6. Juni sehr voll im Wat Thai: „Fast alle Mädchen“ waren da und es herrschte ein Kommen und Gehen, so daß niemand groß auf irgendwelche Feinheiten achtete. Sie kniete mehrmals vor der „Nang Goag Hin Leu“-Statue und bat um Glück. Zu Hause besaß sie eine kleine Kopie davon, die auf ihrer Stereoanlage stand. Auch in so ziemlich jedem ,,Thai-Funclub“ gibt es irgendwo auf einem kleinen Altar eine Nang Goag Hin Leu, die – stets mit einer heranwinkenden Handbewegung – dabei helfen soll, Geld bzw. spendable Gäste in das betreffende Etablissement zu locken. Sie hatte sich an diesem Tag wie alle besonders fein angezogen: ein enganliegendes weißes Trikot, darüber jedoch einen züchtigen bunten Seidenkittel. Zuletzt hatte sie noch eine Spange in Käferform an ihrem Zopf befestigt, die wie eine kostbare Perlenkrone schimmerte. Weil alles so gut geklappt hatte, fuhr sie gleich im Anschluß an den Wat Thai-Besuch in den Prenzlauer Berg Club und übernahm die Nachtschicht von Sonntag auf Montag. Ihr Bekannter muffelte zwar etwas, weil er mitten in der Nacht noch Handtücher, Seife, Zahnpasta und Schminksachen für sie von zu Hause holen mußte, aber ihre wiedergewonnene herrische Art und Enschlossenheit beruhigte doch auch ihn. Selbst ihre Kinder atmeten auf, wenn oder weil auch sie sogleich wieder streng ermahnt wurden. Dem Recht auf Glück – im Sinne der (Wieder-)Herstellung einer „Balance“ in der Berliner Ökonomie, und sei es mittels „magisch-statischer Schläue“ – war mal wieder Genüge getan. Wenn auch in diesem Fall im letzten Moment und mit Hängen und Würgen.
Ob diese ganze komplizierte Spendenaktion einen einigermaßen dauerhaften Erfolg injiziert hat – für sie sowie für ihre Familie und ihre Freunde, deren Namen auf den Umschlägen standen, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. „Auch und gerade das Glück braucht eine gewisse Zeit, um voll wirksam zu werden!“ (General Giap) Außerdem ist noch nicht aller Tage Abend. Sie, die einer ihrer Bekannten einmal als „einen Tigerstaat für sich“ bezeichnet hatte, fing sogleich nach ihrer Rückkehr aus Bangkok wieder in verschiedenen westdeutschen ,,Clubs“ an zu arbeiten, mit dem Unterschied, daß sie nicht mehr jedesmal jemand von einem Ort zum anderen und zurück nach Berlin kut- schieren mußte, sie besaß jetzt eine Bahncard. Auch ihren zwei Kindern kaufte sie eine, damit sie sie im Sehnsuchtsfall besuchen konnten. Sie hatte die beiden nämlich über ihre Arbeit aufgeklärt und wenn sie zwischendurch wieder in einem Berliner „Club“ arbeitete, lud sie sie sogar abends dorthin ein, um mit ihr und den anderen diensthabenden Mädchen zusammen zu essen: entweder etwas von ihr selbst Zubereitetes oder ein bei Däng und Mo’s fahrender Thai-Küche bestelltes Fertig-Menü. Ihre beiden Kinder kamen aufs Gymnasium, dann zog die Tochter jedoch in eine Mädchen-WG und der Sohn fing an, die Schule zu schwänzen. Er trieb sich mit seinen Freunden herum. Auch mit der Künstlersozialversicherung, denen sie eine Kassette mit einem selbstkomponierten und -gesungenen Lied über ihre Jugend in Bangkok geschickt hatte, um anerkannt zu werden, klappte es nicht. Sie bat einige ihrer deutschen und türkischen Freunde, sich nach einem leerstehenden Laden umzuschauen, in dem sie ein Import-Export-Geschäft mit Textilien aus Thailand eröffnen wollte. Bis jetzt ist das passende Objekt dafür noch nicht gefunden, ihre Freunde suchen aber weiter. Einer meinte neulich: „Sie fängt 1000 Sachen an, macht aber kein Projekt zu Ende!“ Das ist übertrieben. Anfang 1997 eröffnete sie zusammen mit ihrer Schwester und zwei anderen Frauen einen eigenen ,,Thai-Massage-Club“ namens „Sun“ – in der Schönhauser Allee. Ende Februar bat sie mich, dafür Werbung zu machen: „We have no money!“ Dies ist hiermit geschehen – wobei das Wie wiederum typisch ist für die Berliner Ökonomie.
P.S.: Ob ihr noch immer dieser „Club“ gehört vermag ich nicht zu sagen. Das letzte, was ich von ihr erfuhr, war, dass sie und ihre Freundinnen seit einigen Jahren bereits nicht mehr das Wat Thai in der Potsdamer Straße, sondern das Buddhistische Haus in Frohnau für ihr Seelenheil besuchen. Ihr großen Buddha-Statuen nahmen sie mit dorthin (siehe das Photo im blog-eintrag „Hausaltäre“). Auf meine Frage, warum?, antwortete sie, Oy-Siemens, mir: „Wir haben irgendwann mal das Buddhistische Haus besucht und festgestellt, dass es von Mönchen aus Sri Lanka verwaltet wird. Und die haben keine Community hier in Berlin, die sie unterstützen, außerdem sind die Lebensmittel in Frohnau besonders teuer. So dass die Mönche da immer dünner geworden sind. Während unsere thailändischen Mönche und Nonnen immer fetter wurden. Da haben wir uns gesagt: Einige von uns unterstützen ab jetzt das Buddhistische Haus und die Mönche dort. So sind wir da gelandet.“
——————————————————————————-
So weit meine bisherigen Berührungen mit dem „Between“ von Kunst und Religion. Wobei mich bei letzterem vor allem Neodarwinismus und Kreationismus bzw. Genetik und Intelligent Design als zwei Seiten einer sektiererischen Komplementärideologie interessieren – in herzlicher Abneigung.
In Hannover und Berlin gibt es zwei anarchistische Arbeitskreise, die sich mit einer “alternativen Naturwissenschaft” beschäftigen – und vornehmlich erst mal Genkritik betreiben. Sie nennen sich “AK Anna” – und stellen ihre Diskussions-Papiere auch unter diesem Namen ins Netz. Viele sind mit “J.Djuren” gezeichnet.
In einem der Texte mit dem Titel “Warum es Gene nicht gibt: Genritter auf der Suche nach dem heiligen Gral” heißt es an einer Stelle:
“Wissenssoziologinnen bezeichnen heute die Naturwissenschaften als Religion der Moderne.”
Eine Fußnote weist dazu auf das Buch “Religions on the Mind” von Susan Leigh-Star (Stanford 1989) hin – und faßt dieses mit folgendem Satz zusammen:
“Die Religion auf dem Hochpunkt ist das die Welt konstituierende Wahrnehmungsraster, sie produziert in einem Zirkel die Wahrheiten, die ihre Wahrheit beweisen.”
Das ist alles sehr schön und gut, leider ist der “AK ANNA” bzw. “J.Djuren” in seiner Auseinandersetzung mit den “Life Sciences” so weit ich sehen kann noch nicht bis zur “Akteur-Netzwerk-Theorie” (ANT) von Latour et al vorgedrungen (maulwurfsmäßig). Er würde dort auf überraschende Weise auf Bündnispartner stoßen.
Die bisherige Rezeption der ANT und ihres Umfeldes (Haraway, Strum, Smuts, Stengers etc.) wurde hierzulande vorwiegend kritisch – von Kulturwissenschaftlern, Soziologen, Wissenschaftshistorikern und Biologen – geleistet. Das war immer ein bißchen hin auf einen neuen Theorieansatz, der eine ganze Mode werden könnte, gedacht – den man dann und mit seinen Publikationen gewissermaßen versenkte – um sich sodann einer neuen am Horizont heraufdämmernden Theorie zu widmen.
Überhaupt krankte die ANT-Auseinandersetzung daran, dass sie weitgehend universitär blieb – und sich deshalb schnell den an forschungskonjunkturen orientierten karrieren anpasste.
Peter Gente, dessen italienische und französische “Merve-Diskurse” in einigen Uni-Städten besonders nachgefragt wurden, meinte einmal: “Das ist das Schlimmste was ihnen passieren konnte. An der Uni kommen dabei höchstens ein paar Doktorarbeiten und eine unendliche Zahl Fußnoten raus.” Er hatte sich anscheinend mehr davon versprochen.
Damit will ich nichts gegen die ganzen ANT-Kritiken sagen – die einen wirklich nicht dümmer machten. Aber was bis auf ganz wenige Ausnahmen (in denen es praktisch um Ringelgänse, Muscheln und ähnliche Naturdinge geht) fehlt, das ist ein Aufgreifen. Immerhin – hat der Suhrkamp-Verlag gerade „Das Parlament der Dinge“ wieder aufgelegt, und sogar verbilligt. Hierin wird noch einmal verdeutlicht, wie die ganzen Grünen und Ökos den Darwinismus und überhaupt alle naturwissenschaftlichen „Wahrheiten“ aufs Unkritischste verwendet und als Waffe genommen haben – und dass das nicht so weiter gehen kann.
Ich erinnere mich noch, wie die Spontigruppe um Tom Koenigs, Georg Dick und Joschka Fischer beeindruckt vom plötzlichen Erfolg der bärtigen hessischen Grünen sich wochenlang in AKW-Problematik schulte und dann den Grünen beitrat. Der Kassierer versuchte in einem letzten verzweifelten Versuch die Gefahr abzuwenden, indem er vorgab, keine Aufnahmeformulare da zu haben, sie seien ihnen ausgegangen. „Kein Problem, die haben wir schon ausgefüllt mitgebracht,“ entgegnete ihm die später von den Medien als „Fischer-Gang“ bezeichnete Spontitruppe – und damit war das Unglück geschehen: Die wertekonservativen Naturliebhaber wurden rausgedrängt und die Ökologie zugunsten des parlamentarischen Durchmarschs in den Dienst genommen. Dabei hätte es genau andersherum laufen müssen: Die Ökologie hätte politisiert werden müssen.
– Jedenfalls wenn man gewillt gewesen wäre, den weisen Ratschlägen von Bruno Latour – die „politische Ökologie“ betreffend – zu folgen. Das geht aber nicht mit einer Partei, sondern nur von unten – mit einer Selbstorganisation von Bürgern, die wissen: Nur Minderheiten sind produktiv – und die deswegen keine Mehrheit werden, sondern eine Differenz etablieren wollen.
Von Latour gibt es übrigens auch einen Text im Internet – über Darwin, die Darwinisten und die Kreationisten:
Es handelt sich dabei um einen Vortrag im Rahmen der Henry-Myers-Lecture, veröffentlicht wurde er dann im Journal of the Royal Anthropological Institute – für die der Mensch ja schon laut Statut und Name die Krone der Schöpfung ist. Der Text heißt:
Werden auch die nicht-menschlichen Wesen gerettet? Ein Argument aus der Ökotheologie (http://www.bruno-latour.fr/articles/article/113-MYERS-ECOTHEO.pdf)


