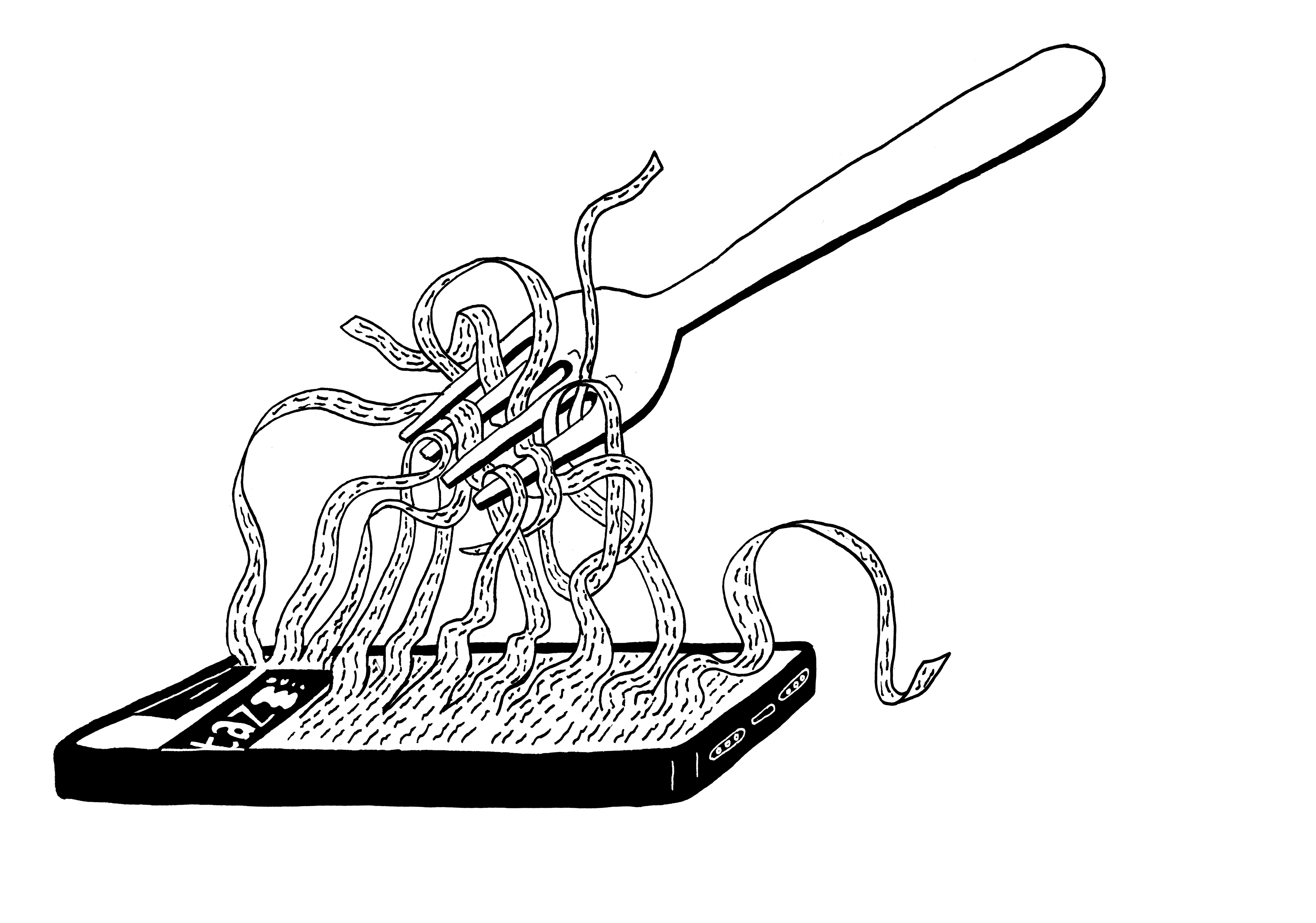Zeitlich hätte sich die neue „GroKo“ keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, um in ihrem Koalitionsvortrag den 8-Stunden-Arbeitstag zu gefährden. Mit den eigentlichen Werten einer „sozial“demokratischen Partei hat das zwar wenig zu tun, jedoch gab es so einmal mehr einen vielversprechenden Konfliktpunkt für die etablierten Gewerkschaften um den 1. Mai. Auf nahezu allen Demos des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DBG) im Land nahm der neue Koalitionsvertrag eine große Rolle ein.
Die meisten etablierten Gewerkschaften nutzen das sozialpolitische Desaster als Steilvorlage für ihre traditionelle Kritik an den regierenden Parteien. Wiederum andere entscheiden sich im Gegensatz dazu für eine generelle Systemfrage. Zu den Strukturen, die sich nicht mit der bürgerlichen Kritik des DGBs zufriedengeben, zählt auch die Freie Arbeiter:innen-Union (FAU). In Leipzig mobilisierte die anarchosyndikalistische Gewerkschaft unter dem Motto „Niemals die Wut verlieren“ zur großen 1. Mai-Demo.
Gewerkschaftliche Selbstorganisation
„Anders als der DGB kommen wir nicht so sozialpartnerschaftlich daher. Das, was dort fehlt, ist halt eine wirkliche klassenkämpferische Perspektive. Es werden die Arbeitnehmer:innenrechte innerhalb des Systems gestärkt, aber es wird leider nicht konsequent über dieses System hinausgedacht“, erklärt Gio von der FAU.
«Wir verstehen uns selbst als
antikapitalistische Gewerkschaft.
Das System, in dem wir leben, beruht auf
der Ausbeutung der Arbeiter:innenschaft.»
„Insofern ist es für uns eigentlich ganz natürlich, dass wir uns gegen diese Tendenzen stellen.“

Der DGB würde sich hauptsächlich auf sehr große Betriebe fokussieren, fährt Gio fort. Eine Aufgabe der FAU sei es daher auch, in prekären Branchen aktiv zu werden, in denen eine betriebliche Organisation nicht verbreitet ist. Dazu zählt auch die Gastro. Als Gewerkschaft versuche man, konkret in diesen Bereichen Arbeitskämpfe zu führen. „Wir haben zum Beispiel schon jetzt in diesem Jahr ca. 30.000 Euro für Mitglieder erstritten, wir haben mehrere Abfindungen erkämpft, Betriebsgruppen und Betriebsräte aufgebaut.“
Tatsächlich steht die FAU historisch in der Tradition der Selbstorganisation. Als kämpferische Struktur entstand schon 1919 die Freie Arbeiterunion Deutschland (FAUD), die in den 20er-Jahren, vor allem im Ruhrgebiet, aufgrund von Masseneintritten sechsstellige Mitgliedszahlen verzeichnen konnte. Schon damals mit dabei: Die Forderung nach autonomer Selbstverwaltung der Arbeiter:innenklasse.
In Leipzig hatte sich die FAU 2017 neu gegründet. Seitdem kämpfen zahlreiche Betriebsgruppen gegen die Ausbeutung in den Betrieben – mit Erfolg. Erst Mitte April zahlte ein Logistikunternehmen nach einer rechtswidrigen Kündigung eines FAU-Mitglieds eine Abfindung in Höhe von 4000 Euro, wenige Wochen zuvor wurden einem Mitglied insgesamt 150 Überstunden nachträglich ausgezahlt.

Die betriebliche Zentrierung scheint sich zu lohnen. Inzwischen zählt die Leipziger FAU zu den größten Ortsgruppen der Gewerkschaft.
«Wir wollen den Leuten auch so ein
bisschen die Ohnmacht vom Politischen
nehmen und uns konkret für ihre eigenen
Interessen in ihrem Betrieb einsetzen.»
Die FAU sehe sich jedoch nicht als Konkurrenz zu anderen Gewerkschaften: „Wir sehen uns eher als eine andere Art der Organisierung, als eine andere Art der Bewegung.“ Eine Positionierung direkt an der Basis sei daher alternativlos. Dennoch sei jede Form von gewerkschaftlicher Organisation besser als gar keine, ergänzt Gio.
Internationalistischer Syndikalismus
Auch in anderen Teilen der Welt gingen am 1. Mai Tausende für die betriebliche Selbstorganisation auf die Straße. In Spanien mobilisierte bspw. die Confederación Nacional del Trabajo (CNT) zu dutzenden Demonstrationen. Wie auch die FAU gehört die CNT zur International Confederation of Labour (ICL), einem Zusammenschluss von zahlreichen anarchosyndikalistischen Strukturen auf der ganzen Welt.
„Die internationale Arbeit der FAU setzt vor allem an der Organisation mit anderen syndikalistischen Organisationen an“, erklärt die Gewerkschaft. Zentral wäre neben dem gemeinsamen Austausch auch die gegenseitige Unterstützung bei Kämpfen gegen Repression, Unterdrückung oder Ausbeutung.

Ein Beispiel für diese internationalistischen Kämpfe ist die gewerkschaftliche Unterstützung von Arbeiterinnen in Myanmar. Den betroffenen Frauen wird dort der Zugang zu Menstruationsprodukten innerhalb der Nähfabriken, in denen sie arbeiten, verwehrt. Zuletzt machte die FAU im Rahmen des feministischen Kampftages am 8. März in einigen deutschen Städten auf die desolate Lage der Fabrikarbeiterinnen aufmerksam. „Die Genoss:innen in Myanmar leisten derzeit unter widrigsten Umständen feministische Gewerkschaftsarbeit“, erklärt die Freie Arbeiter:innen-Union.
Der Dachverband der Allgemeinen Arbeiterinnen Myanmars (FGWM) kämpft aktuell mit einer Arbeitsgruppe der ICL darum, der prekären Lage der Fabrikarbeiter:innen international Gehör zu verschaffen und die Situation in den Fabriken zu verbessern. Beide Strukturen fordern daher unter anderem eine flächendeckende Versorgung von Menstruationsprodukten in den betroffenen Fabriken, sowie einen bezahlten Menstruationsurlaub.
Wie auch in Bangladesh versucht die ICL weltweit progressive Veränderungen zu erkämpfen. In seinem Selbstverständnis erklärt das Bündnis, man müsse „ein radikales Projekt gesellschaftlicher Veränderung“ schaffen, das internationale Kämpfe auf lokaler Ebene verankert – auch mit Hilfe von Arbeitskämpfen fernab von etablierten Gewerkschaften oder staatstragenden Parteien. Ähnliches prägte auch in Leipzig den O-Ton der Redebeiträge am 1. Mai maßgeblich. Die Zeiten seien hart. Man müsse klassenkämpferisch handeln und die Betriebe selbst in die Hand nehmen, so die FAU.