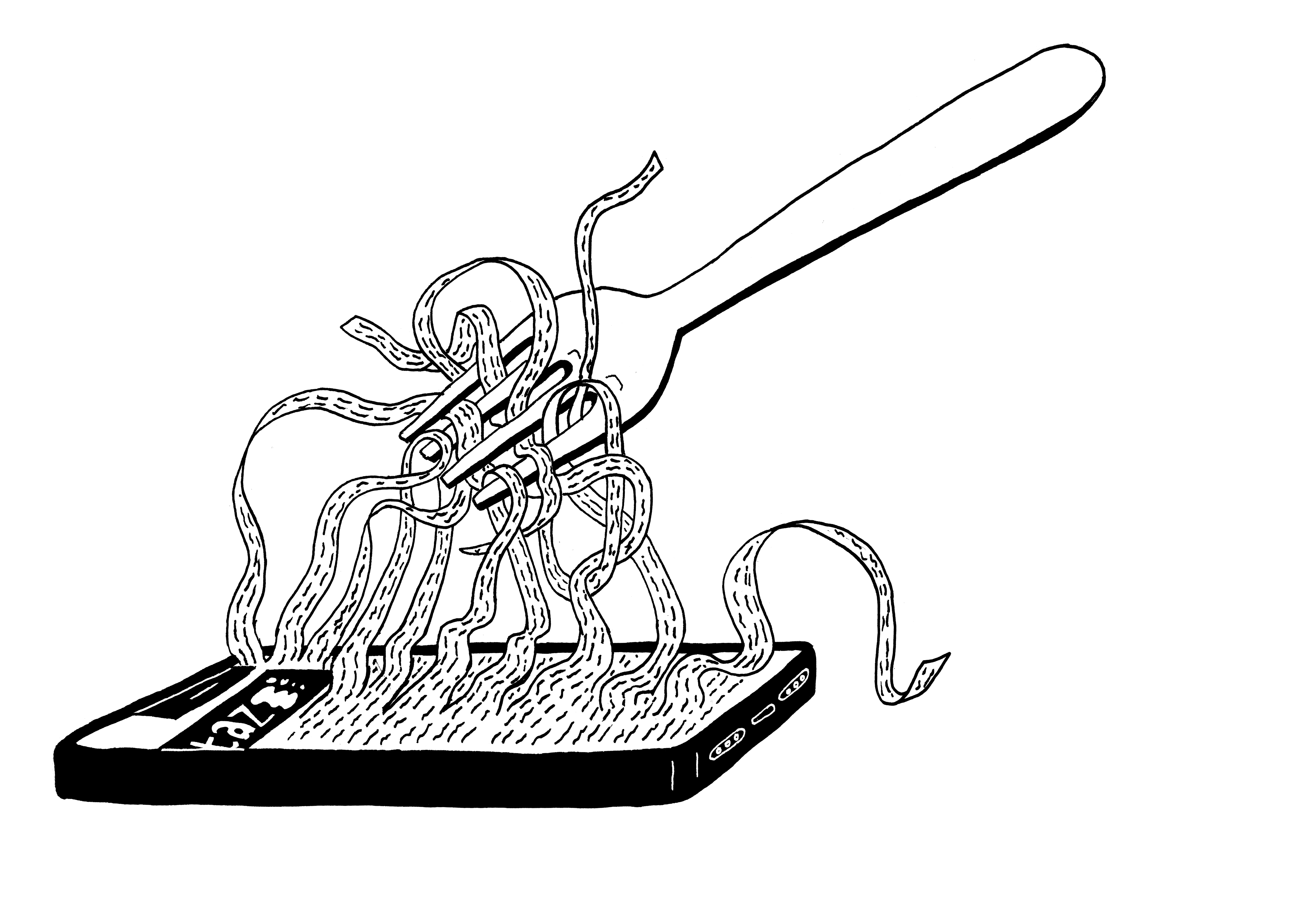In der taz wird häufig darüber diskutiert, wie Sprache antisexistisch eingesetzt kann. Das fängt damit an, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen auch sprachlich mitgenannt werden, und geht heute auch so weit, dass wir überlegen, wie man Menschen, die sich keinem dieser Geschlechter zuordnen, mitbenennen kann. Das Binnen-I ist in der taz bereits lange eingeführt und es steht AutorInnen frei, ob sie es benutzen wollen. Neuerdings fragen wir uns, wie mit dem Gender Gap umzugehen ist, schreibt man Autor_Innen? Oder Autor_innen? Oder Autor*innen? Kann man das Sternchen einfach irgendwo hinsetzen?
Immer wieder kommt in der Diskussion auf, dass mit all diesen Lösungen Texte unleserlicher werden und dass doch die männliche Form als Grundwort alle mitmeint und nicht nur die Männer. Der Argumentation kann ich meist nicht folgen, denn selbstverständlich schreiben wir die Apple-Geräte brandingkonform „iPad“ und „iPhone“ ohne dass jemand meint, damit sei die deutsche Sprache endgültig nicht mehr lesbar. Dass das generische Maskulinum einfacher und platzsparender ist, ist nachvollziehbar, aber sind Menschen, die keine Männer sind, wirklich mitgenannt?
Selten – eigentlich gar nicht – wird diskutiert, ob das generische Femininum eine Alternative wäre, also nur die weibliche Form von Wörtern zu verwenden und damit alle Menschen zu meinen. Das Wort „Autorinnen“ ist nur geringfügig anders als AutorInnen oder Autor*innen und – ganz streng genommen – ist „Autoren“ darin auch enthalten.
Ich habe das mal in einem Artikel ausprobiert. Und siehe da, als wir ihn auf Facebook posteten beschwerten sich eine ganze Reihe Männer darüber, dass es hier wohl nur um Frauen gehe – eine Vorstellung, die bereits aus dem Kontext als völlig absurd zu verwerfen gewesen wäre.
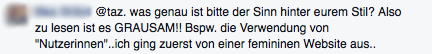
Es waren natürlich sowohl Männer als auch Frauen zur Stelle, die das generische Femininum erkannten.
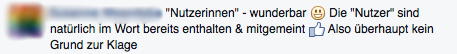
Sie erklärten den Empörten auch, dass hier Männer mitgemeint seien, die dann mit absurden Übertreibungen antworteten. Wahrscheinlich wollten sie so das generische Femininum lächerlich machen.
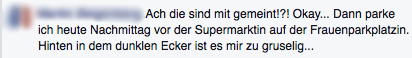
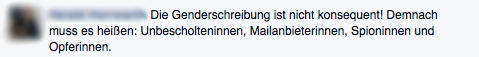
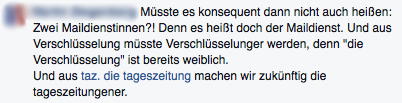
Ein Nutzer, der das alles für „albern“, „unleserlich“ und „Wahnsinn“ hält, hatte einen Flashback an seine wohl sehr traumatische Schulzeit und überlegte, ob das generische Maskulinum nicht sogar eine Benachteiligung der Männer sei. Jedenfalls solle man nichts anders machen.

Ein anderer verwies darauf, dass man die weibliche Form nicht so nutzen dürfe, weil sie traditionell ganz anders genutzt worden sei. Außerdem findet er, dass Feminist*innen sich nicht einig genug sind, wie Sprache zu nutzen sei. Jedenfalls solle alles so bleiben wie es ist – mit Exkurs in die Quantenphysik und die Jahrtausendwende.
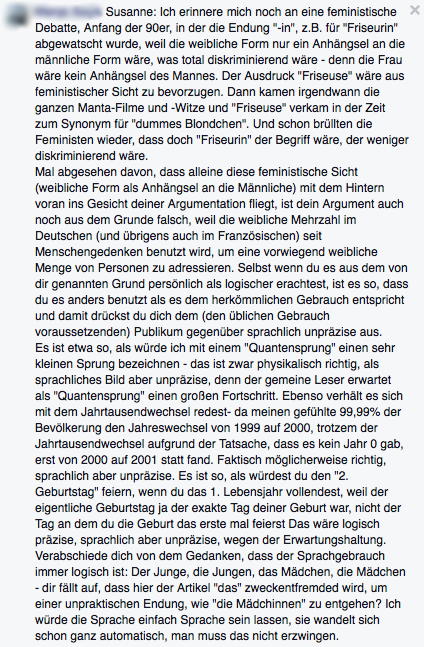
Der Kreis der Absurditäten schloss sich dann, als ein Nutzer sogar vorschlug, weiter im generischen Maskulinum zu schreiben und die Frauen mitzumeinen. Das sei angenehmer zu lesen.
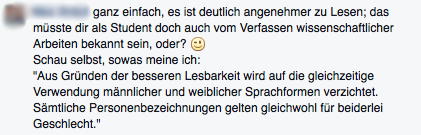
Als Fazit bleibt es nur noch, einer Nutzer*in das letzte Wort zu überlassen und gemeinsam mit ihr zu bedauern, dass bei der ganzen Diskussion die Inhalte des Artikels gar nicht vorkamen.
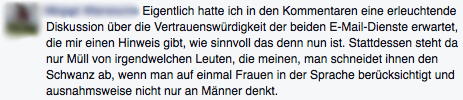
Die Diskussion darum hat jedenfalls deutlich mehr Zeit gekostet, als ich brauchte, um den Text so zu schreiben. Und die paarmal fünf Buchstaben mehr haben viel weniger Platz im Internet verschwendet, als die vielen lustigen Plädoyers verunsicherter Männern dafür, alles doch einfach so zu lassen, wie es ist.
Im Bild: Schreiende Schwalbenküken (dpa)