„Der ehemalige chinesische Bauer Wei Jingpeng lebt davon, dass er im Gelben Fluß Wasserleichen einsammelt – und sie an die Angehörigen verkauft, viele dieser Toten wurden ermordet“. (dpa)
Während die Männer immer erbitterter um Wasserrechte kämpfen, erfreuen sich die Frauen eher am feuchten Element. Dennoch sind 70% aller Wasserleichen Frauen.

Als „Wasserleiche“ bezeichnen die Esoteriker totes Wasser. Das von ihnen favorisierte Gegenteil nennen sie „Aqua Viva“. Claudia Basrawi, die demnächst in den Berliner Sophiensälen ein Theaterstück zum Thema aufführt, schreibt in ihrem Prospekt: „In dem Stück ‚Wasser‘ geht es um die Erscheinungsvielfalt des Wassers und um die Symbolik, die sich durch seine kulturgeschichtliche Bedeutung entwickelt hat und damit auch um seine ökologische Dimension.“ Die Autorin zitiert dazu aus Hartmut Böhmes „Kulturgeschichte des Wassers“: „Wer mit der Erscheinungsvielfalt des Wassers vertraut ist, wird leichter einräumen, dass jene Trennung von Subjekt und Objekt, wie sie für die neuzeitliche Wissenschaft kennzeichnend wurde, ein Irrweg ist, oder zumindest nur zur halben Wahrheit führt.“ Claudia Basrawi hat in diesem Sinne ebenfalls mit Wasser experimentiert:
„Im Jahre 2008 machte ich mich auf den Weg nach Marokko, um mit dem Berliner Künstler Christoph Keller, ein ‚Mad-Scientist‘ Projekt zu realisieren. Das französische Kulturinstitut hatte uns eingeladen. Es ging darum, mit einem Cloudbuster (engl. Wolkenbrecher) à la Wilhelm Reich, in einem Dorf im mittleren Atlas-Gebirge, Regen auszulösen. Die Menschen, die dort leben sind vertraut mit dem Wesen des Wassers. Das Land erlebt immer wieder sowohl längere Dürreperioden als auch heftige Unwetter, bei denen sich ausgetrocknete Flussbetten in reißende Ströme verwandeln. Riesige Staudammprojekte verhelfen lediglich einigen internationalen Großkonzernen zu enormen Gewinnen. Die Marokkaner kennen andere Wege in einer Dürreperiode Regen zu erzeugen. Dazu gehört auch das vorislamische Regengebet, bei dem die gesamte Bevölkerung des Landes für Wasser betet, und dabei die Kleidung von innen nach außen gewendet trägt. Eine Sache, an die man glauben muss, sagte uns ein Marokkaner, nur dann kann sie funktionieren. Unser Cloudbuster hat funktioniert. Es regnete mehrere Tage. Dann mussten wir unseren Versuch abbrechen, da es sowohl für die Bewohner des Dorfes, die uns bei diesem Experiment unterstützen, als auch für uns selbst zu nass wurde. Seither beschäftige ich mich mit dem Thema ‚Wasser‘.“

Unter „traumdeuter.ch“ findet sich die Bemerkung: „Wasser wird in der Traumdeutung üblicherweise als Symbol für alles Emotionale und Weibliche verstanden. Es ist eine geheimnisvolle Substanz, da es durch, über und um Dinge herum fließen kann.“ Es gibt dazu inzwischen eine ganze feministische „Wasser-Theorie“ – von der US-Anthropologin Elaine Morgan: Sie meint herausgefunden zu haben, dass es die Frauen waren, die nach Verlassen der Bäume erstmals Schutz vor ihren Feinden im Wasser suchten. Dort lernten sie den aufrechten Gang, die Schmackhaftigkeit der Meerestiere, bekamen eine glatte, unbehaarte Haut, veränderten sogar ihre weibliche Anatomie und wurden intelligent und verspielt. So wie im übrigen alle Säugetiere und Vögel, die wieder ins Wasser zurückgingen: Delphine, Otter und Pinguine beispielsweise. Während die Männer dagegen quasi auf dem Trockenen hocken blieben – und dabei jede Menge Jäger-Idiotismen ausbildeten. Elaine Morgans Studie endet jedoch versöhnlich: ‚Wir brauchen weiter nichts zu tun, als liebevoll die Arme auszubreiten und ihnen zu sagen: Kommt nur herein! Das Wasser ist herrlich'“! (1)

Astrologen haben gerade den ersten Planeten entdeckt, auf dem es möglicherweise Leben gibt. Sie tauften ihn provisorisch „Gliese 581g“. Er ist 20 Lichtjahre entfernt von der Erde, der schrecklich trockene „Tagesspiegel“ schreibt: „Dort könnte es flüssiges Wasser geben – und damit auch Leben.“
Auf unserem Planeten wird dagegen vielerorts das Wasser knapp – und damit immer teurer. Es bedeckt rund 2/3 der Erdoberfläche und auch unser Körper besteht zu etwa 2/3 aus Wasser – mit zunehmendem Alter wird es allerdings weniger. Mehrere Sachbücher befassen sich bereits mit den weltweiten Wasserproblemen:

2002 veröffentlichte die indische Umweltaktivistin Vandana Shiva ein Buch mit dem Titel „Wasserkriege“, das schon im selben Jahr auf Deutsch erschien – unter dem Titel „Der Kampf um das blaue Gold. Ursachen und Folgen der Wasserverknappung“.

In der Rosa-Luxemburg-Stiftung gründete sich 2006 ein monatlich tagendes „Wasserkolloquium“. Dieses gab 2008 eine Aufsatzsammlung heraus: „Wasser – Die Kommerzialisierung eines öffentlichen Gutes“. Die „wettbewerbsorientierte Umstrukturierung des Wassersektors“ begann in den 1990er Jahren,“ heißt es in der Einleitung. Diese „Umstrukturierung“ ist die vorläufig letzte einer umfassenden „Privatisierung“, die bereits vor etlichen hundert Jahren begann: Erst wurde das Gemeindeland privatisiert, was zu einem Weideverbot führte, dann die Jagd, die Fischerei und schließlich das Holz im Wald, inzwischen muß man sogar vielerorts fürs Pilze- und Blaubeerensammeln zahlen. Nach der Französischen Revolution sprach sich deswegen der „Utopische Sozialist“ Charles Fourier bereits für ein „bedingungsloses Grundeinkommen“ aus – als Kompensation für all die „Naturschätze“, auf die die Menschen einst zugriffen, um ihr Überleben zu sichern und die dann sukzessive von Privatpersonen an sich gerissen wurden, um daraus ein Geschäft zu machen. Mit der „Umstrukturierung des Wassersektors“ in den Jahren der Wende artikulierte sich langsam auch der Bürgerprotest dagegen. Ende 1989 berichtete der Spiegel: „Bundesweit formierte sich Protest gegen die westdeutsche Wasserpolitik“. 1992 hieß es: „Umweltschützer fürchten, daß in der ehemaligen DDR die letzten Vorkommen sauberen Wassers geplündert werden“. Und 1993 schrieb der Spiegel: „Den Ballungsräumen droht das kostbare Naß auszugehen. Statt Wasser zu sparen, wird es von weit hergeschafft, das Umland trocknet aus.“ Immer mehr Journalisten und Wissenschaftler stürzten sich auf das „Thema“ Wasser.

2010 veröffentlichte die Hallenser Politikforscherin Petra Dobner ein Buch über die globale Trinkwasserkrise: „Wasserpolitik“. Es „macht die komplexen Dimensionen der globalen Wasserkrise sichtbar und verfolgt die Entwicklung von der öffentlichen Daseinsfürsorge zu Strukturen globaler Governance – eine Entwicklung, die eng mit theoretischen Auffassungen über die Bedeutung der Allmende, die beste Art der Gemeinwohlsicherung und die Möglichkeiten politischer Steuerung verknüpft ist,“ schreibt ihr (Suhrkamp-)Verlag im Klappentext.

Erwähnt sei ferner das neue Buch des Ökonomen Erik Orsenna: „Die Zukunft des Wassers“. Der Autor hat sich „vom Wasser mitreißen lassen“ und sich weltweit umgetan, wie die Menschen damit umgehen, d.h. wie sie es verschwenden und anderen wegnehmen. Natürlich sind die Europäer und besonders die Amerikaner, die nach jedem Petting bzw. Quicki erst mal duschen müssen, die größten Wasserverbrecher.

Wo Verbrechen vermutet werden, da sind auch die Kriminalroman-Schriftsteller nicht weit. 2006 meldete „arte“: „Auch in Kanada schlagen Umweltschützer jetzt Alarm : Denn die USA mit ihren Giganten-Städten im trockenen Westen sehen ihre eigenen Frischwasservorräte schrumpfen und Präsident Bush schielt durstig auf die Grossen Seen.“ Konkret: eine rücksichtslose Truppe reicher US-Investoren. Sie sehen ihre Wasserentnahme-Pläne durch Aufklärung und Mobilisierung der Öffentlichkeit gefährdet – und schlagen zu. Davon handelt der „Quebec-Krimi“ der kanadischen Umweltexpertin Varda Burstyn: „Blut für Wasser“. Hier zeigt sich allerdings der Mangel an einem ausländischen „Regionalkrimi“: Die ganzen kanadisch-amerikanischen „Parteien“ (Ökos, Politiker, Unternehmer), die in Burstyns Krimi aneinander geraten, kann ich mir kaum vorstellen, auch nicht, dass ehrgeizige Investoren Umweltschützer, die über ihre Pläne in kleinen Öko-Zeitschriften berichten wollen, einfach von „Profis“ umbringen lassen – per Hubschrauber und mit Raketen sogar.

Der andere „Wasserkrimi“ – von Wolfgang Schorlau – heißt: „Fremde Wasser“ und spielt in einer Berliner Konzernzentrale, die mit zunehmend ins Kriminelle lappenden Methoden überall auf der Welt Wasserwerke privatisiert. Der Nachspann klärt darüber auf, das es sich dabei um die Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke (RWE) handelt.

Auf der Internetseite des Aufklärungsfilms von Leslie Franke und Herdolor Lorenz: „Wasser unterm Hammer“ findet sich ein Zitat des Stuttgarter Krimi-Autors Wolfgang Schorlau: „Ihr sensationell guter Dokumentarfilm war mir eine wertvolle Quelle. für meinen neuen Roman ‚Fremde Wasser‘.“ Inzwischen haben die beiden Filmemacher einen weiteren Wasser-Film gedreht: „Water makes Money“. Daneben liefen auf arte bisher mindestens ein Dutzend weitere Dokumentationen über Regionen mit Wasserproblemen, einer z.B. über den Wassermangel von Las Vegas, der Stadt mit dem höchsten Wasserverbrauch und ein anderer, der einen Rundumschlag versucht: „Gegen den Strom“.

Der grüne Oberbürgermeister-Kandidat in Stuttgart, Rezzo Schlauch, schrieb über Schorlaus Wasser-Krimi: „Öffentliche Daseinsvorsorge als Thema eines Krimis? Muss das nicht schief gehen? Nicht im Krimi ‚Fremde Wasser‘ von Wolfgang Schorlau. In diesem Buch geht das Kapital buchstäblich über Leichen. Zunächst ist eine widerspenstige Abgeordnete dran, später beinahe der Privatdetektiv selbst, und wenn es nach dem Oberschurken ginge, wäre auch ein kleines Massaker in Bolivien im Sinne der Rendite durchaus willkommen.“ (2)

In Stuttgart selbst spielt ein „Wasserkrimi in Fortsetzung“. In der letzten Vorbemerkung dazu heißt es: „Oberbürgermeister Schuster trommelt: Die Stuttgarter Wasserversorgung sei „zukunftssicher, kommunal und verbraucherfreundlich“. Er schlägt dazu eine Grundsatzvereinbarung mit der REG (EnBW regional) vor, bei der das Wasser (konkret: das Wasserbezugsrecht) und die Wasserversorgung (konkret: die Leitungen und Wasserspeicher) ab 1.1.2010 je zur Hälfte der Stadt und der REG gehören sollen. Das entspricht aber nicht der Forderung aus der Bevölkerung nach komplettem Rückkauf des Wassers. Die Forderung, die auch von der LINKEN unterstützt wird, ist Rückkauf zu 100 Prozent. Die SPD überzieht seit Wochen die Stadt mit Plakaten und Veranstaltungen mit der falschen Behauptung: ‚Wir holen unser Wasser zurück!‘ Schön wär’s! Fakt ist, dass die SPD der 50:50-Lösung zugestimmt hat, noch bevor überhaupt im Gemeinderat die Beschlussvorlage des OB vorlag, um sich damit die Zustimmung zur Kapitalerhöhung bei der Landesbank versüßen zu lassen. Das Bonbon könnte sich aber als giftig erweisen.“

Rezzo Schlauch diskutierte in seiner taz-Krimirezension nur die Wasser-Alternative „Staat oder Markt“, in Berlin geht es aber z.B. um die Vergesellschaftung der Wasserversorgung – nach ihrer Teilprivatisierung durch verbrecherische Kommunalpolitiker, mit der man nicht einverstanden ist, stattdessen sollen die Wasserwerke in eine Genossenschaft überführt werden: Wasser gehört in Bürgerhand! Volksbegehren ‚Unser Wasser'“ so lautet dazu die Parole. (3)

Ähnliche „Wasserkrimis“, auch um noch nicht privatisierte Wasserversorgungsanlagen, spielen sich derzeit in vielen Regionen Deutschlands ab. Im Oderbruch geht es dabei u.a. um den Biber, von dem die einen behaupten, er würde die Deiche zerstören und das Land wiedervernässen, deswegen müsse man seine Populationen reduzieren, während die anderen – Naturschützer – mit ihm für den Regionaltourismus trommeln. In anderen Regionen wird vor der Verkarstung der Landschaft gewarnt, weil die Großstädte zu viel Wasser von dort abpumpen. Und ständig mehr brauchen.

Um so seltsamer mutet eine Meldung aus dem Spiegel (vom 27.9.2010) an:
„Die Deutschen verbrauchen zu wenig Wasser und richten damit Schäden an. Trotzdem erwägt die EU, sie zu noch mehr Sparsamkeit zu drängen. Es drohen Preiserhöhungen um 25 Prozent. Die Deutschen scheiterten in den vergangenen 20 Jahren daran, alle Einsparmöglichkeiten für Sprit und Strom zu nutzen. Beim Wasser waren sie dafür umso gründlicher. Sie statteten ihre Klos mit Spartasten fürs kleine Geschäft aus, trennten sich von verbrauchsintensiven Waschmaschinen, bauten sich Regenwasserzisternen in den Garten. Viele dieser mittlerweile weit über eine Million Anlagen werden sich nie amortisieren, weil mit dem eingefangenen Wasser oft nur ein paar Stiefmütterchen gegossen werden. Doch beim Wassersparen verzichten viele Bürger auf Kosten-Nutzen-Rechnungen. So schafften es die Deutschen, ihren Pro-Kopf-Verbrauch seit 1990 von 147 auf 122 Liter zu senken. Sie waren damit sparsamer als fast alle anderen Europäer. Doch waren sie sparsam genug? Die EU-Kommission hat da offenbar Zweifel. Wegen drohender Dürre und Wasserknappheit in den südlichen Mitgliedstaaten plant Brüssel, auch die Verbraucher aus dem Norden, in dem es Wasser in Hülle und Fülle gibt, zu größeren Sparanstrengungen zu drängen. Damit wäre allerdings keinem geholfen. Den Spaniern und Portugiesen nicht, der Umwelt nicht, den Deutschen nicht. Auf die heimischen Kunden könnten Preiserhöhungen von bis zu 25 Prozent zukommen, hat der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) berechnet.“ Da bahnt sich ein „Wasserkrimi“ der besonderen Art an.

Als ein weiterer „Regionalkrimi“, in dem es um Wasser geht, sei hier noch Jacques Berndorfs Roman „Eifel-Wasser“ erwähnt. Dazu heißt es auf „krimi-couch.de in kürze: „Breidenbach wurde ermordet. Am wahrscheinlichsten scheint ein Motiv für die Tat im beruflichen Umfeld des Chemikers zu finden zu sein. Denn Breidenbachs Job war es, die Qualität des Trinkwassers zu kontrollieren, und ziemlich schnell zeichnet sich ab, dass der Wasser-Spezialist Umweltsündern auf die Spur gekommen ist.“

Das Thema „Wasser“ wird mit steigenden Wasserkosten immer wichtiger. Und es wird anscheinend auch mit immer härteren Bandagen um Wasserrechte gekämpft. Das wollen uns die Wasser-Sachbuch- und -Krimi-Autoren wohl damit sagen.
Die taz berichtete indes bereits am 21.7.1984 – in einem Artikel über den Vogelsberg – von einer sogenannten „Hydro-Guerilla“, die schon seit geraumer Zeit mit Feuer und Sprengstoff gegen den Wasserraub im Vogelsberg kämpfte. „Dabei wurden u.a. einige Gerätschaften der Frankfurter Probebohrungs- Gesellschaft hatten zerstört. Obwohl auswärtige Wochenzeitungen daraufhin die ‚Gefahrenstufe 1‘ ausriefen, stieß die Hydro-Guerilla in der Bevölkerung auf Sympathie: Verbrechen werden toleriert, sie müssen nur populär sein. Die in vielen Orten gesprühte aktionistische Parole der Öko-Krieger (‚Nicht analysieren, sondern pyrolisieren‘) ließ auf eine fortgeschrittene Distanz zu rationaler. ‚Problembewältigung‘ qua ‚Dialog‘ (J.Habermas) schließen.“

Die taz erwähnte namentlich den 72jährigen ‚Speckenmüller‘ Heinrich Muth in Salz, „der vor einigen Jahren einen Staatssekretär vom Acker gejagt hatte und daraufhin von der ‚Frankfurter Rundschau‘ zum „Rebell des Vogelsberg“ gekürt worden war. Seit der ‚Speckenmüller‘ die erste Bauerndemonstration gegen den Wasserraub angeführt hatte, war er selbst zu einem Mythos geworden: die Medienleute, Grüne und Friedensbewegte, die in der Speckenmühle ein und aus gehen, hatten dafür gesorgt, daß der Muth-Heinrich in die Nähe des legendären Thomas Müntzer gerückt wurde. In dieser Eigenschaft war er mit Vortrags-Einladungen in Fachoberschulen und Öko-Camps eingedeckt worden – aber auch von der Polizei mit Hausdurchsuchungen heimgesucht worden.“
Die taz vom 12.7.1984 hatte diesem „Ereignis“ zuvor bereits eine ganze Seite gewidmet:
„Den Ordnungshütern in Bad Orb über den Kopf gewachsen, haben sich die Staatsschützer in Hanau einer Widerstandsform angenommen und sie auf den Begriff gebracht. „Ökoterrorismus“ heißt es jetzt, was wer auch immer auf dem größten erloschenen Vulkan Europas seit einem Jahr mit den Bohr- und Pumpeinrichtungen und dem dazugehörigen Fuhrpark anstellt. Der Spuk ereigne sich „immer bei Nacht“, so verzweifelt ein Beamter aus Hanau und zählt die „Anschläge“ chronologisch auf: Am 12. Juni vergangenen Jahres brannte der Brunnen am Mülnhäuser Weiher (30.000 DM), am 5. Oktober der in Neuschmiden, am 13. November loderten in Birstein gleich drei Baumaschinen (300.000 DM) und am heiligen Ostersonntag gingen zwei Schachtanlagen in Mauswinkel in Flammen auf. Ansonsten, so beklagen sich die Pipeline-Firmen, vergehe „kaum ein Wochendende, an dem hier nichts passiert“. Brunnen werden aufgebrochen, Starterbatterien für Bagger und Raupen gefilzt, bereits fertige Rohrleitungen angebohrt und vor wenigen Tagen sei ein wertvolles Meßkabel zur Fernsteuerung der Pumpen gekappt worden. „Psychoterror“ nennt es der leitende Angestellte vom Wasserverband Main-Kinzig, „hilfloses Anrennen“ gegen den „Wasserraub“ im Mittelgebirge zwischen Frankfurt, Gießen und Fulda bezeichnet es der „Traubenwirt“ in Salz.

„Das Sterben der Wälder längs der Nidda und im Ried ist der Preis; das Ried, mittlerweile ein krankes Gerippe, ist ausgeblutet, nun soll der Vogelsberg herhalten“, kommentierte Heinrich Muth vor Jahren schon die Wasserdieberei der“sündigen Städter“.
Schon 1911 begannen hier die ersten Grundwasserzufuhren aus dem vulkanischen Basaltmassiv. Im großen Stile jedoch machte man sich erst Mitte der 60er Jahre daran, das Nidda-Tal auszusaugen. Im Rauschen von 50 Kubikmetern in der Sekunde (oder um ein sommerliches Bild zu bemühen: der Inhalt eines Freibades auf einen Schlag) brausen die Wassermassen gen Süden. Im Jahr sprudeln auf diese Weise mehr als 50 Millionen Kubikmeter ins Rhein-Main- Gebiet. Die Weltstadt säuft Anfang der 70er Jahre tatsächlich 68 Millionen Liter. Den rauchenden Köpfen der Hochkonjunkturplaner entsprangen lineare Bedarfsrechnungen und begründet war der Drang nach neuen Ufern. Uhm- und Feldatal, Salz- und Brachttal gerieten ins Visier der Rohrverleger, die ein jährliches Gesamtvolumen von 135 Millionen Kubikmetern antreben. „Was Frankfurt nicht braucht, kann an die benachbarten Industrieregionen abgegeben werden“.

Angeführt vom „Speckenmüller“ Heinrich Muth, drehten die Landwirte aus den umliegenden Dörfern, deren plastische Ortsnamen wie Fischborn, Entenfang, Redmühl, Moos schon an die Verbindung zum umstrittenen Element erinnern, die Zeit zurück: mit Sensen, Dreschflegeln, Äxten, Mistgabeln und der „schwarzen Bauernfahne“ machten sie den „Wasserräubern“ aus den verschiedensten Behörden und Verbänden, die „frech wie Anton“ im Dorfgemeinschaftshaus tagten, deutlich, was sie von den „Totengräbern des Vogelsberg“ halten. Ungehobelt und „wie der Mund gewachsen ist“, brüllten sie sich die Kehle heiser. „Planungsterror“, „Behördenwillkür“ und „Volkszorn“ gehörten damals schon zum Vokabular der Vogelsberger, die wie es der Rebell nennt ’schon immer sehr eigen‘ gewesen seien.“
Trotzdem spaltete sich bald der Widerstand gegen den Wasserraub durch die Frankfurter: Ein Teil war dafür, wenn sie einen anständigen „Wassergroschen“ dafür zahlen würden. Dieser Gedanke gedieh bis zum halbwegs ökologischen: Man müsse den aktuell immer begehrter werdenden Rohstoff Vogelsberg-Wasser sinnvoll mithin profitabel bewirtschaften. Es wurde sogar an die Solidarität der Völker appelliert: Wir können im Vogelsberg nicht lustig im Feuchten sitzen, wenn ringsum Wassernot herrscht. Und nicht zuletzt bemühte man die Arbeitslosen: eine effektive Wassernutzung würde Arbeitsplätze schaffen.
Die taz schrieb, die Radikalen/Ökoterroristen seien gegen jeden Tropfen, der weggepumpt werden solle. Die meisten anderen wehrten sich lediglich gegen den Größenwahn, der in die Katastrophe führe. Dazu zitierte die taz einen „Verhandler“: Seit die Wasserbehörde im Darmstädter Regierungspräsidium 30 Bauern zwangsenteignet hat, vor einem Jahr, könne er, so wie er „die Mentalität der Vogelsberger kenne, keine Garantie für das, was kommt“ abgeben. Für die Zuspitzung der Wasserschlacht sorgen die Betreiber außerdem mit „billigen Verarschungen“. So wird der Illnhäuser Weiher, der, seit die Pumpen angeschmissen wurden, schlicht ausgetrocknet ist, mit Grundwasser gefüllt, um „den dummen Bauern“ eine heile Welt vorzuspiegeln.

Abschließend zitierte die taz auch noch einen Sympathisanten der „Öko-Terroristen“:
Das sei doch kein Terror, wenn sich die Leut nach 15 Jahre langem Verhandeln, Demonstrieren und Prozessieren „am End ganz praktisch wehrn“. Es sei nicht viel anderes, als wenn der belächelte Bauer mit der Mistgabel auf den Panzer losgehe, der ihm das Feld plattgewalzt habe, wie das während des letzten Nato- Manövers passiert sei. Ansonsten „weiß hier niemand was, sieht hier niemand was und hört hier niemand was“.

1986 veröffentlichte die taz einen gekürzten „Prozeßbericht“ aus dem Vogelsberg, in dem es um Wasser ging. Hier die vollständige Version:
„Vogelsberg nimmermehr, geb‘ ich für Geld dich her, laß nicht von dir …“ So lautet ein bekanntes Vogelsberg-Lied (wiederabgedruckt in „Menschen am Fluß … wie lange noch?“ Hamburg 1985) Weil die Stadt Frankfurt sich seit Jahren ihr Brauchwasser aus dem Vogelsberg rauspumpt und etliche umweltbewußte Vogelsberger sich dagegen – ebenfalls schon seit Jahren – zur Wehr setzen, deswegen wurde der Liedtext mit in das e.e. Buch von Inge Kramer und Günther Zint aufgenommen. Auf Seite 8 heißt es dazu: „Der Kampf um das kostbare Naß wird zuweilen mit harten Bandagen ausgetragen“. Der Text des Vogelsberg-Liedes legt es bereits nahe: Diese oberhessischen Mittelgebirgsbewohner scheinen sich besonders hartnäckig an ihre Scholle zu krallen. Einmal prozessierte beispielsweise die Gemeinde Wüstwillenroth über hundert Jahre gegen den Isenburger Fürsten zu Birstein – wegen ihrer Wasserrechte.
Im Jahre 1974 hatte Karl Möller aus Clauburg-Clauberg, der in Büdingen aufs Gymnasium gegangen war und dann am Frankfurter Städel Kunst studiert hatte, vom Ortenberger Fürsten zu Stolberg-Rossla ein Anwesen in Volkartshain gemietet. Der Fürst, dem einstmals große Besitzungen im Osten gehört hatten, lebte jetzt bescheiden von seinen Ländereien und Immobilien im Vogelsberg. Sein ehemaliger Kammerdiener war sein Rentamts-Verwalter geworden; der kunstliebende Fürst verbrachte viel Zeit im Keller seines Ortenberger Schlosses, wo er als Hobby-Archäologe in römischen Koelkjemoedings herumgrub, daneben hatte er auch mäzenatische Ambitionen, deswegen vermietete er sein Forsthaus mit drei Hektar Land drumherum gerne an den Künstler Möller, dem sogar hundert Mark Mietzins im Monat erlassen wurden. Anfänglich war das Verhältnis zwischen Eigentümer und Pächter durchaus freundlich, man traf sich bei Gelegenheit eines fürstlichen Jagdausflugs am Altenfelder Hof und fachsimpelte beispielsweise über die Kunst und Geschichte der Lithographie. Karl hatte in der Scheune seine Lithopresse aufgestellt. So nach und nach hatte er aber auch angefangen, Teile der Wirtschaftsgebäude und des Geländes landwirtschaftlich zu nutzen. Nach einigen Jahren besaß er bereits eine große Ziegenherde und sein Mitbewohner Knuffi backte wöchentlich zwei mal 50 Biobrote. Die brotlose Kunst gab er bald ganz auf. (In einem Artikel über seinen Hof in der Kreiszeitung wird allerdings noch erwähnt, dass er die blutigen Laken von der Geburt seiner Tochter auf Rahmen gespannt hatte und sie als Kunstobjekte aufbewahrte – eine Übergangslösung vielleicht, mit Reminiszenz an die Schüttbilder von Nitsch, den Karl noch als Dozent am Städel kennengelernt hatte.)

Zu dem vom Fürsten gemieteten Forsthaus gehörte eine eigene Quelle, von der eine Wasserleitung zum Haus führte. Als diese Zuleitung einmal kaputtging, bat Karl seinen Vermieter den Schaden zu beheben. Nichts geschah. Nach einiger Zeit trat Wasser in den Keller ein, worauf Karl den Fürsten ein weiteres mal anschrieb, damit der auch diesen Schaden beheben lasse, wobei er darauf hinwies, dass der zweite Schaden nicht entstanden wäre, wenn man den ersten früher behoben hätte, im übrigen sei die ganze Angelegenheit dringend, in den Sommermonaten wäre die Wasserversorgung des Hauses bereits zusammengebrochen. Wieder geschah nichts. Der Mieter übergab die Angelegenheit einem linken Rechtsanwalt in Frankfurt, der sich im Zusammenhang der dortigen Hausbesetzer-Bewegung auf Mietrechtsprobleme spezialisiert hatte. Gemeinsam taxierte man den Gesamtschaden und Karl zog ihn in Raten von der monatlichen Miete ab. Auf diese mieterliche Eigeninitiative reagierte das Fürstlich Stolberg’sche Rentamt mit einem Brief, in dem darauf hingewiesen wurde, dass dem Pächter von Anfang an klar gemacht worden war, wie mangelhaft die Wasserversorgung des Hauses sei und dass man deswegen seinerzeit den Pachtzins für das Anwesen auf hundert Markt monatlich verringert hätte. Karls Anwalt forderte im Gegenzug vom Fürsten die Herausgabe des Schlüssels zum „Quellhäuschen“, damit das Wasserwirtschaftsamt Friedberg die Ursache für den Wassermangel feststellen könne. Gleichzeitig besorgte sich sein Mandant von einem Freund, der mit einer Anakonda und einer Boa Constrictor als Feuerschlucker in Oberhessen herumzog, eine Quittung über tausend Mark „für Arbeiten zur Wasserbeschaffung von Herrn Möller“. Das Rentamt bestätigte den Eingang des Schreibens, „wegen eines Trauerfalls“ würden sie es demnächst beantworten.
Als nächstes schrieb Karl aber seinem Anwalt, dass er eine Kaution für die Hofanmietung hinterlegt hätte und dass er die mit den nächsten Mieten verrechnen wolle, zugleich würde er sich nach einem neuen Platz umsuchen. In seiner Antwort bezeichnete der Anwalt diese Kleinmütigkeit und Kampfunlustigkeit als „Milchmädchenrechnung“, außerdem fände er, Karl, so einen schönen Hof nie wieder. Folgsam beauftragte Karl eine Firma, die einen Kostenvoranschlag für die Behebung des Rohrbruchs aufstellte: 1800 Mark – für diese Arbeit wurde ein Teil der Miete einbehalten. Das Rentamt forderte daraufhin die fehlende Miete ein, später informierte die Kreissparkasse Karl darüber, dass sie einen Teil der seinerzeit übernommenen Bürgschaft an das Rentamt überwiesen hätten. Inzwischen hatte sich auch der Fürst einen Anwalt genommen, der an Karls Rechtsvertreter einen Brief schrieb, in dem das Pachtverhältnis zum 31. Juli 1979 für beendet erklärt wurde; das dünne Schreiben endete mit dem Satz: „Ihre Mandatschaft mag den Wasserschaden selbst beheben“. Karl Möller war – gelinde gesagt – niedergeschlagen, aber sein Anwalt kam erst auf Touren, er bearbeitete seinen Mandanten, jetzt nur ja nicht aufzugeben. Der suchte sich nun nach zusätzlicher Unterstützung im Landkreis um: Der Landrat in Friedberg schrieb ihm ab: „aus wasserrechtlichen Gründen kann ich in Ihrem Fall leider nicht tätig werden“.

Auch sein Vermieter sollte noch einmal zu einem Sinneswandel bewogen werden: „Sehr geehrte Durchlaucht“, schrieb er, „bei unserem kurzen Zusammentreffen vor wenigen Tagen wollte ich Sie nicht abhalten von Ihrem Jagdvorhaben. (….) Ich bin zutiefst empört über das Verhalten Ihres Verwalters – Herrn Scheuermann …“ Und dann stellte er noch einmal den ganzen Fall bis dahin aus seiner Sicht dar, wobei er zum Schluß darauf hinwies, dass er sich in den feuchten Räumen bereits ein Rheumaleiden zugezogen habe, dass es ihm „unmöglich mache, längere Zeit an einem Stück zu malen“. „Ich betreibe hier den gesamten Altenfelder Hof mit seinen Inhalten und Wandlungen als Kunstwerk. Darüber war auch bereits in Presse und TV zu erfahren. Es sollte in diesem Sommer ein Bildband dazu erscheinen, ich fand aber weder Ruhe noch Zeit dafür, ob das ganzen Ärgers“. Sodann zählte er einige Mängel an Haus und Gartenzaun auf, die der Fürst als Vermieter zu beheben hätte. Der Brief endete „mit Vogelsberggrüßen“. In einem weiteren Schreiben – an den Verwalter, Scheuermann – beschwerte Karl sich über „den Entzug der Berechtigung zur Haltung“ eines Hundes: a) brauche er ihn als Wachhund, das Forsthaus sei sehr isoliert gelegen und b) sei sein „altdeutscher Hirtenhund“ notwendig für seine „gelegentliche Arbeit als Aushilfsschäfer“, c) mitnichten würde der Hund „im Revier streunen und den Jagdbetrieb stören“.
Zu Beginn des Jahres 1979 antwortete ihm der Fürst: „Ich danke Ihnen für Ihr Schreiben und die Weihnachts- bzw. Neujahrswünsche, die ich noch nachträglich erwidern möchte. Außerdem bedanke ich mich für den überlassenen Probedruck.“ Des weiteren bedauerte der Fürst, in der Angelegenheit Altenfelder Hof keine Stellung nehmen zu können, da er – sowohl als auch Karl – bereits einen Anwalt mit der Klärung beauftragt hätten. Am 10.4. hieß es in einem Brief von Karls Anwalt an das Amtsgericht Büdingen, „dass es sich bei dem fälschlich als ‚Pachtvertrag‘ bezeichneten Vertrag um ein ‚Wohnraummietverhältnis‘ handeln“ würde und somit die ausgesprochene Kündigung unwirksam sei, es könne kein ‚Eigenbedarf‘ vom Fürsten nachgewiesen werden und der behauptete ‚Betriebsbedarf‘ (einer der Förster des Fürsten – Baumann – sollte in das Forsthaus einziehen!) sei nicht identisch mit ‚Eigenbedarf‘.
Karl bekam ebenfalls einen Brief von seinem Anwalt, in dem dieser ihn daran erinnerte, beim Sozialamt Gedern ein Armenrechtszeugnis zu beantragen. In dem Schreiben an das Gericht war diesbezüglich schon darauf hingewiesen worden, dass „der Kläger Möller nur über ein monatliches Einkommen von 300 Mark verfüge“. Die Gegenseite – das Anwaltsbüro des Fürsten – beantragte beim Amtsgericht „Klageabweisung“ und „Vollstreckungsschutz“. Sie beharrten auf dem Begriff „Pachtvertrag“ – „Beweis: Augenscheinnahme“ (es wird auf dem Altenfelder Hof landwirtschaftlich gearbeitet). Zum Wasserleitungsproblem führten sie aus, dass „im Vogelsberggebiet naturbedingt schon seit Jahren Wassermangel besteht“. Entweder war das eine Lüge, wenn damit auf die jährliche Niederschlagsmenge in Nordhessen angespielt wurde, oder aber das „naturbedingt“ war ein hermeneutischer Fehlgriff, wenn damit der „Wasserraub der Frankfurter“ (I. Kramer/G. Zint, s.o.) gemeint war…

Karls Anwalt verfaßte daraufhin einen zweiten dünnen Schriftsatz für das Büdinger Gericht, in dem zu dem Wasserproblem noch ein Sachverständigengutachten als Beweis angeführt wurde. Das Amtsgericht verhörte dann auch als Zeugen einen Schlossermeister aus Gedern und kam im August 1979 zu dem Urteil: 1. Der Beklagte (der Fürst) wird verurteilt, an den Kläger (Karl) 500 Mark nebst 4% Zinsen zu zahlen. Im übrigen wird die Klage abgewiesen (sie ist nur z.T. begründet) und 2. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben. Das fürstliche Anwaltsbüro erhob dagegen Klage beim Landgericht Gießen – wegen „Räumung und Zahlung – Wert: 4050 Mark“, zusätzlich wurde darum gebeten – wegen der anstehenden Gerichtsferien die Angelegenheit zur „Feriensache“ zu erklären, „damit das Pachtobjekt alsbald anderweitig wirtschaftlich verwendet werden“ könne. Da Karls Anwalt vor dem Landgericht Gießen nicht zugelassen war, übernahm stellvertretend für ihn ein Anwaltskollektiv aus Lahn-Wetzlar den Fall und dieses schrieb dem „Landgericht – 3. Ferien-Zivilkammer“: 1. Die Klage abzuweisen, hilfsweise dem Beklagten eine Räumungsfrist einzuräumen und 2. Ihm das Armenrecht zu gewähren.
Dann wurde aber die SPD-Idee einer Europa-Großstadt „Lahn“ noch vor seiner Realisierung wieder rückgängig gemacht, wobei das Lahn-Wetzlarer Anwaltskollektiv zulassungsmäßig Limburg zugeschlagen wurde und somit Karl nicht mehr in Gießen verteidigen konnte. Ein neues Kollektiv in Linden- Leihgestern übenahm den Fall. Während dieses fliegenden Wechsels hatte Karl noch eine einstweilige Verfügung erwirkt gegen das fürstliche Rentamt, das die drei Hektar um den Hof wegen der im August zu erwartenden Kündigung neu verpachten wollte: Bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu 50.000 Mark wurde dem Fürsten verboten, „das verpachtete Grundstück zu verändern“.
Durch seine fortwährenden Rechtshändel juristisch gefestigt und ob seiner bisherigen Teilsiege ermutigt, organisierte Karl im Frühherbst eine „Rock gegen Rausschmiß“-Veranstaltung auf dem Gelände des Altenfelder Hofs. Die Kreiszeitung schrieb später darüber: „Mit diesem Treffen sollte noch einmal ‚die Power‘ der alternativen Kultur demonstriert werden“. Karls Frankfurter Anwalt mahnte ein neues Armenrechtszeugnis für die Gießener Korrespondenzanwälte an.
Die Anwälte des Fürsten beantragten bei Gericht die Abweisung des Armenrechtsgesuchs des Beklagten „wegen Aussichtslosigkeit“. Zur Begründung ihrer Klage schrieben sie: „Eine gewisse Wasserversorgungskalamität war stets zu befürchten.“ Ferner wiesen sie darauf hin, dass der Beklagte auf dem Gelände des Altenfelder Hofs ein „Rock Festival“ veranstaltet habe – „Beweis: Kreisanzeiger vom 8.9.79“. Mindestens 120 Fahrzeuge (darunter zwei Busse) seien dazu aus der BRD und dem Ausland angereist. Etliche fremde Personen befänden sich mit ihren Fahrzeugen noch immer auf dem Hof. Die Veranstaltung wäre behördlich nicht angemeldet worden und wäre auch nicht genehmigt worden – „Beweis: Auskunft der Bürgermeisterei Gedern“. Um die Benutzung des Forsthauses für den Revierförster Baumann zu begründen, führten sie – gemäß Palandt § 556a, Anm. 6 – noch einmal „Eigenbedarf, auch für nahe Verwandte (Weimar, WM 68, 427)“ an. Sie hatten schlichtweg vergessen, dass Förster schon seit den napoleonischen Reformen nicht mehr zum Gesinde des Landesherrn zählten.

Einmal speisten Karl und seine Freundin Gisela mit einem der fürstlichen Anwälte in einem Büdinger Restaurant und bekamen dabei ihre Einschätzung bestätigt: Es war ein absolut mattköpfiger CDU-Karrierist, der für den Fürsten vor Gericht stritt. Ende Oktober wies das Landgericht Gießen den Antrag von Karl auf Armenrecht zurück. Das Gießener Anwaltskollektiv legte dagegen Beschwerde ein. Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Frankfurter Anwalt von Karl ging daraufhin in Berufung beim Oberlandesgericht Frankfurt, wo Richter Theo Rasehorn (der sich unter Pseudonym schon mehrfach öffentlich für die Abschaffung der Justiz ausgesprochen hatte) den Antrag auf Armenrecht zu bearbeiten hatte.
Er entschied, dass es sich im vorliegenden Fall um einen Mietvertrag handele und genehmigte den Antrag auf Gewährung des Armenrechts. Zuvor hatten die fürstlichen Anwälte dem OLG Frankfurt mitgeteilt, dass es gar nicht darauf ankäme, was die Gegenseite zu Armenrechtsgesuch und anhängiger Klage vortrage, „fest steht, dass die Beklagten den Altenfelder Hof in eine Niederlage für Rock und Roll und zu einem Asyl für ortsfremde Korbflechter umfunktionieren“. „Es versteht sich von selbst und entspricht allgemeiner Lebenserfahrung“, dass dadurch das ganze wunderschöne Anwesen der Fürsten völlig versaut wird (sinngemäß). Ferner habe der Beklagte vom Kläger eine Reparatur des Badezimmers verlangt, „verweigere aber dem Leiter des Rentamtes, Herrn Amtmann Scheuermann, die Augenscheinnahme“. Als der „Amtmann Scheuermann zusammen mit dem Wehrleiter Göttlicher“ das Anwesen mitsamt den ganzen Wohnwagen, Zelten und Leuten fotografieren wollte, wurde der Beklagte sogar handgreiflich und drohte, den Fotoapparat zu zertrümmern. „Nun war es Amtmann Scheuermann weder zumutbar noch möglich, eine Ortsbesichtigung vorzunehmen“. „Mehrere männliche und weibliche Personen nebst mehreren Kindern beobachteten den Vorfall (hieraus ergibt sich die unzweifelhafte vertragswidrige Überbelegung des Anwesens) von den Fenstern des ersten Stocks aus“.
In der Annahme, „dass Angriff die beste Verteidigung sei, erstattete daraufhin der Beklagte Strafanzeige bei der Polizeistation Büdingen wegen Hausfriedensbruchs“. Nach der Rockveranstaltung waren etliche mit Traktoren und Wohnwagen angereiste Besucher noch da geblieben. Einige von ihnen hatten neben einem Ziegenstall eine „Swetlodge“ errichtet – eine aus Reisig gebaute Rundhütte, die als Sauna benutzt wurde, indem man im Innern einige heiße Steine in ein großes Wassergefäß legte. Gerade als Revierförster Baumann sich zu einem Smalltalk mit Karl auf dem Altenfelder Hof aufhielt, wollte jemand die Swetlodge benutzen und trug einen heißen Stein hein, der rollte jedoch statt ins Wassergefäß an einen Strohballen und schon Minuten später brannte die ganze Sauna, kurz danach auch Teile des angrenzenden Stalls. Zwar wurde das Feuer bald gelöscht, aber ein paar Tage später erhielt Karl vom Amtsgericht Büdingen eine einstweilige Verfügung, in der ihm bei Strafe von 50.000 Mark fürderhin verboten wurde, auf dem Gelände des Forsthauses offene Feuer anzulegen. Gegen diese Verfügung legte Karl keine Beschwerde ein.
Um aber dem schlechten Eindruck etwas entgegenzusetzen, den die Darstellung der fürstlichen Anwälte von dem auf dem Hof herrschenden bunten Treiben eventuell auf das OLG Frankfurt gemacht hatte, überreichte Karls Anwalt in einer Anlage dem Gericht fünf Fotografien: „Bild 1 – Das Forsthaus einschließlich des ‚Asyls für ortsfremde Korbflechter‘ (Deren Tipis sich wohltuend in das umgebende Gelände einfügen); Bild 2 – Essensausgabe für die Besucher des Musikfestes; Bild 3 – Der Sohn der Zeugin Gisela Brückl in und mit Körben der ‚ortsfremden Korbflechter‘; Bild 4 – Das Forsthaus und – im Vordergrund – der Acker; Bild 5 – Teilansicht des Gemüsegartens (im Vordergrund Radieschen und Wirsingkohl sowie Mohrrüben- Reihen, hinten Kopfsalat und Endivien“. (Der Frankfurter Anwalt meinte herausbekommen zu haben, dass am 8. Zivilsenat des OLG Frankfurt zwei Vegetarier saßen!)

Diese fotografische Dreistigkeit konterten die fürstlichen Anwälte mit einem weiteren Schreiben, in dem sie noch einmal hervorhoben, wieviel Leute die Rock-Veranstaltung besucht hätten und wieviel davon jetzt immer noch auf dem Gelände kampieren würden – „dass durch diese Massenansammlung und Lärmeinwirkung die jagdlichen Belange des Klägers erheblich beeinträchtigt werden, wird vorsorglich hiermit unter Sachverständigenbeweis gestellt“.
Dessen ungeachtet wurde das Gießener Landgericht am 19. März 1980 vom OLG Frankfurt angewiesen, „dem Beklagten das Armenrecht nicht aus den Gründen des angefochtenen Beschlusses zu versagen“. Das Landgericht erklärte sich daraufhin für unzuständig, weil durch Beschluß des OLG der Fall zu einem „Mietprozeß“ geworden war und Mietprozesse erstinstanzlich an Amtsgerichten stattfinden: Zurück nach Büdingen. Dort hatte Richter Demel jetzt über den Fall zu befinden.
Derweil beschlossen zwei von den Korbflechtern zu heiraten und es wurde ein großes Fest organisiert. Die Unkosten dafür bezahlte der Hessische Rundfunk, Ulf von Mechow – ein Regisseur – drehte gerade einen Film: „Der Fürst und die Freaks“, und die Szene von der Hochzeitsfeier sollte freaklicherseits eine nachmittägliche Teezeremonie im fürstlichen Schloß zu Ortenberg kontrastieren. Die beiden in den Rechtsstreit verwickelten Parteien spielten also in dem Film mit.
Vor Beginn der Dreharbeiten hatte Karl dem Rentamt einen Brief geschrieben, in dem er vor allem den „miserablen Zustand“ des Wende- und Parkplatzes auf dem Hof erwähnte: „Wohl ist mir klar, dass es Ihnen eine klammheimliche Freude sein wird, wenn wir hier durch den Matsch stiefeln müssen“, trotzdem bitte er um neuen Schotter für diese Flächen. Wenn das Fernsehteam vom HR anrücke – Mitte April – „könnte wohl gerade der Schlamm und Matsch ein zusätzlich sehr negatives Bild auf Sie werfen.“ Rechtzeitig vor Drehbeginn ließ der Fürst Zufahrtsweg und Parkplatz neu einschottern. Karls Frankfurter Anwalt beantragte beim Amtsgericht Büdingen erst einmal wieder die Bewilligung des Armenrechts. Die fürstlichen Anwälte beantragten dagegen, Karl das Armenrecht zu entziehen – Begründung: „Der Beklagte hat bei der Fa. Fischer in Siechenhausen einen Unimog zum Preis von 10.000 Mark gekauft und bar bezahlt“. Zwar erkannte das Büdinger Gericht Karl am 1. August das Armenrecht zu, aber sein Anwalt schrieb ihm am 27.8., er müsse unbedingt Stellung dazu beziehen, ob „wegen des Unimog-Kaufs die für das Armenrecht erforderliche ‚Kostenarmut‘ weggefallen ist“. Karl antwortete seinem Anwalt umgehend: 1. benötige er das Gefährt für ein zweites Filmprojekt und 2. Versuche er gerade eine neue Karriere als Puppenspieler, dazu wolle er mit zwei Wohnwagen und Unimog sich demnächst „on the road“ begeben. „Das Geld habe ich vom Verkauf eines Fachwerkhauses im Vogelsberg, wovon mit 1/4 ideell gehörte“. Dieser Brief wurde bereits von einem Weinbauerngut im Rheinhessischen abgeschickt, wo Karl, seine Freundin und die gemeinsamen drei Kinder sich bereits befanden – „Freitag fahren wir weiter in Richtung Süden!“
Im Oktober fällte Richter Demel sein Urteil: „1. Die Klage wird abgewiesen, 2. Der Kläger (der Fürst) hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen!“ In der Begründung hieß es, dass die Kläger die Schäden durch Rock- Veranstaltung und dort kampierende Korbflechter „nach Art und Umfang nicht hinreichend substantiiert vorgetragen“ hätten. Bei der Aufnahme von Frau Brückl in des Beklagten Haushalt handele es sich um seine Lebensgefährtin und also um keine „erlaubnispflichtige Untervermietung“.
In einem 2. Beschluß wurde allerdings die Beiordnung von Karls Anwalt als Armenanwalt abgelehnt. Die Anwälte des Fürsten hatten zuvor Bedenken gegen den Beschluß des OLG angemeldet: „1. Ist der Begriff ‚freischaffender Künstler‘ nicht näher definiert. 2. Ist die Beziehung seiner Kunstausübung zur gleichzeitigen Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebes unklar“. Außerdem habe der Beklagte sich einen Wohnwagen angeschafft mit dem er über Land zu ziehen beabsichtige“, den Hof will er der Nutzung und Verwaltung eines der dort untergebrachten Korbflechter überlassen, den er zu seinem ‚Stellvertreter‘ bestimmen will“. Und weiter hieß es: „Etwa Ende Februar 1980 sprach der zuständige Revierförster Baumann den Beklagten wegen der Räumung des Altenfelder Hofes an. Der Beklagte erklärte, Baumann möge mit dem Kläger sprechen, er – der Beklagte – sei bereit, gegen Zahlung von 10.000 Mark sofort auszuziehen. Anfang April fragte Baumann, der gelegentlich bei Wegebaumaßnahmen mit dem Beklagten zusammentraf, diesen wiederum, wann er auszuziehen gedenke. Der Beklagte erwiderte, Baumann sei schlecht informiert, das Gericht habe in zweiter Instanz seinem Armenrechtsgesuch stattgegeben, nun habe er – der Beklagte – viel Zeit und mit 10.000 Mark sei es nun auch nicht mehr getan. Er erklärte wörtlich: ‚Jetzt will ich Geld sehen! Einen ganzen Tisch voll Geld!‘ und weiter: ‚Ich habe ja nun ein Haus, das gehört so gut wie mir‘. Beweis: Revierförster Baumann: Diese Erklärungen des Beklagten lassen erkennen, dass es dem Beklagten darauf ankommt, unter dem Druck seines Räumungsschutzbegehrens eine möglichst hohe Abstandssumme, die materiell keineswegs berechtigt ist, zu erhalten. Außerdem verletzt seine Haltung (faktische Expropriation des Klägers!) dessen in Artikel 14 Grundgesetz garantiertes Eigentumsrecht“.

Nachdem das für den Fürsten nachteilige Urteil ergangen war, stellten seine Anwälte beim Amtsgericht Büdingen erneut einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung, mit der auch die Feuerstellen in den Wohnwagen und Tipis verboten werden sollten. Diesem Antrag wurde stattgegeben und Karls Anwalt legte auch keine Beschwerde dagegen ein.
Dann gingen die fürstlichen Anwälte gegen das Büdinger Urteil beim Landgericht Gießen in Berufung. Erst einmal schrieb aber der Verwalter des Rentamts – Scheuermann – dem Mieter Karl einen privaten Brief: „Die ganze Angelegenheit ärgert mich insofern am meisten, weil auf meine Vorsprache S.D. der Fürst Ihnen s.Z.t. den Hof auf Treu und Glauben vermietet hat und es jetzt sein Geld kostet, dass z.B. unser Revierleiter Baumann täglich vier mal die Strecke Ortenberg-Mittel- Seemen fahren muß und deshalb der forsttechnische Betrieb ordnungsgemäß nicht ausgeführt werden kann. Auch Herr Baumann muß darunter leiden. Vielleicht macht Ihnen das eine klammheimliche Freude. Herr Forstoberrat Diehl, den Sie jetzt auch kennen, meinte, Sie seien ein ehrlicher Partner. Es fällt mir schwer, dieser Meinung zu folgen. (…) Anscheinend haben sich die Zeiten geändert und das Wort ‚Vertragstreue‘ muß aus dem Duden entfernt werden. Ansonten sind meine Tage bei der Fürstlichen Verwaltung meines Alters wegen gezählt – vielleicht verstehen Sie gerade die letzten Worte. Das ist alles, was ich Ihnen antworten wollte. Dass aus dieser Antwort ein Briefwechsel entsteht, wünsche ich nicht.“
Für den nun in Gießen weitergehenden Prozeß reichten die fürstlichen Anwälte und Karls Frankfurter Anwalt bzw. dessen Korrespondenzanwälte ihre dünnen Schriftsätze beim dortigen Landgericht ein. Letztere schrieben: „Der Kläger verfolgt offensichtlich die Taktik, in systematischer Weise ‚Mosaiksteine‘ zu sammeln“. Zu den Wohnwagen und Tipis auf dem Altenfelder Hof erklärten sie: „Die Beklagten haben die Korbflechter eingeladen, mit ihnen einen Film sowie ein Buch zum Thema ‚Ästhetik der Subkultur‘ zu machen.“
Karl bedankte sich am 4.7.1980 bei dem Verwalter Scheuermann, dass dann dessen Intervention beim Gederner Bürgermeister der Altenfelder Hof endlich Anschluß an die Müllabfuhr bekommen habe, er vergaß aber nicht hinzuzufügen, dass noch etliche Reparaturen am Haus ausgeführten werden müßten … „In diesem Sinne und in der Hoffnung auf eine weitere fruchtbare Zusammenarbeit. Mit Vogelsberggrüßen“.
Der Frankfurter Anwalt erinnerte Karl am 1.8. daran, dass sie „vor langer Zeit mal ausgemacht“ hätten, dass er bei der Volksfürsorge eine Rechtsschutzversicherung abschließen sollte.
Das Rentamt schrieb ihm am 3.9.: „Am Montag wird durch unseren Gebäudemeister Alfred Wollny, geb. 4.12.1928, eine Besichtigung des o. Anwesens durchgeführt. Wir melden dies vorsorglich an.“
Am 16.2.81 reichten die fürstlichen Anwälte ihre Begründung für die Berufungsverhandlung ein, indem sie sich darüber beklagten, dass der Beklagte bauliche Veränderungen auf dem Anwesen vorgenommen hätte:
A) Einen Ziegenstall, für den weder die Genehmigung des Klägers noch eine Baugenehmigung eingeholt worden sei und bei dem „sich der Beklagte außerdem nicht darum scherte“, dass das Kreisbauamt des Wetteraukreises bereits eine Abbruchverfügung angeordnet hätte. (Tatsächlich war das Verfahren wegen des Stalls aber noch anhängig – Karl hatte die Hütte zum „Kunstwerk“ erklärt, war beim Verwaltungsgericht damit abgewiesen worden, hatte Widerspruch dagegen eingelegt, dies Schreiben war verloren gegangen, erst musste der Widerspruchstermin verlängert werden, dann wurde noch einmal Widerspruch eingelegt, sodann war es zu einer Verhandlung gekommen, hierbei war ein Termin verstrichen, schließlich hatte das Umweltschutzamt die Hütte beanstandet und dabei war wieder die selbe Schriftwechsel-Prozedur notwendig geworden. Zwei Jahre später wurde die Hütte schließlich den Nachbarn geschenkt, die sie in ihrem Garten aufbauten.)
B) Hätte Karl einfach ein Ofenrohr durch die Decke zum Schornstein geführt und
C) entsprächen seine nachträglich verlegten elektrischen Leitungen nicht den DIN-Vorschriften.

Zu Karls Freundin Gisela führten die fürstlichen Anwälte aus, dass sie im vergangenen Jahr beim Sozialamt Büdingen einen Antrag auf Mietzuschuß gestellt und dabei eine vom Beklagten unterschriebene Mietquittung vorgelegt hätte. Beweis: „Schriftliche Auskunft des Sozialamts Büdingen. Es kann danach keine Rede davon sein, dass Frau Brückl die ‚Lebensgefährtin‘ im Sinne des angefochtenen Urteils ist. Wie sich aus der Mietbescheinigung ergibt, ist sie Unterpächterin. Ansonsten läge möglicherweise ein Betrug zum Nachteil des Sozialamts vor, was von der Staatsanwaltschaft überprüft werden müßte.“ Zum Schluß wurden dann noch etliche bauliche Mängel aufgelistet.
Karl legte daraufhin am 25.2.81 seinem Anwalt in einem Brief dar, dass und wie fast alle die vom Kläger erwähnten Mängel Folge der von ihm versäumten Reparaturen seien. Sein Frankfurter Anwalt hatte aber langsam die Nase voll von diesem Prozeß und gab den Fall an seine Korrespondenzanwälte in Linden-Leihgestern ab. Diese versuchten dann in ihrem Schreiben an das Landgericht Gießen alle vom Kläger aufgestellten Behauptungen Punkt für Punkt zu widerlegen. U.a. präsentierten sie dem Gericht auch eine schriftliche Genehmigung des Klägers zum Bau eines Ziegenstalls.
Ende März verkündete das Landgericht Gießen sein Urteil: „Die Berufung des Klägers wird zurückgewiesen.“ Noch im Siegestaumel schrieb Karl dem Fürsten einen langen Brief, indem er a) dem Verwalter Scheuermann die Schuld an „dem schlechten Stil“ der bisherigen Auseinandersetzung gab und b) einen Termin vorschlug, an dem „man über die Zukunft des Hofes“ sprechen solle, um fürderhin den Weg über die Gerichte zu vermeiden.
In einem weiteren Brief – an das Rentamt – forderte er 1. einen neuen Gartenzaun, 2. eine neue Kellertreppe, 3. neue Fenster, 4. einen neuen Außenanstrich und 5. die Genehmigung zu einigen „zeitgemäßen baulichen Veränderungen“. Wenig später schrieb er auch seinen Rechtsanwälten; denen gegenüber sprach er die Befürchtung aus, dass man die Renovierungen eventuell auf dem Rechtswege einklagen werden müsse.
Das Rentamt schrieb ihm am 16.4.81 zurück, dass er mehrfach die Waldwege benutzt hätte mit seinem Pkw – „dadurch wurde der Grundbesitz durch verbotene Eigenmacht verschiedentlich gestört“. Karl antwortete, dass er verbrieftes Wegerecht besäße, außerdem hätte er nun wegen der Reparaturen einen Kostenvoranschlag eingeholt und würde die durch die Mängelbeseitigung entstehenden Unkosten mit der laufenden Miete verrechnen. Das Rentamt kündigte daraufhin eine erneute Besichtigung „durch unseren Gebäudemeister Alfred Wollny, geb. 4.12.1928“ an.
Nach Wollnys Inspektion schrieb Karl noch einmal dem Rentamt einen Brief, in dem er wütend erklärte: „Es geht Sie einen Dreck an, wieviel Leute sich hier aufhalten!“ Außerdem erweiterte er die Mängelliste auf 13 Punkte und erwähnte ferner eine noch offenstehende Summe von 2200 Mark.
Das Rentamt konterte seinerseits mit einer Mängelliste, die Karl am 7.5.81 wiederum Punkt für Punkt zu widerlegen suchte. „Abschließend möchte ich nochmals betonen, dass mir im Prinzip an dieser ‚Kriegsführung‘ wenig bis nichts liegt. Aber Sie scheinen von ihren vertraglichen Pflichten nicht viel zu halten – doch es sind nun einmal die Zeiten vorbei, wo dem Adel die uneingeschränkten Rechte in die Wiege gelegt wurden.“
An das Einwohnermeldeamt Gedern schrieb Karl, er verlange, dass seine dem Datenschutz unterliegenden Angaben nicht wieder an das Rentamt weitergegeben werden. Einige Tage später kamen vier Büdinger Polizisten auf den Hof und nahmen von den anwesenden Bewohnern und Gästen die Personalien auf. Dann folge eine Hausdurchsuchung, weil man seinen Hund der „Jagdwilderei“ verdächtigte. Ein Jahr später stellte ein Büdinger Richter dieses Verfahren ein. Karl ließ einen Bauingenieur kommen, der ein Gutachten über den Umfang und die Ursachen verschiedener baulicher Mängel erstellte – für 862 Mark 60.
In einem Brief an seine Gießener Anwälte klagte Karl darüber, „dass die Bullen in den letzten drei Monaten schon fünf mal hier waren, jedesmal wegen irgendeiner Geschichte, die die Fürstenbande uns angehängt hat!“
Am 6. Juni 1981 schrieb er seinen Anwälten erneut: „Heute morgen trudelte eine neue fristlose Kündigung zum Monatsende von unserem Freund ein. Ich hatte eigentlich nicht geglaubt, dass die Bande tatsächlich so doof ist und ihr ganzes Pulver restlos verschießt, außerdem habe ich mittlerweile Rechtsschutz. Ich lege einen Schrieb vom Elektriker bei, dass alle Leitungen den EDV-Vorschriften entsprechen.“

Dem Rentamt teilte Karl mit, dass jetzt alle beanstandeten Mängel beseitigt wären – Herr Wollny hätte überdies alles kontrolliert. Am 17.8. ließ der Fürst durch eine Firma die Fassade des Forsthauses renovieren, die Farbmischung hatte die Fürstin ausgesucht – für alle ihre Forsthäuser gleich. Auch darüber kam es wieder zu einem Streit. Karl fand, es sähe aus wie „Das Forsthaus im Silberwald“; und weil in Frankfurt gerade einige Hausbesetzungen liefen, drohte er den Malern eine Gerüstbesetzung für das Wochenende an, um „die Profilleisten am Dachgesims mit Gold abzusetzen“.
Die Maler informierten sofort den Fürsten, der setzte seine Anwälte in Marsch und schon am nächsten Tag verbot eine einstweilige Verfügung des Amtsgerichts Büdingen Karl, dass er dem Gerüst auch nur in die Nähe kam.
Karls Anwälte hatten unterdes beim selben Gericht Klage gegen die Kündigung und wegen der Erlaubnis zur Untervermietung eingereicht.
Die fürstlichen Anwälte reagierten darauf mit einem Klageabweisungsantrag, in dem sie bestritten, dass der Kläger nur 400 Mark monatlich verdiene, weil er z.B. eine wertvolle Zuchtstute besitze (sie gehörte einem Freund!), außerdem bestritten sie mit Nichtwissen, dass der Kläger „derzeit eine Lebensgefährtin hat, dass der Kläger und seine Lebensgefährtin einen Beruf ausüben und dass sie aus beruflichen Gründen öfters von dem Forsthaus abwesend sind“. (Die Untermietsforderung war von Karl damit begründet worden, dass er und Gisela öfters weg wären und jemand in der Zeit Haus und Hof versorgen müsse!)
Zu der wertvollen Zuchtstute erklärten Karls Anwälte, dass sie ihrem Mandanten nur zu einem Drittel gehöre und dass sie ihm ebenfalls zum Unterhalt dienen würde, insofern er des öfteren Aufführungen, teilweise mit Kindern, mit ihr vornehme.“ (Eine abenteuerliche Konstruktion!)
Am 18. Oktober 1981 erschien zur Abwechslung mal wieder die Büdinger Polizei auf dem Hof, um die Personalien des Anwesenden aufzunehmen. Sie hatten einen Brief vom Rentamt an den Landrat sowie einen Brief vom Landrat an die Polizei dabei, in denen sie aufgefordert wurden, den Hof zu kontrollieren.
Im November lehnte das Büdinger Gericht erst einmal den Antrag auf Prozeßkostenhilfe ab (man sprach nicht mehr von Armenrecht mittlerweile!): Das Gericht sah sich außerstande, „die Frage der Armut des Klägers zu prüfen.“ Am 2.12. folgte das Urteil: „Die Klage wird abgewiesen. Die Widerklage wird abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Kläger zu 4/13 und dem Beklagten zu 9/13 auferlegt“. Zwei Wochen später legten die Anwälte des Fürsten beim Landgericht Gießen Berufung gegen dieses Urteil ein.
Mitte März 1982 verkündete die Berufungsinstanz Gießen ihr Urteil: Karl wurden die 5000 Mark zur Trockenlegung des durch den Wasserrohrbruch naßgewordenen Kellers nicht zugesprochen, ebensowenig das Untervermietungsrecht, dafür war aber auch die Kündigung der Gegenseite nicht rechtes und Karls eigenmächtige Reparatur des Gartenzauns, die er von der Miete abgezogen hatte, wurde ihm nachträglich gebilligt.
Die Ablehnung der Prozeßkostenbeihilfe hatte Karls Kampfgeist etwas gedämpft. Zudem hatte er angefangen, sich in Gedern um die Anmietung einer Schule zu kümmern, in der er Kurse im Hobbymalen veranstalten wollte – „Der Trend geht zum Aktivurlaub“ hatte er dazu dem Gederner Bürgermeister schriftlich mitgeteilt. Seine Landwirtschaft hatte er mittlerweile abgeschafft, die Korbflechter waren mitsamt ihren Tipis und Wohnwagen weitergezogen, seine eigenen zwei Wohnwagen hatte er verkauft und den Unimog hatte eine Nachbar- Landkommune zu Schrott gefahren, die wertvolle Zuchtstute graste ebenfalls nicht mehr auf dem Altenfelder Hof, ihren Stall baute Karl zu einem Atelier um. Überhaupt wurden nach und nach alle Räume des Forsthauses neu und modern renoviert – statt Naturholz Resopal und Metall und statt Kerzenbeleuchtung Neon. Angefangen hatte dies ausufernde Styling-Bedürfnis, dem auch Karls Kleidung und Haarschnitt zum Opfer fielen, ganz harmlos:
Noch vor dem Urteil des Gießener Gerichts, das schlußendlich weder vom Kläger noch vom Beklagten angefochten wurde, hatte Karl damit begonnen, der immer wieder in den gegnerischen Schriften auftauchenden Behauptung, die Räume seien „verwahrlost“, entgegenzutreten, indem er tagelang alle Zimmer neu tapezierte, strich, den Küchenherd und den Wasserkessel blankscheuerte, dann beim Gärtner Kurt für 500 Mark Schnittblumen bestellte, die er in den Räumen verteilte und zum Schluß den Fotografen Reinhard herbestellte, der mit einem Weitwinkelobjektiv diese saubere Pracht, die „Schöner Wohnen“ alle Ehre gemacht hätte, ablichtete. Fotografien waren zwar bei Gericht als Beweis nicht zugelassen, aber Karls Anwälte legten sie trotzdem ihren Schriftsätzen bei, zur gefälligen Kenntnisnahme.

Der Fotograf hatte Karl die Aufnahmen umsonst angefertigt. Ein paar Monate später arbeiteten die beiden zusammen mit einer Frau an einem gemeinsamen Kunstobjekt, das für eine Ausstellung in Kassel vorgesehen war. Der Fotograf kümmerte sich zusätzlich noch um den Ausstellungskatalog. Als der fertig vorlag mußten Karl und die Frau entsetzt feststellen, dass nur des Fotografen Name darin vorkam.
Die beiden Geprellten beauftragten sofort einen Hanauer Anwalt mit einer einstweiligen Verfügung gegen den Fotografen. Der reagierte mit einer saftigen Rechnung für die Fotografien von den Räumen des Forsthauses. Schließlich einigten sich die drei außergerichtlich, jedoch ohne ihr gemeinsames Kunstobjekt wieder aufzunehmen bzw. auszustellen. Unterdessen hatte das fürstliche Rentamt seinen Revierförster Baumann entlassen, weil der verheiratet war, aber mit einer jugoslawischen Freundin zusammenlebte.
Und Ende des Jahres steuerte die Fürstin ihren Mercedes bei Glatteis gegen einen Baum, wobei ihr Mann – der Fürst – wenig später seinen Verletzungen erlag. Erbe seiner Besitztümer wurde ein weitläufiger Verwandter in Gedern – ein 16jähriger Prinz. Der ließ – nach einer angemessenen Trauerzeit – den Mieter des Altenfelder Hofes – Karl – vorsorglich durch den Leiter des Rentamts Scheuermann darüber informieren, dass er am 15. Februar seinen neuerworbenen Besitz – also auch das Forsthaus – in Augenschein zu nehmen gedenke.
Karl Möller hatte sich mittlerweile wieder am Frankfurter Städel immatrikuliert und arbeitete mit zwei anderen Städel-Künstlern gerade an einer gemeinsamen Ausstellung. Seine Freundin – Gisela Brückl – hatte auch wieder eine Arbeitsstelle in Frankfurt angenommen – als Werbetexterin. Die beiden wohnten die Woche über meistens in ihrer neuen Stadtwohnung, nur am Wochenende auf dem Altenfelder Hof. Karl unterschrieb seine Briefe aber nach wie vor „Mit Vogelsberggrüßen“. Ein hartnäckiger Menschenschlag – diese Oberhessen, wie gesagt.

Im Herbst 1988 wagte die Frankfurter Rundschau einen nostalgischen Rückblick auf die „Hydro-Guerilla im Vogelsberg“, in dem sie sich gleichzeitig vorausschauend gerierte:
„Es gibt kein Territorium mehr, nur noch seine Simulation.“ (Jean Baudrillard)
Am Rande des großen europäischen Eruptionsgebietes – in der bedeutendsten Härtlingsform des nordhessischen Raums – liegt der Vogelsberg. Ein tafelförmiges Vulkanplateau auf dem Schnittpunkt zweier tektonischer Schwachlinien. Was dort eines der vielen rodungsbesiedelten Taldörfer umgeben von bewaldeten Mittelgebirgshängen war, ist also ursprünglich vielleicht einmal ein Magmafluß in einer erstarrten Lavawüste gewesen, zu Urzeiten.
In einem schon in den frühen achtziger Jahren erschienenen Sachbuch mit dem Titel „Vogelsberg“ reiten ein anonymer norddeutscher Ich-Erzähler und ein arabischer Peripathetiker, beide im Vogelsberg lebend, auf zwei Pferden (die dem Filialleiter der Ulmbacher Kreissparkasse gehören) durch die nähere Umgebung.
Irgendwann stimmt dabei der Araber ein Lied an – nach der alten Melodie von „Britannien hab ich und Gallien verloren/ Und Rom und die Schwüre, die sie geschworen/ und verloren Lalange…“ Der Ich-Erzähler bemerkt dazu rückblickend: „Nur sang er stattdessen von Kairo, das er verloren hatte, und von den Frauen in Maaba, Dschidda und Suez. Es war ein schönes Lied, im rhythmischen Takt, den die Kamele so liebten, so daß sie die Köpfe senkten, die Hälse vorstreckten und mit weitausgreifenden Schritten träumerisch dahinschwankten. Nur unsere beiden Kleinpferde mochten es nicht, es machte sie nervös. Und Kamele gab es nicht, und kaum das Land vor uns – als endlose Sand- und Geröllebene“.
Bewachsen waren also die bis zu 773 Metern ansteigenden Erhebungen und die Täler vor zwanzig Jahren noch, wenn sie nicht gerade besiedelt, sonstwie bebaut oder Flußbett für Nidder, Salz, Kinzig Ohm und Bracht waren.
Aber schon damals hatte sich der aus dem Arbeiter-Anglerbund und dem Reichsverband Deutscher Sportfischer hervorgegangene Vogelsberger Angelverein mangels Betätigungsfelder aufgelöst. Aus dem selben Zeitraum stammt ein Urteil des Amtsgerichts Gelnhausen, einer Stadt am Südwestrand des Vogelsbergs. Dort wurde ein Kläger abgewiesen, der das Quaken sich paarender Frösche in einem Kunstteich im Garten seines Nachbarn wegen Lärmbelästigung zur Anzeige gebracht hatte (I). Im norddeutschen Itzehoe dagegen kam ein Landgericht wenig später zu einem entgegengesetzten Urteil, indem es das Artenschutzgesetz ausdrücklich an den natürlichen Standort der jeweiligen Spezies band.
Solche „natürlichen Standorte“ schmolzen freilich nach und nach auf Zeltplangrösse zusammen. Bis zum endgültigen Austrocknen der Flüsse im Vogelsberg gab es dort zwar einen gewissen Fischbestand, der auch regelmäßig wieder neu – d.h. künstlich – aufgestockt wurde, aber nicht mehr bis zur Angelreife gedieh, denn mehrmals im Jahr kippten die Gewässer unter zu großem Fäkalien- und Düngemitteldruck um.
Dieser Prozeß erfaßte bald auch die quellengespeisten Wasserbecken der Fischzüchter in der Gegend.
Als dann auch noch die umliegenden Großstädte (vor allem Frankfurt am Main) anfingen, den täglichen Wasserbedarf für ihre Bewohner und Industrieanlagen aus dem Vogelsberg abzupumpen, warnten die um ihr Element bangenden Angler und Fischzüchter immer heftiger vor einer „Versteppung der Region“. Hinzu kamen die sowieso unzufriedenen Bergbauern, die sich durch die beginnende Erosion und Bodenabsenkung noch zusätzlich in ihrer Existenz bedroht fühlten. Und nicht zu vergessen ihre aufs Altenteil gesetzten Väter, die sich angewöhnt hatten, einen Großteil ihrer reichlichen Mußezeit auf einem Klappstuhl am Dorfweiher zu verbringen, mit einer Angelrute in ihren „von der Arbeit schwielig gewordenen Händen“.
Vielleicht waren sie es, (in der Nachkriegszeit hatten sie noch mit Karbid und Dynamit zu fischen gelernt hatten), die in der Folgezeit dann immer öfter Brunnenanlagen und Pumpstationen der städtischen Wasserversorgungsbetriebe in die Luft sprengten? Die Polizeibehörden in den umliegenden Kreisstädten sahen sich schon bald gezwungen, eine spezielle Fahndungstruppe gegen diese „Öko-Terroristen“ einzurichten (II).
Diese neuen militanten Verteidiger des in ökologischer Hinsicht längst als äußerst instabil eingestuften Status Quo der Landschaft nannten sich selbst jedoch „Hydro-Guerilla“, da Dreh- und Angelpunkt ihrer Aktionen der prekläre Wasserhaushalt des Vogelsbergs war. Eine verschärfte Bewachung der Abpumpanlagen konnte die Attentäter nicht einschüchtern. Als dann bei einem „Brandanschlag“ auch noch ein Baggerführer der Wasserpipeline-Firma getötet wurde – der, aus dem Vogelsberg stammend, selber eigentlich zu den aktiven Gegnern des „Wasserraubs“ gehört hatte -, besaßen die Kontrahenten sogleich einen Märtyrer, dem bald im außerordentlich hoher Symbolwert anhaftete.
Die eine Partei, nennen wir sie der Einfachheit halber „die Vogelsberger“ (um hier wenigstens einmal noch das Kollektive mit dem Regionalen zu verknüpfen), die Vogelsberger also reagierten sofort: Protestierend versammelte sich eine große Menge von ihnen auf dem Marktplatz von Nidda, wo sie lauthals den Stopp des Wasserraubs verlangten und zum Zeichen ihres Protests und der Trauer um den Toten auf einem Scheiterhaufen mitgebrachte schwarz-weiße Gummischwäne aus aufgeschlitzten Autoreifen verbrannten, wie sie dort seit den Sechzigerjahren, d.h. seit dem Beginn des Individualverkehrs mit Privat-PKWs, überall in den Vorgärten aufgestellt worden waren – als Teil der Eigeninitiative in den Kampagnen um den ersten Platz im jährlich wiederkehrenden Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“.
Die Jurys in diesen Wettbewerben setzen sich zwar aus Vertretern der an den jeweiligen Orten dominierenden Interessensverbänden zusammen, waren also gewissen konjunkturell bedingten Veränderungen unterworfen, aber der einmal bei ihrer erstmaligen Zusammensetzung formulierte Anspruch, eine „gepflegte Sachlichkeit“ zu fördern, hat sich seitdem nie wieder neuen Paradigmen im Zusammenspiel zwischen verstädterten Dörfern und verlandschafteten Städten zugewandt, geschweige denn selber welche kreiert.
Und doch scheint sich auch in diesen Gremien mit der Zeit eine gewissen Hydro-Sensibilität breit gemacht zu haben: Überall werden alte – teilweise verschüttete – Brunnen liebevoll restauriert; an die ausgetrockneten Löschteiche werden von der Lauterbacher Gartenzwergfabrik Meissner hergestellte große Figuren mit eindeutiger Angelausrüstung und -gestik aufgestellt, wahlweise aus Ton gebrannt oder aus Plastik gepresst; große farbige Hinweisschilder zeigen an, welche Quellen und Bäche früher wo verliefen; für jede Gemeinde wird ein eigenes Hallenschwimmbad gefordert – und auch genehmigt (als Ausgleich zumeist für die Verminderung der Lebensqualität in all den Orten, in deren unmittelbarer Nähe man ein Nato-Munitionsdepot oder eine andere militärische Einrichtung hingesetzt hat); und schon seit langem haben herumziehende Delphin-Shows die kleinen und mittleren Wanderzirkusse an Beliebtheit übertroffen. Im Sommer sind die Kurse im Synchron-Schwimmen überbelegt. Plötzlich beginnen sich auch alte, längst vergessene christliche Bräuche wieder zu regen – ich rede nicht von der Wassertaufe, sondern von den vielen Katholiken, die wieder darauf bestehen, am Freitag nur Fisch zu essen (es ist wie mit allem und überall: Was sich rar macht, wird kostbar und begehrt!). Wobei der Zusammenhang zwischen der auf dem Fels Petri erbauten Kirche und dem Fischergruß „Petri Heil“ sowieso nie ganz verschüttet war.
Als erst drei, dann sechs der Kreiskrankenhäuser aus Kostengründen von der Landesregierung geschlossen werden sollen, kommt es zu partiellen gemeinsamen Aktionen zwischen dem weniger militanten Flügel der Hydro-Guerilla und Teilen des gegen die Schließung ihrer Krankenhäuser protestierenden Personals.
Aus Gedern wird dazu der folgende Vorfall vermeldet: Dort agitierte der mit einer medizinischtechnischen Assistentin verheiratete Bademeister Karl Moeller vom Beckenrand aus sieben herumschwimmende Frauen für die Erhaltung des Gederner Krankenhauses. Seiner Meinung nach würden nur deswegen keine Frauen sich mehr auf die dortige gynäkologische Abteilung überweisen lassen, weil der ehemalige Stationsleiter und Frauenarzt Doktor Siebert „durchgedreht“ sei – er hätte nachts sämtliche Patientinnen auf den Flur befohlen, wo sie im Nachthemd in Reih und Glied Aufstellung nehmen und das Deutschlandlied singen mußten. Tatsächlich wurde dann ein Doktor Siebert aus Gedern in die mittelhessische Irrenanstalt Hadamar eingewiesen. Die Kreiskrankenhäuser, deren gynäkologische Abteilungen vor allem unter dem Trend zum Einkind, das dann auch noch in einer Hausgeburt zur Welt kommt, zu leiden haben, sind dazu übergegangen, mit einem sogenannten Unterwassergeburts-Angebot sich wieder attraktiv für ihre hochschwangere Klientel zu machen. Im Kreißsaal werden über Lautsprecher Walgesänge abgespielt, auf den Zimmern befinden sich nicht nur TV-Geräte, sondern auch Kalt- und Warmwasser-Aquarien, und in den Badezimmern sind spezielle Räume abgetrennt worden, in denen man einige vom amerikanischen Professor Lilly erfundene Isoliertanks aufgestellt hat. Sie sind halbgefüllt mit lauwarmem Salzwasser und lassen sich von innen schall und lichtdicht schließen. Angeblich soll die darin von Außenreizen gänzlich freie Atmosphäre, während der Körper sanft in einer Salzlauge vor sich hin dümpelt, dazu führen, daß die Angst vor dem zerstreuungs- und beschäftigungslosen „Horror Vacui“ einer „Gaudium Vacui“-Erwartung Platz macht, in der einem darüber hinaus pränatale – ja sogar präterrestrische, mithin also ozeanische – Erfahrungen wieder zugänglich werden. Erfahrungen, über die unter Wasser geborene Kinder von vornherein noch verfügen, was sie zum Beispiel befähigt, sich ohne große Scheu und Umstellung mit den Delphinen in den Wander-Shows zu verständigen, selbst die dort nur selten gezeigten Killerwale sind ihnen nicht fremd (III)
Man muß dazu anmerken, daß diese sogenannte „lnterspecies Communication“ eine lange Tradition im Vogelsberg hat. Seit den frühen sechziger Jahren bereits war dort der CB-Funk weit verbreitet, eine Bewegung von Hobbyfunkern, für die seit jeher Verständigungsschwierigkeiten zwischen verschiedenen Arten nichts weiter bedeuteten als Probleme bei der Feineinstellung von Frequenzen: „Jaguar ruft Windrose! Bitte kommen!“ – Um nur ein Beispiel zu nennen.
Im Laufe der Funk-Zeit hat diese Identifikation mit einer als Code-Wort verwendeten Spezies die seltsamsten Blüten getrieben: Eine CB-Funkerin aus Gelnhausen beispielsweise, die im Äther auf „Flußpferd“ reagiert, sammelte mit den Jahren so ziemlich alles verfügbare Bildund Schriftmaterial über dieses noch von Alfred Brehm als „äußerst dumm und heimtückisch“ beschriebene Säugetier; ein anderer CB-Funker – „Barracuda Birstein“ – nahm nach der Aufstellung einer großen Mehrbereichsantenne in seinem Garten ein seltsam raubfischhaftes Aussehen an; ähnlich erging es seinem Funkkollegen in Herbstein namens „Tümmler“, der immer irgendwie tranig wirkte …
Genug dieser Interspecies Metamorphosen, die darüber hinaus noch eine erdgeschichtliche Dimension beinhalten: Wie man mittlerweile weiß, begann vor 65 Millionen Jahren die geologische Neuzeit der Erde, in deren Tertiär das gesamte Gebiet um das Kinzigtal Teil eines Meeresarmes war, der das Nordmeer mit dem Mittelmeer verband (entstanden war er durch den Einbruch des Oberrheingrabens). Mit der Zeit wurde daraus ein Binnenmeer, das dann vom Spessart aus langsam verlandete. In den Lilly-Isoliertanks der Kreiskrankenhäuser von Schlüchtern und Salmünster gelang es nun einigen Patienten wiederholt, an diese verschütteten binnenozeanischen Erfahrungen anzuknüpfen, die immer noch in Form von Arche-Typen durch den Vogelsberg wabern (IV)
Anfang der Achtzigerjahre publizierte ein Social-Fiction-Autor in Bobenhausen II – Mathias Horx – mehrere literarische Rekonstruktionen des sozialen und technologischen Elements (nach einer atomaren Katastrophe im Vogelsberg). Wie hätte er voraussehen können, daß in Wirklichkeit eine Rekonstruktion des nassen Elements dort auf dem Plan stand, genauer gesagt: eine Simulation desselben? Dies geschah vor allem dadurch, dass man es sich mythisch auflud und mit mystischen Qualitäten gleichsam anreicherte – so erhielt man „schweres Wasser“ (das dem in den Dreißiger Jahren in Norwegen produzierten nicht unähnlich war – vergleiche dazu H.M. Enzensbergers „Norwegen“-Essay, in dem er ein oberhessisches Frauenkneipen-Kollektiv kurzerhand nach Oslo verlegt hat).
Was die versiegenden Bäche kurzfristig immer wieder neu entstehen ließ und den Anglern jedesmal wieder Anlaß zu neuen Hoffnungen gab: die Niederschläge an saurem Regen, hatten bald die nicht-unterglaste und nicht-künstlich bewässerte Rest-Vegetation in der Region fast völlig zerstört. Seltsam, in dem Moment, wo man fast nur noch das mühsam und zudem äußerst kostbare Brunnenwasser zur Verfügung hatte, ab diesem Zeitpunkt etwa klassifizierten mehrere Psychiater in den kreisstädtischen Krankenhäusern bei etlichen Fällen das von ihnen diagnostizierte Syndrom „Wasserscheu“ als endogene Psychose.
Noch seltsamer, daß erst dann damit begonnen wurde, die Fließwasserenergie an den noch erhaltenen Wassermühlen zu nutzen, als die Bäche und Flüsse fast völlig versiegt waren. Man verwendete statt dessen ebenfalls Brunnenwasser, das umständlich und teuer hochgepumpt auf die Mühlräder geleitet werden mußte, anschließend floß es in die Gewächshäuser und auf die niederschlagsgeschützten kleinen Felder. „Wasserkunde“ wurde zu einem Unterrichtsfach an den Grund- und Hauptschulen, in den gymnasialen Oberstufen kam noch das Fach „Strömungslehre“ hinzu; an der Gesamthochschule Kassel wurde „Wasserkraftforschung“ betrieben.
Die Wünschelrutengänger – Hydromanten – hatten Hochkonjunktur. Aus Schotten wird von einem solchen, der zuvor jahrelang als Formblattvertreter gearbeitet hatte, berichtet: Während er noch als Vertreter im Kreis herumfuhr, hatte er immer wieder auf Parkplätzen eine Pause eingelegt, sich die Karteikarten seiner nächsten Kunden vorgenommen und dabei überlegt, was er bei seinem letzten Besuch mit ihnen geredet, wie hoch ihre letzte Bestellung gewesen war. Dabei passierte es ihm dann, daß seine Kunden, wenn er bei ihnen ankam, jedesmal bemerkten: „Verrückt, daß Sie jetzt gerade kommen, eben haben wir von Ihnen gesprochen!“ Von einem anatolischen Kunden aus Ober-Seemen erfuhr er dazu ein türkisches Sprichwort: „Der gute Mensch kommt aufs Wort“. Die deutsche Verkäuferin im Kaufhaus Kempel in Ulrichstein meinte dagegen: „Wenn man vom Teufel spricht…“ Ein zufällig in diesem Laden anwesender ostfriesischer Sommergast, der sich auch durch die erheblich verminderte Erholungsqualität des Vogelsbergs aufgrund erodierter Höhen und Hänge nicht von seinen Urlaubsgewohnheiten abbringen ließ, beruhigte ihn jedoch: „De düwel is so swat nich, as huum oft malt“. Der Formblattvertreter machte sich schließlich diese Parkplatz-Telepathie zunutze und erledigte seine Aufträge nur noch vom Schreibtisch aus, indem er der Reihe nach an seine Kunden dachte, d.h. über ihre Karteikarten meditierte, woraufhin die Adressaten ihm prompt und schriftlich ihre Bestellungen zuschickten.
Dieser merkwürdige Vorfall hat insofern etwas mit Wasser zu tun, als diese Art der Geschäftsabwicklung per morphischer Resonanz sich streng an den Verlauf der ehemaligen Flüsse in dieser Region hielt und zwar funktionierte sie flußaufwärts besser als abwärts, was seit jeher in etwa der Ausbreitung neuer Ideen und Gedanken entsprach – die Vogelsberger erwarteten demzufolge anscheinend nach wie vor alle Erneuerungen und neuen Errungenschaften vornehmlich aus den umliegenden Niederungen (V). Dorthin schickten sie jedenfalls ihre „Bestellungen“.
Den Formblattvertreter brachten diese Erkenntnisse auf die Kunst des Wünschelrutengehens. Überhaupt wurde mit der Zeit das Gehen immer attraktiver bei den Vogelsbergern. Allerdings verwandelte sich dabei der frühere „Wanderer“ mehr und mehr in einen Flaneur, der nicht mehr in gerader Linie zu einem Ziel nach Dort aufbrach, sondern im Hier und Jetzt hin und her wandelte. Sowohl im Städtischen als auch im nicht mehr davon unterscheidbaren Dörflichen sprach man nur noch vom „Wandler“, der bei seinem Herumschlendern den Vektor gegen Null brachte und die Vielheit der Richtungswechsel maximierte.
Erinnern wir uns: diese Phänomene nahmen ihren Anfang mit der Entstehung und den Aktivitäten der Hydro-Guerilleros, die nächtens in der Gegend herumschlichen und dabei (als Liebespaare mitunter getarnt) Brunneneinrichtungen und Pumpanlagen der städtischen Wasserversorgungsfirmen im Vogelsberg in die Luft sprengten. Eine dieser wahrscheinlich aus Jungbauern zusammengesetzten Gruppen nannte sich in ihren sogenannten Bekennerbriefen „Initiative Lebensfreudiges Kinzigtal“. Sie unterschied sich insofern von den anderen Bombenlegern, als sie ziemlich wahllos nächtens alle Planierraupen mit einem selbsthergestellten Nitroglyzeringemisch explodieren ließ, also auch solche Baumaschinen, die nur zur Straßenausbesserung verwendet wurden.
Kommen wir nun von diesen „Explosés“ über den immer genauer hinschauenden „Wandler“ zum neuen „Implosions“-Paradigma.
Nachdem der ehemalige Oberförster Trauberger aus Wächtersbach (VI) einige Jahre lang in seinen Gewächshäusern mit Bonsai-Bäumchen-Kulturen experimentiert hatte, vergeblich, legte er sich einen kleinen künstlichen Bachlauf unter Glas an, in dem er fortan Forellen beobachtete. Dabei machte er die Entdeckung, daß diese Fische nicht mittels einer schnellen Bewegung ihrer Schwanzflossen flußaufwärts springen, sondern weil sie in der Lage sind, die durch das herabstürzende Wasser entstehenden Strudel für sich zu nutzen – sie machen sich darin steif, werden herumgewirbelt und gleich darauf nach oben geschleudert. Diese Beobachtung teilte Trauberger den Mitarbeitern der kirchlichen Heimfortbildungsstätte bei Wittgenborn auf dem „Weiherhof“ mit. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe zog man dann erste noch vorsichtige Schlußfolgerungen daraus, die in der Folgezeit in einer Serie von Experimenten erhärtet wurden. Ihre Erkenntnisse bestätigten eine alte Vermutung, die neben einigen Pflanzenphysiologen auch schon Goethe gehegt hatte: „Es waltet in der Natur ein allgemeiner Spiralismus!“
Diese Spiralbewegung wurde von den Wittgenbornern als „saugendes implosives Gebilde“ bezeichnet, wobei die Kunst ihrer Nutzbarmachung darin besteht, jene Spiralkurve zu finden, in der sich das Wasser, das durch sogenannte Drallrohre gedrückt und darin spiralisiert wird, von seiner Führungswand löst, sich also widerstandlos spezifisch verdichten läßt, zentripetiert und dabei abkühlt. Das in einem solchen System spiralisierte Wasser entwickelt sich zu einem Sogkolben, wobei es sich von Windung zu Windung beschleunigt und verdichtet. Es kann damit eine Maschine angetrieben werden, deren Implosionskräfte (nach Prof. Ehrenhart) 127mal stärker als Explosionskräfte sind. Im Prinzip sieht eine solche Implosions-Maschine so aus, daß mehrere Drallrohre, die auf einem konischen Rotor montiert sind, strahlenförmig von einem Sammeleinlauf abgehen. Durch die Drehung des Rotors erfolgt eine zentrifugale Beschleunigung der Rohre, womit ein sofortiges Einrollen des darin befindlichen Wasser bewirkt wird, das sich dabei abkühlt und verdichtet. Beim Ausstoßen dieses „Wasser-Zopfes“ werden hohe Rückstoßkräfte frei, die in Antriebskraft umgesetzt werden können.
Eine solche Antriebskraft kommt einem Perpetuum Mobile Zweiter Ordnung gleich und ist somit geeignet, das zweite Gesetz der Thermodynamik zu widerlegen. Ein Gesetz, von dem der Kunstkritiker und Historiker Arnheim einmal behauptet hat, daß Europa es bei seiner ersten Formulierung (durch Carnot) deswegen so begierig aufgriff, weil sich damit alles, was scheinbar den Bach runterging, erklären ließ: „Die Sonne wurde kleiner und die Erde kälter, und der allgemeine Zerfall in einen Zustand der Entropie ließ sich bis in die sinkende Armeedisziplin, in die gesellschaftliche Fraktionierung, in die abnehmende Geburtenrate, in die Verödung der Landstriche und in die Zunahme von Geisteskranken und Tuberkulose etc. hinein aufspüren“ (heute würde man statt Tuberkulose vielleicht Aids und BSE anführen!).
Trauberger hat einmal die Implosions-Energie als „weiblich“ bezeichnet, im Gegensatz zum‘ Explosions-Modell, das ihm ein „männliches Phantasma“ zu sein schien, wobei er schon das implosionserzeugende Element „Wasser“ als etwas genuin Weibliches begriff.
Wie dem auch sei, zusammenfassend läßt sich sagen, daß in einer Region, deren soziale und ökologische Entropie schon ziemlich weit fortgeschritten war, daß gerade dort versucht wurde, den Zusammenbruch der ineinandergreifenden Systeme mittels explosiver Mittel und Strategien aufzuhalten, wobei man im weiteren Verlauf dieser sich radikalisierenden Auseinandersetzung schließlich auf eine ganz andere Denk- und Sichtweise stieß: Auf implosive Gebilde, die in ihrer Anwendung dann die gesamte Entropie schließlich widerlegten.
Jetzt, wo man bereits begonnen hat, über die einst umkämpften städtischen Pumpanlagen Wasser (aus Rhein, Main und Lahn) wieder zurück in den verkarsteten und verödeten Vogelsberg zu transportieren, um gewisse Rekultivierungsversuche zu unternehmen (VII) – jetzt wage ich eine kleine Vorausschau: Die Land- und Forstwirtschaft und damit zusammenhängend die gesamte Ökologie der Region wurde nicht durch den unterirdischen Angriff in Form von konzentrierter Wasserentnahme und Nitratverseuchung des Grundwassers zerstört, auch nicht durch oberirdische Einflüsse wie Luftverschmutzung und sauren Regen, sondern dadurch, daß das gänzlich immaterielle morphogenetische Feld der voneinander abhängigen (man sagt auch „vernetzten“) Flora und Fauna immer wieder gleichsam zerhackt und zerschnitten worden ist.
Beim derzeitigen Aufbau eines neuen „Feldes“ im Zusammenhang mit den Rekultivierungsarbeiten wird man von vornherein an der „Morphogenese“ partizipieren, und man tut gut daran, dies bewußt zu tun, wenn man verhindern will, daß die frisch wiederaufgeforsteten kleinen Wälder ebenso wie die zögernd wieder fließenden Bäche erneut, von tiefer Mutlosigkeit ergriffen eingehen bzw. versiegen. Um es mit Nietzsche zu sagen: „Wille kann natürlich nur auf Wille wirken und nicht auf Stoffe (auf ,Nerven‘ beispielsweise). Genug, man muß die These wagen, daß überall, wo Wirkungen anerkannt werden, Wille auf Willen wirkt.“
In der überregionalen Zeitschrift „Angel-Woche“, in der sonst nur eines zählt – „Prachtbrassen“, „Traumhechte“ und „Superforellen“, und die farbig fotografiert, gemessen und gewogen, fand ich neulich einen Artikel von einem Fischer aus Obervolta, er begann mit dem Satz: „Ein Angler, der nicht mit den Fischen redet, ist verrückt“. Das scheint mir schon mal ein guter Anfang zu sein, obwohl für Petrijünger eigentlich selbstverständlich.

Alle Wasser-Photos, bis auf dieses, wurden von Männern geknipst.
Fußnoten:
(I) Seltsam: Kurz zuvor war der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan nach Caracas gereist. Von dort schrieb er einen Brief an seine Ecole Freudien de Paris, in dem er sie für aufgelöst erklärte. Ferner behauptete er darin, daß die Frösche eine große Eleganz bei der Paarung zur Schau stellen würden, die Menschen dagegen nicht. Und das sei doch wohl das wesentliche Problem, mit dem die Psychoanalyse es zu tun habe. Am nächsten Tag starb Lacan.
(II) In diesen Zusammenhang gehört vielleicht das Phänomen, daß damals die rot umrandeten Fahndungsplakate für die letzten noch frei herumlaufenden Stadt-Terroristen (von der RAF), die überall auf den Ämtern und selbst an den Buswartehäuschen, den Treffpunkten der dörflichen Jugend, aushingen, und auf denen verhaftete bzw. erschossene „Gewalttäter“ mit Kugelschreiber oder Filzstift durchgestrichen wurden – daß die Umrandung dieser Fahndungsplakate plötzlich von rot in grün umgeändert wurde, von irgendeinem hellsichtigen Verwaltungsbeamten mit Entscheidungsbefugnis im Öffentlichkeitsreferat des Bundeskriminalamtes (BKA). Anschließend fand man auf vielen dieser grünumrandeten Fahndungsplakate im Vogelsberg den handschriftlichen Zusatz: „Besser am Stammtisch als in Stammheim!“
(III) Die Killerwale, die in großen Glasbecken bikini-bekleideten Schwimmerinnen das Oberteil aufknüpfen, haben mit diesem Kunststückchen die in Oberhessen früher beliebten Damen-Schlammcatch-Shows völlig verdrängt.
(IV) Der französische Schriftsteller Romain Rolland schrieb einmal an seinen Freund Sigmund Freud, nichts beglücke den Menschen so sehr wie ein „ozeanisches Lebensgefühl“ (eine umfassende Metapher für das, was Carol Gilligan als „Verbundenheit“ beschreibt). Freud notierte dazu, ein solches Gefühl sei wohl eine Illusion, er könne jedenfalls nichts Entsprechendes in sich entdecken. Damals war die Zeit anscheinend noch nicht reif dafür. Die Menschheit brauchte anscheinend erst einmal die Erfahrung des „Umkippens von ganzen Gewässern“ (Horst Stern).
(V) Ganz anders – entgegengesetzt – vermutete es seinerzeit Novalis, als er meinte: „Abwärts treibt der Sinn!“
(VI) …Dessen Beziehungen zur Hydro-Guerilla mehrmals Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen waren, die aber nie ganz geklärt werden konnten, er war jedenfalls – vorzeitig pensioniert – ein erbitterter Gegner des „Wasserraubs“.
(VII) Übrigens stehen dabei wieder an vorderster Front – wie seit eh und je – die sogenannten „Kulturfrauen“, das ländliche Pendant zu den städtischen „Trümmerfrauen“.

Inzwischen sind über 20 Jahre vergangen, es gibt das Internet und darin Wikipedia – und dieses ist sich ganz sicher:
Über den Vogelsberg verläuft nicht nur ein Abschnitt der Rhein-Weser-Wasserscheide, sondern auch (Weser- bzw. Fulda-intern) die Wasserscheide zwischen Eder bzw. Schwalm und Unterer Fulda sowie (Rhein-intern) die zwischen Main und Lahn. In seinen Hochlagen befindet sich der Naturpark Hoher Vogelsberg.
Über die Wasserversorgung heißt es:
Bereits 1876 wurden dazu Quellen im östlichen Vogelsberg gefasst und der Bau einer Wasserleitung aus dem Spessart und dem Vogelsberg nach Frankfurt am Main fertig gestellt. Ein Unverständnis für die besondere hydrogeologische und ökologische Situation im Vogelsberg und zu hohe Entnahmen hatten zur Folge, dass Quellen ausfielen, Setzungsrisse in Gebäuden entstanden und streckenweise der Boden absackte. Die Oberhessischen Versorgungsbetriebe AG (OVAG) sind die größten Wasserförderer im Vogelsberg: Sie pumpen jährlich ca. 30 Millionen Kubikmeter Grundwasser aus ihren Brunnen; davon werden ca. 2/3 ins Rhein-Main-Gebiet an die Stadt Frankfurt am Main abgegeben.“
Der „Lauterbacher Anzeiger“ druckte den Bericht einer Schülerin der Lauterbacher „Vogelsbergschule“, Angelina Karn, ab, die mit ihrer Klasse die OVAG-Zentrale besucht hatte. Sie schrieb anschließend:
Die OVAG sponsert die Kultur (Naturschutz, Förderungen „Wasser bildet“ und „Unterricht in der Natur“), veranstaltet Lesungen („Friedberg lässt lesen“ und „Vulkan lässt lesen“) und setzt sich für die Jugend ein. Sehr beliebt ist der Jugend- Literaturpreis, an dem im Durchschnitt 300 Jugendliche pro Jahr teilnehmen. Daneben organisiert diese Abteilung kulturelle Veranstaltungen, wie Konzerte und so weiter. Die Abteilung „Marketing“ hat nur drei Mitarbeiter. Die Leiterin Britta Adolph beschreibt die Teile bei der Absatzpolitik. Dazu zählen Distributionspolitik, Kommunikationspolitik, Produktpolitik sowie die Preispolitik. Sie beobachten den Markt, analysieren ihn und entwickeln Produkte, die sie dann wiederum vermarkten. Daneben kümmern sie sich um die Werbung, das heißt sie legen Werbeziele fest, erstellen einen Werbeplan für das Jahr, planen ihre Ziele und Aktionen, und organisieren Kundenveranstaltungen oder Messeauftritte. Die Gewinne, die die OVAG im Jahr erzielt, teilt sie auf die drei Kreise (Vogelsberg, Gießen und Wetterau) auf. Diese drei Kreise sind letztendlich die Eigentümer des Unternehmens. Sie fördern die Natur und setzen sich für den Naturschutz ein.

Im Herbst 2009 beschäftigte sich das Online-Magazin „Vogelsberg-Netz“ mit dem „Vogelsberg-Wasser – zwischen kommunaler Daseinsvorsorge und Privatisierung“:
Ende September wurden die Ergebnisse von mehreren Jahren Recherche über die Entwicklung und Folgen der Privatisierung des Vogelsbergwassers in einer Studie der Schutzgemeinschaft Vogelsberg e.V. vorgestellt. „Der Vogelsberg kann exemplarisch für den Rest der Welt stehen“, trug Dr. Hans-Otto Wack, Geschäftsführer der SGV, im Infozentrum Hoherodskopf vor. Dass international agierende Konzerne kommunale Wasserversorgung übernehmen, wäre global zu beobachten, im Vogelsberg hätte man es im Bereich der Stadtwerke Gelnhausen ebenfalls schon mit einem Konzern zu tun, der E.on Mitte.
Die „Schutzgemeinschaft“ ist eine Bürgerinitiative, die sich 1994 gegründet und es dann laut eigener Einschätzung geschafft hatte, „gemeinsam mit allen Beteiligten vom Raubbau zur umweltschonenden Wasserförderung zu kommen“.
Laut BI-Recherche „liegt heute die jährliche Wasserförderung im Vogelsberg nur noch bei 44 Millionen Kubikmeter. Im Jahr 1985 förderte man aus dem Vogelsberg jährlich 64 Millionen Kubikmeter Wasser. Planungen sahen damals sogar noch die doppelte Menge vor, was nach und nach reduziert wurde. Heute werden die Förderpumpen abgestellt, wenn das Grundwasser an den Messstellen unter eine bestimmte Marke sinkt.“
Zum Wert des Wassers meint die SGV in ihrer 51-seitigen Studie: „Wasser ist Leben“ – ob Wasserwerker, Politiker, Investmentbanker oder Umweltschützer: Redner und Autoren benutzen diesen arg strapazierten Satz regelmäßig, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Dabei ist er nicht nur abgedroschen, sondern auch falsch, denn Wasser ist auch Tod. Hochwasser oder mit Krankheitserregern verschmutztes Wasser lassen tagtäglich Tausende von Menschen sterben. Diese Fehlleistung von führenden Köpfen unserer Gesellschaft zeigt, dass über Wasser zu wenig gründlich nachgedacht wird – vor allem von denjenigen, die Wasser im Überfluss nutzen können bzw. es zu besitzen‘ glauben. Das bekommen tagtäglich viele Menschen in Entwicklungsländern zum letzten Mal in ihrem Leben zu spüren. „Gutes Wasser ist Leben“ muss es heißen – wobei das Wort gut für „lebensfördernd“ steht. Gutes Wasser ist eine lebensnotwendige Substanz. Wassermangel führt innerhalb von Stunden zu körperlichen Funktionsstörungen und innerhalb weniger Tage zum Tod. Auch in Deutschland ist es noch nicht sehr lange her, dass die Cholera, ausgelöst durch verseuchtes Oberflächen- und Brunnenwasser, Städte wie Hamburg oder Frankfurt heimsuchte. Solche Epidemien waren u.a. der Auslöser für den Bau der ersten Wasserleitung vom Vogelsberg nach Frankfurt 1879.
Grundsätzlich steht die SGV auf dem Standpunkt, dass Wasser und Luft ein freies Gut sind und sich denkbar schlecht zur privatwirtschaftlichen Handelsware eignen. Für ihre Studie hat die Organisation die vier größten Wasserförderer des Vogelsberges anhand verschiedener Kriterien – Verwendung der Gewinne, Transparenz des Unternehmens und Umweltschutz – miteinander verglichen. Die Vorsitzende der Schutzgemeinschaft, Cécile Hahn, begrüßte bei der Präsentation unter den interessierten Zuhörern auch Peter Hög, den Leiter der Abteilung OVAG-Wasser, sowie den Geschäftsführer des Wasserverbandes Kinzig, Holger Scheffler. Beide Wasserförderer wurden von der Schutzgemeinschaft in ihrer Studie unter die Lupe genommen wie auch die E.on Mitte und die Stadtwerke Gießen. Die Stadtwerke Gießen, die bei Grünberg-Queckborn ein Wasserwerk betreiben, sind zu 100 Prozent kommunal. Ihre Gewinne fließen an die Stadt Gießen und kommen somit den Bürgern zugute. Die Transparenz dabei ist groß, der Umweltschutz allerdings nicht. Die Oberhessische Versorgungs AG, OVAG, fördert unter anderem in Hungen-Inheiden Wasser. Das Unternehmen gehört zu 100 Prozent einem Zweckverband, der wiederum von den drei Landkreisen Gießen, Wetterau und Vogelsberg verwaltet wird. Auch hier fließen die Gewinne zurück in die Kommunen, die Transparenz ist groß. Die OVAG, die 127 Kommunen mit Wasser versorgt, ist in der Studie die einzige, die freiwillig „Naturschutz in beträchtlicher Höhe umsetzt“. Der Wasserverband Kinzig mit Sitz in Wächtersbach-Neudorf hat als zusätzliche Aufgabe den Hochwasserschutz übernommen und erzielt als interkommunaler Zusammenschluss keine Gewinne. Die Transparenz ist hier groß. In früheren Zeiten hat es jedoch Konflikte mit der SGV wegen der Wasserförderung in Brachttal gegeben, was sich seit dem Wechsel der Geschäftsführung änderte. Heute setzt der Wasserverband vermehrt umweltschonende Techniken bei der Wassergewinnung ein. Am schlechtesten schneiden aus Sicht der Studienverfasser die Vierten, die Stadtwerke Gelnhausen, ab. Sie gehörten zu E.on Mitte und stehen unter dem Druck, Rendite zu erwirtschaften. Die Transparenz des Unternehmens ist sehr gering und: „Es ist nicht feststellbar, dass das Unternehmen besondere Fortschritte im Umweltschutz macht.“
Die kommunalen Erwartungen an einen Wasserversorger müssten laut Hans-Otto Wack sein: dauerhafte Versorgung, sozial verträgliche Preise und demokratische Mitsprache. Es sei allerdings zu bezweifeln, ob dies bei einem solchen Konzern möglich ist. Wack kündigte an, dass die SGV ihre Studie demnächst in Berlin und Paris vorstellen und sie um den Bereich des Abwassers erweitern werde. In der anschließenden Diskussion meinte OVAG-Vertreter Peter Hög, dass im Falle einer Übernahme von Konzernen die Region an Wertschöpfung verliere. Das Thema „Wasser“ wäre zur Zeit gerade von der Agenda verschwunden, da käme so ein Papier zur rechten Zeit. Holger Scheffler führte aus, dass es durchaus positive Beispiele für eine Zusammenarbeit gäbe: im Main-Kinzig-Kreis beim Hochwasserschutz zum Beispiel. Kreis, Kommunen, Wasserverband und Land arbeiten gemeinsam an den Maßnahmen. Zum Schluss merkte der anwesende Schottener Stadtrat Willi Zinnel an, dass der Stadt Schotten immer noch ihre eigene Wasserversorgung zur Verfügung stünde und „gut damit fahre“.

Der „Vogelsberg-Kurier“ meldet am 3.4. 2010:
Kurz vor der Mittagsstunden wurden die Leitstelle Vogelsberg sowie die Polizeistation Alsfeld von einem Spaziergänger davon in Kenntnis gesetzt, dass sie in den Fischteichen zwischen Mücke-Bernsfeld und Gemünden-Burg-Gemünden eine leblose Person am Uferrand im Wasser liegend gefunden haben. Die Einsatzkräfte konnten allerdings nur noch den Tot feststellen. Anschließend wurde noch die Freiwillige Feuerwehr von Mücke-Nieder-Ohmen alarmiert. Sie mussten die Leiche aus dem Fischteich bergen. Etwa acht Einsatzkräfte von Nieder-Ohmen und Bernsfeld sowie der Gemeindebrandinspektor Stefan Hahn waren vor Ort. Auch der Bürgermeister aus Mücke, Matthias Weitzel war zur Unglückstelle gekommen. Unter Aufsicht der Kriminalpolizei die vor Ort war, wurde die Leiche aus dem Wasser von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr geborgen. Jedoch bevor sie in das eiskalte Wasser gingen und die Leiche zu bergen zogen sie sich erst entsprechende Kleidung an.
Der „Naturpark Hoher Vogelsberg“ bewarb im August 2010 seine Region wie folgt:
Wasser aus dem Vogelsberg sichert zu einem erheblichen Teil die Trinkwasserversorgung im Rhein-Main-Gebiet. Denn er ist einer der größten natürlichen Wasserspeicher Deutschlands. In seinen Basaltklüften speichert er riesige Grundwassermengen in ausgezeichneter Trinkwasserqualität. Für das Kluftgrundwasser ist Basalt ein guter Leiter. Es sucht sich durch die Gesteinsformationen seinen Weg an die Oberfläche. Zahlreiche natürliche Quellen im Vogelsberggebiet zeugen davon. Hier entspringen unter anderem die Nidda und Nidder, die Schwalm und Wetter, die Ohm und die Schlitz, die Horloff, Lauter und Felda.

Die „Giessener Allgemeine“ berichtete am 29.9.2010 vom Umwelttag in Hungen, wo u.a. über eine „Umweltschonende Grundwassergewinnung im Horlofftal“ diskutiert wurde. Neben einem NABU-Vertreter saß auch ein OVAG-Vertreter auf dem Podium. Er stellte sein Unternehmen vor:
Verkehr, Versorgungsbetriebe, Netz und Energie sind die vier Kerngeschäfte der OVAG, die sich auch in Förderprojekten für Umwelt und Kultur engagiert. Kernpunkt der Wassergewinnung mit insgesamt jährlich 35 Millionen Kubikmeter Wasser ist das Wasserwerk Inheiden, das 16 Millionen fördert. 21 Millionen Kubikmeter des Gesamtaufkommens fließen nach Frankfurt. Die OVAG setze sich verantwortungsbewusst mit den Herausforderungen der Zukunft auseinander, betonte Hög. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit seien kein Widerspruch. »Wir wollen auch in 200 Jahren noch Wasser verkaufen.« Man könne aber auch nicht an den Fixkosten vorbei, sodass weniger Verbrauch nicht billiger werde.
Als nächstes erklärte ein Forstdirektor die Bodenverhältnisse, die in dem ehemaligen Vulkangebiet zu einem großen nachfließenden Wasserreservoir führen. Nach ursprünglich höheren Förderungen habe 1993 ein Gutachten zu einer umweltschonenden Grundwassergewinnung geführt. Auf den „Kernpunkt Wasserwerk Inheiden“ eingehend sagte der Forstdirektor, bis 1961 habe es eine ganzjährige Vernässung des Gebietes gegeben. Die Förderung habe zu einer Absenkung des Wassers geführt, die für die Landwirte zunächst positiv für ihre Bewirtschaftung war. Es kam aber auch zu Trockenjahren mit Absinken des Grundwasserspiegels. Der Wechsel zwischen Trocken- und Nassperioden habe zu einem ständigen Wechsel der Fauna geführt. Ziel sei es, so Diemel, verschiedene Lebensraumtypen in dem FFH-Gebiet zu erhalten. Dafür habe es eine Verträglichkeitsprüfung für das Wasserrechtsverfahren Inheiden gegeben. Regelmäßig werden die Grundwasserstände und Oberflächenvernässungen beobachtet.
Halten wir fest: Die stetige Wasserentnahme führt, wie könnte es auch anders sein, zu einer unstetigen Flora, die es nun aber zu sichern gelte, durch gezielte Maßnahmen zur „Erhaltung verschiedener Lebensraumtypen“.
Der OVAG-Vertreter hatte in seinen Ausführungen bereits die harten Auseinandersetzungen angesprochen, die es vor etwa 20 Jahren gegeben hatte. Der Forstexperte sagte dazu, man habe schließlich zu einer sachlichen Diskussion gefunden und ein für alle zufriedenstellendes Ergebnis erzielt. Das Verfahren sei beispielhaft in Deutschland.
Dies wurde von einer Sprecherin der BI „Schutzgemeinschaft Vogelsberg“ abschließend noch einmal unterstrichen:
Die Wasserförderung habe zunächst dazu geführt, dass die Bäche weniger Wasser führten und stellenweise Risse in den Hauswänden entstanden. Seit 1990 würden konstant 40 Millionen Kubikmeter an 13 Stellen gefördert, von denen sieben zur OVAG gehören. Hahn nannte die Kriterien einer umweltschonenden Grundwassergewinnung. Wesentlichster Punkt seien die Grenzgrundwasserstände in den Vereinbarungen. Sie unterliegen ständiger Beobachtung. Sparsamer Wasserverbrauch ist ein besonderes Anliegen der BI-Sprecherin, die sich ebenfalls positiv zu den heutigen Vereinbarungen äußerte.
Die Frankfurter Rundschau berichtete am 30.9.2010 dennoch Kritisches über die OVAG:
Die Grünen sehen sich bestätigt: Der kommunale Stromversorger Ovag bekommt im neuen Heft von Öko-Test kein gutes Zeugnis für sein Natur-Strom-Angebot.Beim Vergleich der Öko-Stromtarife in der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift Öko-Test kam das Angebot „Ovag Natur“ des kommunalen Stromversorgers Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (Ovag) nicht besonders gut weg. Die Tester setzten ihn auf Rang vier, weil die Ovag auch Atom- und Kohlestrom verkauft. Der Atomstrom hat laut Öko-Test einen Anteil von 41,3 Prozent am konventionellen Angebot der OVAG, die fossilen Energieträger haben 32,5 Prozent, die erneuerbaren Energien 26,2 Prozent.
Der Grünen-Politiker Diethardt Stamm, der dem Ovag-Vorstand angehört und sich seit vielen Jahren für eine ökologische Ausrichtung des Unternehmens engagiert, sieht seine Kritik durch Öko-Test bestätigt. Der Ökostrom der Ovag stamme aus dem fast 100 Jahre alten Wasserkraftwerk in Lißberg. Durch diesen Strom ändere sich nichts an der Kohlendioxid-Bilanz. Nur ein neues Kraftwerk für erneuerbare Energien könne zur Klimaverbesserung beitragen, meint der Grünen-Politiker. Die Windkraft sei hier am besten zu nutzen.
Stamm wirbt für die Gründung einer Energiegenossenschaft, die dem kommunalen Unternehmen bei den dafür nötigen Investitionen unter die Arme greift, weil die Ovag nicht das Geld für den raschen Ausbau der erneuerbaren Energien habe. Die Ovag gehört den Landkreisen Wetterau, Vogelsberg und Gießen. Die Ovag müsse sich mit Bürgern, Kommunen, Vereinen, Sparkassen und Volksbanken, Firmen, Verbänden bis zu den Gewerkschaften und Stadtwerken zu einer Energiegenossenschaft zusammentun, um das Geld für diese Investitionen aufzubringen. In dieser Genossenschaft könne demokratisch über die regionale Energiewirtschaft mitentschieden werden und die Gewinne blieben vor Ort, erläutert Stamm.
Ovag-Vorstand Rainer Schwarz weist die Kritik von Stamm zurück. Dass die Ovag auch Atom- und Kohlestrom verkaufe, habe „damit zu tun, dass wir drauf angewiesen sind, für unsere Kunden einen Großteil des benötigten Stroms von den vier, den deutschen Markt beherrschenden Unternehmen zu kaufen, also leider kaum Einfluss auf deren Kraftwerke haben“. Stamm sieht in der Energiegenossenschaft die Chance für die Ovag, sich von den Energiekonzernen unabhängig zu machen. Mit ihrem Anteil von 26,2 Prozent aus erneuerbaren Energien liegt die Ovag laut Schwarz weit über dem Bundesdurchschnitt. Im Wasserkraftwerk Lißberg werde „reinster Ökostrom“ produziert. Der Tarif „Ovag Natur“ speise sich zu 100 Prozent aus regenerativer Energie, der TÜV Süd habe das zertifiziert. Die Ovag sei führend in Hessen bei der Produktion von Strom aus regenerativen Energien.
Wenn ich das richtig sehe, hat sich die alte Vogelsberger Konfliktlinie zwischen Autonomisten und Verhandlern nun in die OVAG verlagert – und dort zudem weg vom Wasser (außer als Energielieferant). Der Ethnologe Claude Lévy-Strauss hat einmal einen brasilianischen Mythos – vom Guten und vom Bösen Wasser – erzählt. Das Gute ist hier das unerschöpflich Turbinen antreibende und dadurch Energie liefernde Wasser und das Böse ist das auf Nimmerwiedersehen in den Großstädten verdampfende, verduschte oder sonstwie weggespülte Wasser. Wobei es hier – in den Städten, in Berlin z.B. derzeit – noch einmal die selbe Unterscheidung gibt: Gutes Wasser liefert ein vergenossenschaftlichtes Wasserwerk, schlechtes ein mit Geheimverträgen abgesichertes in den Händen eines obskuren Kapital-Konsortiums – wie es jetzt der Fall ist. Eine BI kämpft jedoch seit Jahren dafür, dass das einst kommunale Wasserwerk noch einmal – als Genossenschaft – privatisiert wird. Dazu sammelt sie derzeit Unterschriften. Noch geht all das relativ friedlich ab, aber die sogenannten Ermittler haben bereits ein Auge auf diesen „Konfliktherd“ geworfen, der wie jeder andere auch den „Öko-Terrorismus“ in Potentialität enthält. Dass die Kapital-Seite sich dessen schuldig machen könnte, kommt dieser Polizei nicht in den Sinn, dafür jedoch mit Sicherheit den „Regionalkrimi“-Autoren.
Die Natur- und Kultur-Arbeit der OVAG:
Während die OVAG-Arbeit mit der Natur und der Naturbegriff bei der OVAG durchaus umstritten sind, wie oben angedeutet, wird die Kultur-Arbeit der OVAG weniger kritisch gesehen. Wladimir Kaminer läßt sich z.B. gerne von der OVAG zu Lesungen nach Alsfeld, Friedberg und Lauterbach einladen. Neben einem guten Honorar bekommt er jedesmal auch noch einige Bücher geschenkt. Die OVAG – das ist auch ein Kulturverlag. Und dieser veröffentlichte z.B. 2005 gleich zwei Bücher, die mit Wasser und Elektrizität zu tun haben:
1. den Reader „Der Strom und das Wasser. Literarische Funken und Strudel“ – Kurztexte von Lukrez und Ovid über Hesse und Kafka bis zu Pamuk, Ken Kesey und den Regionalkrimiautor Henning Mankell.
2. „Das Buch vom ersten Kuss in Oberhessen“ – auch dabei geht es um elektrische und feuchte Ströme. Ein Kuß besteht aus 61 Milligramm Wasser, erklären dazu die Herausgeber und Martina Gerbig (39) aus Alsfeld fügt hinzu: Als sie mit 18 in der Disco Torsten wiedersah und ihm die Hand gab bekamen er und sie einen „gewaltigen Stromschlag“, ihre Schwester sah sogar, dass da „Funken sprühten“. Eine Vierundsechzigjährige Anonyma schreibt: 1955 tanzte sie auf der Kirmes die ganzen Abend mit einem Jungen aus dem Nachbardorf. Als sie nach Hause mußte, bekam sie vor dem Ausgang „einen Kuss…es war umwerfend. Zuhause habe ich in die Spiegel geschaut, um zu sehen, ob man mir etwas anmerkt“. Rosemarie Botzum (66) aus Hungen schreibt: „1952. Der erste Kuss mit 14. Ich dachte, ich bekomme ein Kind und rannte ganz schnell nach Hause.“
3. die umfangreiche Textsammlung „Aufbruch. Von Hier nach Dort. Von Gestern nach Übermorgen“. Dieses Thema hat mit der OVAG insofern etwas zu tun als die VGO – die Verkehrsgesellschaft Oberhessen – ihre Schwestergesellschaft ist. Und diese VGO spielt „seit der Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs 1995 eine zuverlässige und unverzichtbare Rolle für die Mobilität der Menschen.“
4. Nicht im Kulturverlag der OVAG erschienen ist der brandenburgische Regionalkrimi „Das dritte Zimmer“ von der Oberstaatsanwältin Gabriele Wolff. Schade. Er erschien im Innsbrucker Haymon-Verlag. Es geht darin um die Privatisierung der Immobilienverwaltung und -verwertung im (brandenburgischen) Finanzministerium – in eine GmbH oder AG, durch den Leiter der Behörde, um sie der politischen Einflußnahme zu entziehen. Dazu heißt es an einer Stelle:
„Ob es je einmal eine GmbH in Landeseigentum gegeben habe, die keine horrenden Verluste gemacht habe? Na bitte! Das verträgt sich nun mal nicht, das Bedürfnis nach wirtschaftlicher Geschäftsführung und Gewinnerzielung und Marktbehauptung. Einerseits. Und andererseits die ahnungslosen Politiker, die sich in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat tummeln und dort die Geschäftspolitik bestimmen, dabei aber nichts weiter im Sinn haben, als ihren Wahlkreisen schöne Projekte zuzuschanzen. Projekte, die aber leider nur auf dem Papier schön aussehen und sich in Wirklichkeit niemals rechnen. Solange die Kredite von der Landesbank kommen, in der sich dieselben Politiker tummeln, fällt die Schieflage über Jahre nicht auf. Dann aber wird’s fürchterlich…“
In Brandenburg gab es eine ganze Reihe solcher „Großprojekte“ von Politikern, die gescheitert sind: eine Chip-Fabrik, eine Rennbahn, einen Cargo-Lifter usw. Zwei Künstlerinnen bereiteten sie alle vor einiger Zeit im Rahmen einer Ausstellung in Potsdam eindrucksvoll auf. Anderswo passierte Ähnliches. Erwähnt sei der schon nach wenigen Wochen pleite gegangene „Space-Park“ in Bremen, das weltgrößte „Riesenrad“ am Berliner Zoo, die private „Energie-Universität“ am Schöneberger Gasometer, der „Nürburgring“ in der Eifel, wo sich derzeit schon wieder ein neuer Skandal anbahnt – um ein aufwändiges „Projekt“ des Ministerpräsidenten in seinem Heimatdorf.

ANMERKUNGEN:
(1) Von der Wasserforschung kamen wir eben auf Elaine Morgans feministische Wasser-Evolutionstheorie. Von da aus ist es nur ein Wimpernschlag bis zur Nixenforschung:
In Berlin entwickelte sich mit der Abwicklung des alten Instituts für Kulturwissenschaft und der Gründung eines neuen an der Humboldt-Universität auch eine Nixenforschung, die u.a. darin bestand, dass der Berliner Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler eine Schiffexpedition in die Gewässer um Capri, der Insel der Sirenen, organisierte, wo Odysseus sich einst ihrem Gesang ausgesetzt hatte. Nach einer der drei Sirenen, Parthenope, wurde später eine Stadt benannt, das heutige Neapel. Schon Goethe hatte sich dort in Sirenenforschung versucht: „Und nun nach allem diesem und hundertfältigem Genuß locken mich die Sirenen jenseits des Meeres, und wenn der Wind gut ist, gehe ich mit diesem Brief zugleich ab – südwärts“, schrieb er „leichtlebig“ aus Neapel, kam dann aber nie wieder auf seine Forschungsfahrt zu sprechen. Kittler brachte jedoch von seiner Kreuzfahrt zwischen Messina und Neapel, an der sich u.a. auch der Leiter des Tierstimmenarchivs der Humboldt-Universität, Karlheinz Frommholt, beteiligte, jede Menge audiovisuelles Material mit. Auf seiner CD „Musen, Nymphen, Sirenen“ erstattete er darüber auch schon Bericht. Aber seine Sirenenforschung ist noch nicht abgeschlossen. Ich, dessen Forschungsbegriff noch vom „Fischbüro“ in der Köpenickerstraße geprägt ist, erhoffte mir landeinwärts zusätzliche Aufklärung – aus der einst vom Biologen Anton Dohrn gegründeten Meeresforschungsstation in Neapel. Obwohl es die einzige jemals in einem Aquarium gehaltene „Sirenide“ dort nicht mehr gibt.

Wie der faschistische Theoretiker Curzio Malaparte in seinem Buch „Haut“ berichtet, wurde dieser „Fisch“, wie fast alle anderen in Dohrns Aquarien auch, 1944 vom Oberkommando der amerikanischen Streitkräfte, die Neapel eingenommen hatten, getötet – um anschließend von ihnen verspeist zu werden. Malaparte will selbst dabei gewesen sein. Weil aber dieses „zur Gattung der Sirenoiden gehörende Meerestier“ („dessen Flanken in einem Fischschwanz endeten – genau wie von Ovid beschrieben“) einem kleinen toten Mädchen zum Verwechseln ähnlich sah, habe eine der anwesenden weiblichen US-Offiziere darauf bestanden, den „Fisch“ stattdessen ordnungsgemäß im Garten zu bestatten. Es geht das Gerücht, dass er später wieder ausgegraben wurde und dass das Skelett sich heute im „Museo di Biologia Marina e Paleontologia“ von Reggio Calabria befindet (man kann es sich im Internet ansehen). Für die Amerikaner sind die Sirenen das, was wir „Seekühe“ nennen: pflanzenfressende Meeressäugetiere, die es nur noch in tropischen Gewässern gibt. Es gab auch noch welche in den sibirischen Gewässern: Sie wurden aber – nur 27 Jahre nach ihrer Entdeckung – ihres Trans und schmackhaften Fleisches wegen, ausgerottet (siehe dazu z.B. die Webpage „Sirenews“). Die einen wie die anderen Seekühe sehen jedoch weder wie die auf antiken Vasen dargestellten Sirenen aus, noch singen sie wie von Homer geschildert. Das gilt auch für die bis zu ein Meter langen Arten der Gattung „Siren“, die man auf Deutsch treffend „große Armmolche“ nennt, weil sie nur Vorderbeine haben, dazu Lungen und Kiemen.
Sie gehören zur Familie der „Sirenidae“, leben an der Küste Floridas, ernähren sich von Kleingetier und Pflanzen und halten Sommerschlaf. Bei dem von Malaparte beschriebenen „Speisefisch“ aus der „Zoologischen Station“ von Neapel könnte es sich eventuell um eine solche „Schwanzlurche“ gehandelt haben, dann ist sie allerdings nicht mit dem Skelett im Museum von Reggio Calabria identisch. Ich wollte es schon bei diesem (unbefriedigenden) Stand der Dinge bewenden lassen, aber dann entdeckte ich im neuen Medizinhistorischen Museum auf dem Charité-Gelände gleich zwei kleine in Alkohol eingelegte „Sirenen“. Es handelt sich dabei um tote Kinder, d.h. um in Spiritus eingelegte „menschliche Fehlbildungen“: Bei der einen – „Sirenoiden“ – fehlten „die Beinanlagen, der Harntrackt und die Geschlechtsorgane“ – der Körper ging stattdessen ab der Hüfte in eine Art Schwanz über. Der anderen – „Sirenomelie“ – fehlten „Beine, Geschlechtsorgane, Niere, Blase und Enddarm“. Beide waren also nicht lebensfähig, man ließ sie wohl gleich nach der Geburt sterben. Wenn ich nicht irre, befanden sich die Exponate früher in der Anomaliensammlung auf dem Gelände des Veterinärmedizinischen Instituts der Humboldt-Universität – und wurden erst kürzlich in das neue Medizinhistorische Museum überführt, bei dessen minimalistisch-modernistischem Aufbau jetzt das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte federführend ist. Aus dessen Reihen wurde kürzlich auch eine Recherche – als „Preprint“ – veröffentlicht, in der der Autor den Namen der Mutter von einem der Sirenoiden ausfindig gemacht hatte. Für die zwei ausgestellten „sirenoiden Fehlbildungen“ machen die Kuratoren der Ausstellung „übermässigen Alkoholgenuß der Mütter“ verantwortlich, der Autor der Einzelfallrecherche äußert sich dazu nicht.
Kürzlich gelang es, eine solche „Sirenomelie“ – heute kommt schon auf 70.000 Geburten eine – operativ so zu korrigieren, dass das Kind, namens Milagros Ceron, nun lebensfähig ist. Die Berliner Lokalpresse interessierte sich seltsamerweise sehr für das „Meerjungfrauensyndrom“ des kleinen peruanischen Mädchens und seine Heilung. Zuvor hatten die Berliner Medien bereits ein regelrechtes „Seekuhfieber“ entfacht gehabt – nachdem der neue West-Direktor des Ost-Tierparks ein großes Becken mit fünf Seekühen „aus den Sümpfen Floridas“ eingerichtet hatte. Täglich steigt seitdem ein Tierpfleger in Taucheranzug zu ihnen in die Tiefe, um sie zu liebkosen – d.h. mit ihnen zu kommunizieren, wie man heute sagt. „Die brauchen das“, erklärt er eins ums andere Mal der Presse, nachdem er – noch nass – aus dem Wasser gestiegen ist.
Neben all diesen aktuellen Bemühungen gilt es, auch eine alte „Nixenforschung“ wieder zu entdecken: Noch im 18. Jahrhundert hatte der dänische Anatom Caspar Bartholin diese Wassernixen zusammen mit den Menschen und Affen als „homo marinus klassifiziert Vor allem hatten es die Nixen damals jedoch den Dichtern angetan:

Angefangen mit den homerischen „Sirenen“ des Odysseus, der seiner Schiffsmannschaft die Ohren verstopfte, um sie vor deren „verderblichen Gesang“ zu retten. In Goethes Gedicht „Der Fischer“ ist es dann ein „feuchtes Weib“, das dieser vor sich im Wasser auftauchen sieht: „Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;/ Da war’s um ihn geschehn:/ Halb zog sie ihn, halb sank er hin/ Und ward nicht mehr gesehn“. In Heinrich Heines berühmten Gedicht über „Die Heimkehr“ wird aus den Sirenen eine langhaarige Flußnixe: „…Ich glaube, die Wellen verschlingen/ am Ende Schiffer und Kahn;/ Das hat mit ihrem Singen/ die Loreley getan“. Auch in dem mehrfach als Oper und Ballett auf die Bühne gebrachten romantischen Märchen von Friedrich de la Motte Fouqué „Undine“ umwirbt eine kleine reizende Nixe aus dem „Mittelländischen Meer“ einen Mann mit Gesang: um durch Vermählung mit ihm in den Genuß einer Seele zu kommen. Nachdem er sie als Hexe beschimpft hat, verschwindet sie jedoch wieder im Wasser, d.h. „verströmt sich“ – um ihn zuletzt mit einem zärtlichen Kuß in den Tod zu befördern. Der Autor hat sich dabei von einer Schrift des Paracelsus aus dem Jahr 1590 inspirieren lassen: das „Liber de Nymphis, Sylphis, Pygmaeis et Salamandris, et de caeteris spiritibus“, das zunächst die allerchristlichsten Hexenverfolger auf die Idee der „Wasserprobe“ gebracht hatte.
De la Motte Fouqués „Undine“ war dann Vorbild für Hans-Christian Andersens „kleine Meerjungfrau“, und zuletzt für Ingeborg Bachmanns frühfeministische Erzählung aus dem Jahr 1961: „Undine geht“. Auch hier wendet sich die Frau, wieder „unter Wasser“, noch einmal, ein letztes Mal, an den Mann, an die Männer – „Ungeheuer und „Verräter allesamt“. Dann verstummt sie.
Kafka schrieb: „Nun haben aber die Sirenen eine noch schrecklichere Waffe als ihren Gesang, das ist ihr Schweigen“.
Einen schönen Überblick über die ganzen Undine-Bearbeitungen – von Paracelsus über die Romantiker bis zu Joanna Russ – bietet die Dissertation von Gerlinde Roth: „Hydropsie des Imaginären. Mythos Undine“, erschienen im Centaurus-Verlag, Pfaffenweiler 1999.
Sowie die Studie des Frankfurter Literaturprofessor Andreas Kraß, die im Fischer-Verlag Wissenschaft erschien: „Meerjungfrauen. Geschichten einer unmöglichen Liebe“. Dieses literarische Motiv reicht bei ihm laut Klappentext „von Homer über Andersen und Ingeborg Bachmann bis hin zu Disneys Arielle“.
Außerdem sei noch ein Reader von Enn Vetemaa erwähnt: „Die Nixen in Estland – ein Bestimmungsbuch“. Es erschien auf Deutsch 1985 in dee „Spektrum“-Reihe des Verlags Volk und Welt, jedoch nicht aus dem Estnischen, sondern aus dem Russischen übersetzt, dafür aber mit zwei Nachworten auf Französisch und auf Plattdeutsch.

In all den Werken über Meerjungfrauen, Nixen und Undinen vermisse ich den Hinweis über die unendlich vielen Mädchen, die sich in der Vergangenheit mit einem Mann einließen, schwanger wurden, und deswegen „ins Wasser“ gingen, also im Mühlbach oder im nächsten Fluß bzw. See Selbstmord begingen. Sind ihre Wasserleichen nicht der realgeschichtliche Hintergrund für all diese sehnsüchtigen Werke über die im Wasser lebenden Jungfrauen, die sich in einen Mann auf dem Trockenen verlieben und ihm dorthin folgen – wo sie dann nur unglücklich werden können? Das legt im übrigen auch die „Wassertheorie“ von Elaine Morgan nahe, die deswegen ja auch umgekehrt den Männern rät: ihren Frauen ins Wasser zu folgen.
Immer mehr Filmemacher verlagern dieses Problem in Schwimmbäder: Das begann vielleicht mit dem Film „Tuwalu“. Das Drehbuch für den Film „Tuvalu“ schrieb Michaela Beck – eine ehemalige Ostberliner Kunstspringerin aus der „2. Volksbadeanstalt Oderberger Straße“ – um die es nebenbeibemerkt ebenfalls einen Streit zwischen Vergenossenschaftlichung und Investorenprivatisierung gab. In dem Film geht es um einen blinden Bademeister in einem völlig maroden und deswegen geschlossenen Schwimmbad (die 1. Volksbadeanstalt von Sofia). Sein Sohn und die Kassenfrau simulieren für ihn jeden Tag vitalstes Badegeschehen. Dann bricht jedoch eine Schwimmerin, die Kasachin Chulpan Hamatova, in die Idylle ein – und alles verändert sich…Aber es gibt ein (märchenhaftes) Happyend.
Es folgte der in Budapest gedrehte Film „Prinzenbad“ – über einige exzentrische Männer und einen charismatischen Bademeister im berühmten Gellert-Bad. Dann der im eher berüchtigten Kreuzberger Freibad gedrehte Dokumentarfilm „Prinzessinnenbad“ – über drei minderjährige Grazien aus dem dortigen Multikulti-Kiez. Der französische Spielfilm „Waterlillies“ über zwei ebenfalls blutjunge Synchronschwimmerinnen. Dann „I was a Swiss Banker“, der an und in Schweizer Seen gedreht wurde – großteils unter Wasser. Der politische Dokumentarfilm „Darwins Alptraum“, in dem es – ebenfalls mit Unterwasseraufnahmen – um den Victoriabarsch geht. Der US-Animationsfilm „Findet Nemo“ – er handelt von den Abenteuern eines Clownfischs – und löste einen regelrechten Clownfisch-Hype aus.
Darauf folgten die 3D-Filme des Cousteau-Sohns Jean-Michel – erst über Haie, dann über Wale und schließlich über Delphine – in den Imax-Kinos. Und diese wurden dann persifliert von Wes Andersons Film: „Die Tiefseetaucher“.
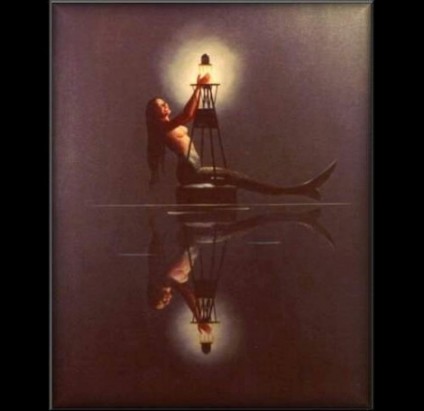
Die Nixen-Photos hier stammen von dem Pollerforscher und Mermaid-Sammler Peter Grosse.
Von all den aquaphilen Lichtspielen konnten die „Liquid Sounds“ profitieren, die der Aquanaut Micky Remann erfand, nachdem er am Pariser Kongress „L’Océan Intérieur“ teilgenommen und angefangen hatte, „Unterwasserkonzerte“ zu veranstalten – in Bad Sulza und im Berliner „Liquidrom“. Kürzlich veröffentlichte er auch noch ein autobiographisches Buch mit dem Titel „Ozeandertaler“. Die Online-taz öffnete einen blog über das „Prinzenbad. Und der Online-Markt „Shopping.com“ offerierte im Internet „Bäder-Filme, günstig kaufen“. Daneben sind die „Pool-Pornos“ inzwischen drauf und dran, sich zu einem eigenen Genre zu entwickeln. Und aus den verdrucktesten „Naßzellen“ wurden unterdes wahre Fitnessoasen, obwohl das Wasser immer teurer wird: Die Wasserwerke hat man inzwischen fast alle privatisiert – und „Wasserversorger mit privatem Kapital neigen zu höheren Preisen als öffentliche Anbieter“, erklärte dazu die FAZ, die früher genau das Gegenteil über diesen „unterschätzten Rohstoff“ behauptet hatte, nämlich dass durch die Privatisierungen eine Konkurrenz entstehe, die sich günstig auf die Preise auswirke. Die „Dehydrierung“ wurde als lebensgefährlich erkannt, und laufend kommen nun neue Mineralwasser-Marken auf den Markt. Für die Münchner „Kunstzeitung“, sind deren Verpackungsdesigner bereits „die wahren Interpreten unserer Zeit“, weil sie allein durch die „Gestaltung von Flaschenform und Verschlusskappe darüber entscheiden, ob man das Trinken von Mineralwasser als fitmachenden Event, als Akt der Entspannung oder als eine Art von Therapie empfindet“.
Erwähnt sei ferner die beliebte Veranstaltung des Freiwilligen-Feuerwehr-Löschzugs Harsewinkel: „Wasserspiele“ sowie die vielen Internet-Foren von und für „Natursektliebhaber“ – zwecks Austausch ihrer Erfahrungen mit der „nassen Variante der Erotik“. Vorläufiger Höhepunkt dieser ganzen schon ins Hysterische überschwappenden Wasser-Wellness-Woge war neulich ein Spiegel-Interview mit dem Träger des Stockholmer „Wasserordens“ John Anthony Allan: „Ein Bewohner der Industrieländer verbraucht rund 5000 Liter pro Tag, meinte er, der Vegetarier ist, nicht aus Tier- sondern aus Wasserliebe, weil er nämlich als Gemüseesser „nur halb so viel Wasser wie ein Fleischesser verbraucht“. Im Frühjahr 2008 gestaltete der Westberliner Künstler Thomas Kapielski eine Ausstellung die er dem Trend zuwider „Benötigt Wasser den Freischwimmer?“ nannte. Seit neuestem gibt es nun auch noch einen weiteren Bäder-Film „Brentanobad“ – von Pola Reuth. Die Frankfurter Psychologin geht dort im riesigen noch nicht relaunchten Rödelsheimer Becken fast täglich schwimmen. Irgendwann war sie so vertraut mit den Stammgästen und dem Personal, dass die sich von ihrer Dreharbeit nicht mehr stören ließen. Heraus kam dabei eine halbstündige Dokumentation, die gelassen alle Aspekte des Zeitvertreibs in einem Freibad zeigt. Den hessischen Bademeistern dient der Film inzwischen als Lehrmaterial.

Photo: Peter Grosse
In Berlin wurde gerade eine Ausstellung – zusammengestellt von Adrienne Goehler – eröffnet, in der sich die Künstler mit der Nachhaltigkeit befassen. Sie heißt „Zur Nachahmung empfohlen“, und mindestens fünf der Mitwirkenden haben sich dabei mit dem Thema Wasser beschäftigt: Mit Bio-Kläranlagen z.B. sowie mit dem Versuch, aus dem Wasser der nahen Panke Trinkwasser zu filtern. Künstler basteln gerne. Das ist auch einfacher, als sich Gedanken über den Konflikt „Privatisierung versus Vergesellschaftung“ (von Wasser) zu machen. Dennoch ist „Zur Nachahmung empfohlen“ eine aufklärerische Veranstaltung. Antonia Herrscher nennt sie in ihrer Rezension zutreffend eine „Erfindermesse“. Was uns allerdings fehlt, sind nicht so sehr technische, sondern eher soziale Erfindungen.

Photo: scout-jugend-triathlon.de
(2) Umgekehrt nahm Wolfgang Schorlau gerade für Rezzo Schlauch Partei, in dem er sich in der Jungen Welt gegen die Stuttgarter Modernisierungspläne der Konservativen dort („Stuttgart 21“ genannt) aussprach:
Kurz vor dem gewalttätigen Polizeieinsatz gegen »Stuttgart-21«-Gegner mit mehreren hundert Verletzten im Schloßgarten haben Sie laut Tagesspiegel eine Eskalation vorhergesagt – und sogar die Befürchtung geäußert, das Stuttgarter Innenministerium könne Provokateure einsetzen. Haben Sie sie gesehen. Oder gewalttätige Demonstrationsteilnehmer?
Nein, nach meiner Beobachtung gab es keine Provokateure. Diese Möglichkeit hatte ich in Betracht gezogen, weil ich als Autor Kontakt zu Polizisten habe, die mir von derartigen Überlegungen berichteten. Ich habe aber keinerlei Gewalt von tatsächlichen oder vermeintlichen Demonstrationsteilnehmern gesehen. Die Polizei hat das ohne Umschweife selbst erledigt und ist sehr hart gegen friedliche Demonstranten eingeschritten, die versucht haben, den Beginn der Fällarbeiten im Schloßgarten durch Sitzblockaden zu verhindern.
Haben Sie mit so vielen Verletzten gerechnet, oder dachten Sie, bei dem breiten Bündnis von Menschen und Organisationen, das im Schloßgarten demonstrierte, würde es sich das Innenministerium dreimal überlegen, ob Wasserwerfer und Pfefferspray eingesetzt werden?
Mit diesem Ausmaß an Polizeigewalt habe ich nicht gerechnet. Für die Landesregierung war dieser Einsatz natürlich ein PR-Desaster erster Güte. Der Protest war insofern nicht erfolgreich, daß die Fällarbeiten nicht verhindert werden konnten und zahlreiche Demonstranten verletzt wurden. Aber die Landesregierung ist daraus auch nicht gestärkt hervorgegangen. Das PR-Desaster scheint der Landesregierung aber noch nicht voll bewußt zu sein, dennoch verteidigt sie den Einsatz. Dort liegen wohl einige Wahrnehmungsstörungen vor – wie auch schon während der Aktion.
CDU-Politiker wie Ministerpräsident Stefan Mappus geben der Protestbewegung die Schuld und werfen Eltern vor, ihre Kinder in die erste Reihe gestellt zu haben. Stimmt das Ihrer Beobachtung nach?
Das ist eine Lüge. Ich war dabei und sehe wie Mappus lügt. Unverfroren und nackt! Tatsächlich gab es eine angemeldete Schülerdemonstration. Das waren aber Jugendliche, die ich auf 14 bis 17 schätzen würde. Die waren dort aus eigenem Antrieb und wurden von der Polizei angegriffen – ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie ein Polizist einem jungen Mädchen mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen hat.
Welche Reaktionen haben Sie bei Teilnehmern beobachtet, die im Rahmen der »Stuttgart-21«-Proteste zum ersten Mal demonstriert haben?
Entsetzen, Fassungslosigkeit. Ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, die so etwas in Stuttgart nicht für möglich gehalten hätten. Wir hatten hier bisher trotz unterschiedlicher Meinungen eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und der Dialogbereitschaft. Das wurde am Donnerstag so zerstört, daß schwer abzusehen ist, was das für die Kultur dieser Stadt bedeutet.
Gehen Sie davon aus, daß sich die Proteste radikalisieren werden?
Wie meinen Sie das? Radikal und gewaltbereit ist bisher nur die Landesregierung. Die hat nun Sympathiepunkte verloren; und große Teile der Öffentlichkeit fühlen mit der Protestbewegung.
Denken Sie, daß der Einsatz von Provokateuren für das Innenministerium immer noch eine Option ist?
Nein. Wenn die Information stimmt, daß es diese Überlegung gab – ich habe sie ja nur wiedergegeben -, dann hat man sich am Donnerstag für die direkte Art entschieden, nämlich auf Provokateure zu verzichten und die Gewalt ohne Umweg von den Uniformierten ausgehen zu lassen.
Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Chance, daß »Stuttgart 21« noch gestoppt werden kann?
Da bin ich nach wie vor optimistisch; ich glaube, daß wir den längeren Atem haben – und weder Landesregierung noch Bahn den Ansturm von Zehntausenden über Monate hinweg überstehen.

Photo: fluxfactory.ch
(3) Die Junge Welt schreibt Ende August 2010 über das Volksbegehren des „Berliner Wassertischs“:
172000 gültige Unterschriften werden bis zum 27. Oktober benötigt, damit die Berliner Bevölkerung im Rahmen eines Volksentscheids über den Gesetzentwurf zur Offenlegung der Geheimverträge abstimmen kann, die im Zusammenhang mit der Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe 1999 abgeschlossen wurden. Nur so könnten die unbefristeten Verträge zwischen dem Land Berlin, RWE Aqua und Veolia Wasser juristisch überprüft und angefochten werden. 53800 Unterschriften seien bisher gesammelt worden, gaben die Organisatoren vom »Berliner Wassertisch« zur Halbzeit des Volksbegehrens am gestrigen Freitag in der Verbraucherzentrale bekannt. Weniger als ein Drittel, doch sie zeigten sich optimistisch.
Das Ziel, während des Unterschriftensammelns mindestens zehn Prozent der angesprochenen Personen als weitere Sammler zu gewinnen, gehe auf. Bündnispartner wie die Verbraucherzentrale, die Grüne Liga Berlin, die Gartenfreunde, ATTAC sowie Umwelt- und Mieterverbände machten das Volksbegehren in ihren Publikationen bekannt; in Arztpraxen, Bioläden, Apotheken und Kanzleien liegen Unterschriften aus. In den Bürgerämtern fehlen jedoch Hinweisschilder – außerdem sehen sie dort durch das Verteilen von Infoblättern an Wartende die Staatsneutralität verletzt. Viele der Betroffenen wissen gar nicht, wer an ihrem Wasserverbrauch verdient. 1999 sind die Berliner Wasserbetriebe über eine Holding AG zu 49,9 Prozent teilprivatisiert worden. Mehrheitseigner ist mit 50,1 Prozent das Land Berlin – die kaufmännische und technische Leitung soll aber zu 100 Prozent den Konzernen zugebilligt worden sein. Im Frühsommer 2010 mahnte der Landesrechnungshof die Werbekampagnen der teilprivatisierten Wasserbetriebe an: Von 2005 bis 2008 seien 4,4 Millionen Euro für Imagekampagnen ausgegeben worden – und das, obwohl es keinen Mitbewerber gibt. Das zeige ja die Verhandlungsfähigkeit des Berliner Senats, spotten die Kritiker.
Die Kosten für die »Happy-Ente-Kampagne« mit der gelben Badeente auf zahlreichen Plakatwänden der Berliner U-Bahn sind im Bericht des Landesrechnungshofes noch nicht einmal enthalten. Seit 2001 sind die Wasserpreise um 35 Prozent gestiegen. Über eine Milliarde Euro Gewinne sind auf Kosten der Verbraucher erwirtschaftet worden. Arbeitsplätze wurden abgebaut, Investitionen gesenkt und drei Wasserwerke geschlossen. Über die Gründe für diese Entwicklung könnten die Teilprivatisierungsverträge Aufschluß geben, über deren Inhalt jedoch »absolutes Stillschweigen« vereinbart worden ist- »soweit nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften eine Verpflichtung zur Offenlegung besteht«. Seit dem Start des Volksbegehrens vor zwei Monaten hat sich einiges getan. Zum Beispiel trat das neue Informationsfreiheitsgesetz in Kraft.
Für Verwirrung sorgte auch die plötzliche Ankündigung der Berliner SPD, die öffentliche Daseinsvorsorge zu rekommunalisieren. Der SPD-Landesvorsitzende Michael Müller sei aber noch die Erklärung schuldig, wie er die Gewinngarantien der Geheimverträge anfechten will, so die Initiatoren des Volksbegehrens. Solange diese Frage nicht beantwortet ist, bleibt zu befürchten, daß diese in die Rückkaufsumme der privaten Anteile einkalkuliert und der Bevölkerung die Kosten aufgebürdet werden. Der Fehler einer teuren Rekommunalisierung sei bereits in Potsdam gemacht worden und dürfe sich in Berlin nicht wiederholen, sagt Thomas Rudek vom »Wassertisch«, der statt dessen eine bürgernahe, verbraucherfreundliche und preiswerte Aufhebung der Teilprivatisierung anstrebt.

Photo: shannon-erne.de
Wasser ist das einzige Molekül, das sich bei Kälte ausdehnt und bei Wärme zusammenzieht, das aber nur nebenbei.



