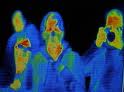
Bandenbildung. Photo: myspace.com
Vorweg:
In der Reihe „E.T.A. Hoffmann Krimi“ veröffentlichte der Stuttgarter Gmeiner-Verlag“ einen Roman der Bamberger Linguistdozentin Friederike Schmöe: „Januskopf“. Ich las ihn im Rahmen eines selbstgestellten Forschungsauftrags über „Regional-Krimis. Die Hauptfigur in Schmöes 2007 veröffentlichtem Text ist eine Privatdetektivin in Bamberg namens Katinka Palfy. Viele Regionalkrimi-Autoren, nicht nur Frauen, lassen ihre „Fälle“ von einer Privatdetektivin, Journalistin oder Polizeihauptkommissarin ermitteln.
Katinka Palfy ist in „Januskopf – ihrem sechsten Fall“ – einem Mörder auf der Spur, der Hoffmanns „Elixiere des Teufels“ in die Realität (der Region Bamberg) einzubilden („nachzuspielen“) versucht. E.T.A. Hoffmann war ab 1808 Theaterdirektor in Bamberg. Ein Denkmal erinnert dort noch heute an ihn: Ein Mann mit einem großen Hut auf dem Kopf und einem Kater auf der Schulter, letzteres eine Anspielung auf Hoffmanns Erzählung „Lebensansichten des Katers Murr“. Auch Schmöes Privatdetektivin besitzt einen Kater, er wird bei ihr allerdings nicht zum Ich-Erzähler. Der Jurist und Autor phantastischer Geschichten E.T.A. Hoffmann schrieb angeblich bereits als Zwanzigjähriger Geheimbundromane, die unveröffentlichten Manuskripte gingen jedoch verloren. Seine 1820 verfaßten „Serapionsbrüder“ greifen dieses Genre wieder auf. „Das Motiv, ohne eigene Steuerungsmöglichkeit einer fremden und zumeist bösen Kraft ausgeliefert zu sein, hat Hoffmann in vielen seiner Texte immer wieder zum Hauptthema gemacht,“ heißt es bei Wipikedia. In Friederike Schmöes Krimi „Januskopf“ kehrt dieses „Motiv“ in wissenschaftlichem Gewand wieder: Ihre Privatdetektivin wird von ihrer Freundin, einer Lokaljournalistin, darüber aufgeklärt, dass es so etwas wie den „Freien Willen“ nicht gibt – es ist alles bloß „Biochemie“. Diese neue Genetik-Erkenntnis verklickert Katinka Palfy anderntags dem mit ihr befreundeten Leiter der polizeilichen Ermittlungen in besagtem Mordfall. Und der wendet sie auch sogleich an. Als Katinka ihm ihre Tätertheorie vorträgt (ein durchgeknallter Lehrer), sagt er: „Nein, ich glaube es nicht. Aber Glaube ist nur Biochemie. Ich brauche Beweise.“
E.T.A. Hoffmann bekam 1818 eine Stelle als Kammergerichtsrat am Berliner Kammergericht in Kreuzberg. Dort erinnert eine nach ihm benannte kleine Straße an den romantischen Dichter. Das Kammergericht selbst ist heute Teil des Jüdischen Museums. Hoffmanns Grab befindet sich auf dem Friedhof der Gemeinde der Jerusalem- und Neuen Kirche vor dem Halleschen Tor.
E.T.A. Hoffmann. Photo: habenichtse.de
Es gibt inzwischen eine Regional-Krimireihe, die sich „Berlin-Krimi“ nennt. In ihr befassen sich die Autoren vornehmlich mit „Fällen“ aus der Vergangenheit. Und die reichen z.T. bis ins 18. Jahrhundert zurück. Möglich, das auf diese Weise auch der eine oder andere Verschwörungsfall in diesen schauerlichen Restaurationszeiten gelöst wird, der den Schauerroman-Autor E.T.A. Hoffmann und seine Zeitgenossen während der Metternichschen Restaurationszeit so faszinierte. Seine Tätigkeit als Kammergerichtsrat soll Hoffmann angeblich sehr gelangweilt haben. Das könnte auf die Bamberger Unidozentin Friederike Schmöe ebenfalls zutreffen. Neben den „historischen Krimis“ gibt es auch noch die „True Crime-Stories“, sie sind selten in Deutschland, und wie die „Hard Boiled“- Crimestories ein US-Produkt: Dort hat man bisher noch aus jedem betrügerischen Konkurs eines Konzerns mindestens ein Dutzend „True Crime“-Geschichten gemacht. Und viele lassen nichts zu wünschen übrig. Der Verlag „Das Neue Berlin“ teilt über seinen Westberliner Autor Werner Rixdorf mit: Er sei ein „Vertreter der in Deutschland kaum existierenden Zunft der True-Crime-Autoren.“ Rixdorf veröffentlichte 1993 ein Buch über den „Paten von Danzig Nikodem Skotarczak“ und zwei Jahre später eins über „Klaus Speer: Eine Legende?“

Klaus Speer. Photo: organized-crime. de
Er war der Kopf der sogenannten „Speer-Bande“. Vor 40 Jahren, im Sommer 1970, kam es in der Bleibtreustraße nahe Kurfürstendamm vor dem Restaurant „Bukarest“ zu einer Schießerei zwischen deutschen und iranischen Zuhältern. Seitdem spricht man von der „Bleistreustraße“. Die „Speerbande“ gewann den Revierstreit gegen die vormaligen „Prügelperser“, von denen einer erschossen wurde. Der Anführer, Klaus Speer, war damals „Security“-Chef des Westberliner „Bordellkönigs“ Hans Helmcke. Stasi-Akten legen nahe, dass er die damalige Stararchitektin und Bauherrin Sigrid Kressmann-Zschach von Klaus Speer im „Bukarest“ umbringen lassen wollte, denn die war gerade mit einem 330-Millionen-DM-Bauprojekt „Steglitzer Kreisel“ in Schwierigkeiten geraten, an dem Helmcke sich mit 3 Millionen beteiligt hatte. Seine Edel-„Pension Clausewitz“, die von Geschäftsleuten und Politikern frequentiert wurde, mußte er 1965 schließen, weil die Stasi das Bordell zu „Spionagezwecken“ genutzt hatte. Für „Ostkontakte“ war der Zuhälter Otto Schwanz quasi zuständig. Er wurde, nachdem Klaus Speer wegen „Raufhandel“ und „Bildung eines bewaffneten Haufens“ zu 27 Monaten verknackt worden war, von Helmcke als „Leibwächter“ eingestellt, besaß ein DDR-Dauervisum und tätigte Alkoholgeschäfte in Größenordnungen mit der volkseigenen „forum Handelsgesellschaft mbH“, die zum Stasi-Bereich „KoKo“ von Schalck-Golodkowski gehörte.

„Pension Clausewitz“ – der Film.

Photos: murnau-stiftung.de/cinema.de
Während Klaus Speer mit der Schießerei in der Bleibtreustraße 1970 berühmt wurde, geriet Otto Schwanz 1985 in die Schlagzeilen, als durch ein Flugblatt herauskam, dass er den Charlottenburger CDU-Baustadtrat Wolfgang Antes mit 50.000 DM bestochen hatte, um einen Pachtvertrag für das „Café Europa“ im Europa-Center zu bekommen. Schwanz wurde dafür 1987 zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Als er rauskam war er krank und bezog Sozialhilfe, 2003 starb er.
Helmcke war 1973 von zwei Zuhältern in Hamburg ermordet worden. Laut dem Ostberliner „True Crime“-Autor Günter Prodöhl, der seine Fälle angeblich von der Stasi bekam („Mach was Anständiges draus, Günter!“), geschah Helmckes Ermordung im Auftrag seiner „rechten Hand“ Gertie Baetge, die Geschäftsführerin seines Timmendorfer Prominentenpuffs „Hanseaten-Club“ war und Helmckes Etablissements in ihre eigene „Liegenschaften KG“ überführen wollte. Im Mordprozeß trat sie jedoch nur als Zeugin auf, begleitet vom Westberliner Anwalt Scheid, der zuvor dem Zeugen Axel Springer geholfen hatte, als dieser vor Gericht gegen Horst Mahler aussagen mußte.
Nachdem Klaus Speer 1974 entlassen worden war und Gertie Baetge den Mordprozeß heil überstanden hatte, machte sie ihn zum „Direktor“ des Bordells „Apollo 11“. Außerdem eröffnete Speer eine Boxschule. Als Boxpromoter förderte er unter anderem die Karriere von Graciano Rocchigiani. Ab 1988 ließ die Westberliner Staatsanwaltschaft gegen den als „Paten von Berlin“ titulierten Speer erneut ermitteln, 1993 begann sein Prozeß, er wurde wegen Nötigung, Erpressung, Wucher, Betrug, Bestechung von Beamten, illegales Glücksspiel und illegalen Waffenbesitz angeklagt. Sein Anwalt Horst Mahler, der zwischenzeitlich als Raf-Mitgründer seine Anwaltslizenz verloren hatte, warf sich derart für Speer ins Zeug, dass das Gericht ihn zu fünfeinhalb Jahren verurteilte, ihn jedoch sogleich gegen Kaution auf „freien Fuß“ setzte, weil er mit einem solchen Anwalt wie Mahler geschlagen war. Speer hatte mit ihm 1973/74 im Knast zusammengesessen.
1998 wurde Speer entlassen und ist seitdem wieder als Boxpromoter tätig. Zuvor half er noch dem Kaufhauserpresser Arno Funke, sich im Tegeler Knast zurechtzufinden, wie „Dagobert“ in seinen 1998 veröffentlichten „Bekenntnissen“ schrieb. Ihn hatte das Moabiter Gericht 1995 zu acht Jahren Haft verurteilt.
Rechtzeitig zum 40jährigen Jubiläum des Sieges der „Speerbande“ in der „Bleistreustraße“ bekam die taz Post vom damaligen Mitglied Manfred Brumme, der im Lokal „Bukarest“ hinter einem Tisch Schutz gesucht hatte, als die Schießerei losging. So steht es jedenfalls in seinem Vernehmungsprotokoll, das dem Brief beilag, dazu noch ein Auszug aus dem Vernehmungsprotokoll seines damaligen Gegners: Mohammad Salehabadi. Während das von Brumme mit dem Satz endet: „Nach unserer Flucht setzten wir uns mit unseren Rechtsanwälten Scheid und Dulde in Verbindung,“ lautet der letzte Satz von Salehabadi: „Ich und mein Neffe sind lediglich mit zur Bleibtreustraße gefahren, um nicht von unseren Landsleuten als feige bezeichnet zu werden.“ Um das Ganze abzurunden, hatte Brumme außerdem noch das Protokoll der Aussage eines zufälligen Augenzeugen, Klaus Fahrenhorst, hinzugefügt, das mit dem Satz endete: „Mir ist noch aufgefallen, dass die Perser für meine Begriffe zu wenig Deckung genommen haben. Das gilt meinen Beobachtungen nach auch für die deutsche Gruppe.“
Es war also ein fast faires Duell gewesen – vielleicht das letzte in Berlin. Auf alle Fälle ist die „Duellfrage im Kern eine Sexualfrage“, wie wir seit Karl Kraus wissen. Und tatsächlich ging es nach der Schießerei in der Bleibtreustraße mit der Zuhälterei in Westberlin langsam zu Ende. Wenn sich hier und heute eine Frau einen Zuhälter leistet, dann nur noch als Luxus, wie die Besitzerin des Bordells „Pssst“ in der Brandenburgischen Straße, Felicitas Weigmann, unlängst in einer Talkshow behauptete.
Als Werner Rixdorf 1995 sein Buch über „Klaus Speer: Eine Legende?“ vorstellte, schrieb die Berliner Zeitung: „Klaus Speer ist kein Aushängeschild selbstgerechten Bürgertums. Er mußte sich im Dunstkreis der Großstadt alles erkämpfen Nicht immer auf die feine Art. Ein Athlet, dessen körperliche Kraft bange Furcht erregte und wohlige Schauer auslöste. Ein sich gepflegt ausdrückender Geschäftsmann, dessen Gesellschaft auch Intellektuelle schätzen. Seinen Händeschlag empfanden die schmalbrüstigen Herren wie einen Ritterschlag, den Damen wurden die Knie weich – Diese Feststellungen stammen aus dem Vorwort, das der bekannte Radio- und Fernsehjournalist Alexander von Bentheim schrieb.“
Weiter heißt es über das Speer-Buch: „König der Unterwelt – Boß der Glücksspiel-Mafia – Bordell-König – Kopf einer Verbrecherbande, diese und andere Schlagzeilen lieferte die Berliner Tagespresse zu Beginn eines Mammutprozesses, den Werner Rixdorf akribisch beobachtete und im Buch zu einer Mischung aus Erzählung und Reportage hervorragend verarbeitet hat.“
Klaus Speer wurde 1993 von Horst Mahler verteidigt, der damals noch ein „linker Rechtsanwalt“ war. 1970 hatte man ihn als RAF-Mitglied in Berlin verhaftet und später wegen Bankraubs und Gefangenenbefreiung zu 14 Jahren Haft verurteilt. Seine Verteidigung übernahm der spätere Bundesinnenminister Otto Schily. Mit Hilfe seines damaligen Rechtsanwalts, des späteren Bundeskanzlers Gerhard Schröder, wurde Horst Mahler 1980 nach Verbüßung von zwei Dritteln der verhängten Strafe vorzeitig aus der Haft entlassen. Sein Bewährungshelfer wurde Helmut Gollwitzer. 1987 wurde er nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs wieder als Anwalt zugelassen. In diesem Verfahren zur Wiederzulassung wurde Mahler wiederum von Gerhard Schröder anwaltlich vertreten.
Die Berliner Zeitung wunderte sich dann auch, „wie gerade ein Horst Mahler mit seiner eigenen Vergangenheit solch einen Mann wie Klaus Speer verteidigen kann und es auch tut.“ Dem Autor Rixdorf nimmt sie übel, dass er „die heutige deutsche Justiz, die sich in ihren eigenen Paragraphensümpfen selbst verkeilt und blockiert, auch noch mit der Justiz, die das Unrecht im Dritten Reich praktiziert hat, vergleicht. Es gab und gibt sicherlich andere Methoden, die die Unfähigkeit der Justiz und der Polizei beim Hantieren mit der organisierten Kriminalität beweisen. Der immer stärker werdende Druck, Erfolge gegen das grassierende Bandenunwesen in Berlin vorweisen zu müssen, machte auch gerade diesen Prozeß gegen Klaus Speer zu einem ‚Schauprozeß‘, bei dem die Staatsanwaltschaft kläglich versagte, ja versagen mußte.“ Die Staatsanwaltschaft hatte vergeblich versucht, ihn als „Paten von Berlin“ anzuklagen.

Mahmout Al-Zein. Photo: ariva.de
2006 versuchte die Staatsanwaltschaft erneut – und vergeblich, einen großen Prozeß gegen einen „Paten von Berlin“ zu führen. Dabei handelte es sich um den gebürtigen Beiruter Mahmoud Al-Zein. Er wurde 2005 mit einem großen Aufgebot von Staatsrambos verhaftet. Der Tagesspiegel stotterte: „Der zehnfache Vater ist oft dort zu finden, wo die Szenerie in rotes Licht getaucht ist. Bei der Hochzeit des ‚Prinzen vom Stuttgarter Platz‘ auf Schloss Diedersdorf wurde Beschützer Mahmoud vor kurzem per Handkuss begrüßt; die 15-Liter- Champagnerflasche öffnete der Muskelmann, in Gesellschaft leicht bekleideter Damen, sehr routiniert.“
Focus schrieb über ihn: „Wegen Drogenhandels stand der ‚Präsident‘ schon 1998 vor Gericht. Es ging ursprünglich um 58fachen Einfuhrschmuggel. Weil ein Kronzeuge aus Angst um sein Leben plötzlich schwieg, konnte U. alias al-Zein nur in drei Fällen wegen Beihilfe angeklagt werden und kam mit zweieinhalb Jahren davon. Seine Familie soll damals einen sechsstelligen DM-Betrag für renommierte Wahlverteidiger aufgebracht haben, obwohl die Ehefrau und zehn Kinder von Sozialhilfe lebten. Zuletzt kassierten sie laut Medienberichten monatlich 3200 Euro – ganz legal. Der Vater ist offiziell erwerbslos. Mahmut U. ließ es sich dabei recht gut gehen. Er verkehrte gern beim Kudamm-Italiener „Ciao“ neben der Schaubühne…“
Dazu muß man wissen, dass dieses Lokal das Vereinsheim des mehrheitlich von Westberliner Immobilienhaien durchsetzten „Vereins der Freunde der Nationalgalerie“ war oder noch ist. Nach der Wende wurden ihretwegen dort schußsichere Scheiben eingesetzt.
2009 meldete der „Deutsche Rotlicht-Blog“: „Zurzeit muss sich Mahmout al-Zein wegen Sozialhilfebetrugs und Verstoßes gegen das Ausländergesetz verantworten. Laut den Behörden ist der angebliche Libanese in Wahrheit ein aus Anatolien stammender Türke. Nachdem er jahrelang als Schutzpatron deutscher und ausländischer Rotlicht-Unternehmer fungierte (‚Braucht er nicht anrufen, regeln wir sofort“‚, will al-Zein jetzt in die Sicherheitsbranche wechseln. Der furchtlose Pate hat Ambitionen: ‚Ich werde der Stadt helfen und sie sauber halten. Ein Mann, ein Wort‘.“
Über Mahmoud Al-Zein gibt es bisher noch keine „Story“ eines „True Crime“-Autors, aber immerhin eine kleine Geschichte von der ehemaligen Prostituierten Lilli Brand:
Die Soldiner Straße im Wedding wird seit einigen Jahren immer wieder in den Medien erwähnt, da die Gegend laut Wikipedia „den Ruf hat, ‚kriminell‘ und ‚unzähmbar‘ zu sein“. Sie bekam dann ein „Quartiers-Management“ und eine Quartiersschreiberin verpaßt, außerdem erschien ein Buch über die Soldinerstraße. Ich bekam 2006 von meinem Freund Ali das Angebot, mit ihm zusammen bei seinem arabischen „Bruder“ Mahmut in dessen Lebensmittelladen in der Soldiner Straße einzuspringen. Dort war zuletzt einiges schief gelaufen, u.a. hatte der türkische Angestellte angeblich arg in die eigene Tasche gewirtschaftet und den Laden immer mehr vernachlässigt. Als Ali und ich an einem Montag um 7 Uhr früh anrückten, kamen wir nicht rein: Jemand hatte das Schloß ausgewechselt. Während ich erst einmal eine rauchte, ging Ali ins Internetcafé nach nebenan, um mit dem Besitzer zu telefonieren. Plötzlich umringten mich drei türkische Frauen und zwei Männer und redeten wild auf mich ein. Die älteste hielt mir ein paar Zettel vor die Nase. Ich verstand nicht genug Türkisch, so dass eine der jüngeren Frauen für mich übersetzen mußte: Es ging darum, dass der Laden sowie auch die Strom- und Wasserversorgung auf ihren Namen angemeldet waren und sie jetzt hochverschuldet dastand. Sie hieß Fatimah und war die Frau des Angestellten – Ömer. Er sei ein fauler Hund und ein Nichtsnutz, schimpfte sie, liege die ganze Zeit im Bett und trinke Bier. Sie war es auch gewesen, die das Schloß ausgewechselt hatte. Der Besitzer des Ladens sollte nun ihre Schulden bezahlen, sonst würde sie alle Verträge kündigen.
Ali hatte den Besitzer nicht erreicht, nur seinen Neffen, und der brauchte eine Weile, um vorbeikommen. Während wir noch vor dem Laden standen und beratschlagten, kam plötzlich Ömer an, der Angestellte, der noch gar nicht wußte, dass er dort nicht mehr arbeiten sollte. Wir stürzten uns alle auf ihn. Seine Frau, Fatimah, schlug mit ihrer Tasche auf ihn ein, die beiden jüngeren Frauen wurden von den Männern zurückgehalten. Ali bat Fatimah, den Laden aufzuschließen, um alles weitere drinnen zu besprechen.
Das Geschäft machte einen guten Eindruck: Es hatte einen großen Verkaufsraum mit großteils türkischen und arabischen Produkten, mehrere Kühlregale für Fleisch- und Milchprodukte, die jedoch fast leer waren, ein sonniges Büro, zwei Toiletten und einen geräumigen Keller mit Kühlraum. Alle Aggregate liefen auf vollen Touren, so dass es im Laden trotz der sommerlichen Hitze draußen angenehm kühl war. Dennoch erhitzten sich die Gemüter drinnen nur noch mehr – als der Neffe endlich kam. Er wußte jedoch von nichts und verwies immer wieder auf seinen Onkel Mahmut, der ihm nur gesagt hatte, dass Ömer entlassen sei und weil er so viel unterschlagen habe, kein Geld mehr bekomme, auch für die Schulden von Fatimah würde sein Onkel nicht aufkommen. Ömer verteidigte sich: Er sei immer ehrlich gewesen, aber weil die meisten Kunden so arm waren, hätte er ihnen ständig Kredit einräumen müssen. Den Neffen ließ das alles kalt. Ömers Frau trat schließlich den Rückzug an – mit den Worten „Wir sehen uns vor Gericht wieder!“ Gegen Mittag wurde der Strom abgestellt. Während wir noch unschlüssig im Laden herumsaßen und rauchten, kam Mahmut in seinem BMW vorgefahren. Er gab sich gelassen. Nachdem mein Freund ihm auf Arabisch alles geschildert hatte, bat er mich auf Deutsch,ihm zu helfen, den Strom auf den Namen seines Neffen anzumelden, wozu ich mich auch bereit erklärte. Weil ich keine Papiere dabei hatte, lieh er mir sein schickes Auto, damit ich sie zusammen mit seinem Neffen zu Hause abholte. Danach fuhren wir zu einer Vattenfall-Geschäftsstelle, wo der Neffe einen Vertrag unterschrieb. Mahmut hatte in der Zwischenzeit das Schloß erneut austauschen lassen.
Am nächsten Morgen machte ich mich zusammen mit meinem Freund Ali erst mal mit dem Warenangebot vertraut, gegen Mittag wurde auch der Strom wieder angestellt. Aber bereits am Nachmittag erklärte Ali mir, er langeweile sich im Laden und ich würde das auch alleine schaffen. Kurz vor Feierabend erschien Ömer, um seine persönlichen Sachen und Papiere abzuholen. Wir stritten uns noch mal kurz.
Zunächst kamen nur wenig Kunden, sie schauten sich im Laden um und gingen wieder raus – es war ihnen zu teuer. Das brachte mich auf die Idee, ein Plakat ins Schaufenster zu hängen: „Zur Neueröffnung 50% Rabatt auf Reis“. Das interessierte die Leute in der Soldiner Strasse. Einige kauften gleich mehrere 5-Kilosäcke: Ich nahm an dem Tag über 800 Euro ein. Im Nu war der Reis ausverkauft. Ich dachte mir daraufhin was Neues aus: „Beim Kauf von vier Packungen Halwa – zu 1 Euro 50 – eine Packung umsonst“. Auch das funktionierte gut. Bei einigen Dosen war das Verfallsdatum längst überschritten, so dass ich sie ebenfalls im Preis herabsetzte. Die Gewürze, Oliven und Tees, die mir zu teuer schienen, setzte ich mit dem Auspreiser runter. Schon bald wollten die Kunden alles zu einem niedrigeren Preis haben. Ich erklärte ihnen, dass es immer nur einige wenige Waren billiger gäbe – auf diese Weise mußten sie täglich – nach Sonderangeboten – vorbeischauen. Nach zwei Wochen fing ich bei einigen Kunden ebenfalls an, ihnen Kredit zu geben. U.a. bei einer Jugoslawin, die täglich vorbeikam. Sie war außerdem eine Art Ladenbotschafterin: Viele Leute saßen bei dem warmen Sommerwetter draußen in der Soldiner Strasse, tranken Tee und unterhielten sich. Die Jugoslawin ging – aus dem Laden kommend – immer von einer Gruppe zur anderen und erzählte allen, was es nun wieder „bei der Russin“ Neues gäbe. Manchmal schleppte sie sogar eine ganzen Gruppe von Frauen an, die alle bei mir einkauften. Dafür bat sie mich, anschreiben zu dürfen, außerdem bekam sie Süßigkeiten und Fladenbrote für ihre Kinder geschenkt. Die Brote wurden täglich angeliefert. Zwar hatte Ömer aus Rache alle Telefonnummern von den Lieferanten mitgenommen, aber diese meldeten sich nach und nach auch unaufgefordert – und lieferten mir soundsoviel Joghurts, Milchpackungen, Butter, türkischen Käse und Wurst etc..
Der Laden hatte draußen vor den Schaufenstern zwei Gemüseregale. Weil der Gemüselieferant noch Geld vom Ladenbesitzer zu bekommen hatte, wollte er mir keine neue Ware liefern. Mahmut, der mich im übrigen lobte – für meine Ideen, hatte mir gesagt, ich sollte keine Außenstände begleichen, sondern alle Lieferanten an den entlassenen Ömer verweisen. Beim Gemüse behalf ich mich deswegen damit, dass ich selber welches einkaufte – bei einem türkischen Gemüsehändler um die Ecke, das ich dann in „meinem“ Laden etwas teurer wieder verkaufte.
Neben dem Ein- und Verkauf mußte ich auch noch die Buchhaltung und die Kassenabrechnung machen. Wenn viele Kunden auf einmal im Laden waren, verlor ich manchmal den Überblick, zumal viele Frauen ihre Kinder mitbrachten, die mich mit ihren Süßigkeitswünschen durcheinander brachten, während die mit großen weiten Gewändern angetanen Mütter irgendetwas einsteckten. Ich muß hinzufügen, dass auch ich mich großzügig – aus der Kasse – bediente. Niemand kontrollierte mich und die „Bücher“. Meine Einahmen beliefen sich auf etwa 300 Euro am Tag. Das Geld gab ich abends meinem Freund Ali, der sich natürlich auch noch was davon abzwackte. Mahmut kam nur selten im Laden vorbei, und wenn, dann verschwand er gleich in seinem Büro, wo er manchmal auch schlief. Einmal kam er mit seiner Frau und seinen drei Kindern – und veranstaltete ein kleines Kinderfest vor dem Laden, d.h. er verteilte großzügig Süßigkeiten an alle Kinder in der Soldiner Strasse . Auch die Erwachsenen gingen nicht leer aus.
Zu meinen Stammkundinnen gehörte die Tochter eines Mullahs, die ihren Einkaufswagen immer mit Erfrischungsgetränken vollpackte – und dafür von mir Mengenrabatt bekam. Sie war nicht die einzige, die mich zum Übertritt in den Islam zu überreden versuchte, dazu arrangierte sie für mich ein Treffen mit ihrem Vater, der sehr angesehen war im Soldiner Kiez. Das war mir aber für den Anfang zu dicke, stattdessen begleitete ich jedoch meine jugoslawische Dauerkundin Mara, die mir inzwischen ans Herz gewachsen war und sogar Diebstähle im Laden verhinderte, an einem Freitag in die Moschee, die sich gleich nebenan befand. Weil ich dafür keine passende Bekleidung besaß, lieh sie mir ein grün-goldenes Kopftuch und dazu ein langes dunkelgrünes Kleid mit arabischem Strickmuster. Mir war anfangs etwas bange. Mara beruhigte mich: „Tu einfach alles, was auch die anderen Frauen machen, ich bin bei dir.“ Der Gottesdienst dauerte fast zwei Stunden, aber ich war – im Gegensatz zu den alten Frauen um mich herum – schon nach einer halben Stunden so fertig vom vielen Niederknien, dass ich nicht mehr hochkam. Und am nächsten Tag hatte ich einen derartigen Muskelkater, dass ich nicht zur Arbeit gehen konnte und das Geschäft zu blieb.
Im Laden stand gleich hinter der Tür das Modell einer Moschee, von Kindern aus Holz hergestellt, in das man Spenden für den Bau einer neuen Moschee reintun sollte. Kaum einer der Kunden drückte sich, manche steckten sogar Geldscheine in den Schlitz, auch ich warf täglich ein paar Münzen rein. Einmal in der Woche kam ein Geistlicher und leerte die Spendenkasse.
Neben Mara freundete ich mich auch noch mit drei anderen Kundinnen an: Es waren Araberinnen, die stets ohne Kopftuch, stark geschminkt und körperbetont gekleidet waren. Sie genossen es, anders herumzulaufen als die meisten Soldinerinnen. Einmal luden sie mich zu sich nach Hause ein. Wir rauchten, tranken Tee und plauderten über die Religion sowie über den Kiez und die vielen, vernachlässigt wirkenden Kinder, die auf der Straße herumhingen und oft Unsinn im Kopf hatten. Daneben gaben die drei Frauen mir noch Tips, wie ich mehr Kunden in den Laden locken könnte.
Eines der Kinder kam oft zu mir: Er, Kemal, wollte unbedingt an die Kasse. Als ich es ihm einmal erlaubte, stellte sich heraus, dass er sie perfekt bedienen konnte und außerdem, wenn seine Freunde in den Laden kamen, dass er ihre Einkäufe noch genauer abkassierte als ich. Abends half er mir gelegentlich, die schweren Gemüsekisten reinzutragen und den Laden abzuschließen. Ein paar Mal begleitete ich seine Mutter zu seiner Schule, um ihr beizustehen und zu dolmetschen: Es ging darum, dass Kemal manchmal den Unterricht schwänzte – z.B. wenn seine Oma zu Besuch da war.
Das meiste, was ich verkaufte, war Reis, arabische und türkische Fladenbrote sowie stilles Wasser in Flaschen aus der Türkei. Selbst den ärmsten Soldinern war das deutsche Wasser aus der Leitung nicht rein genug, deswegen kauften sie täglich mindestens einen Sechserpack. Einer meiner Wasser-Großkunden, ein älterer Kurde, erzählte mir, dass der Laden vor Mahmut dem berühmt-berüchtigten Mahmout al-Zein gehört hatte. Seiner Meinung nach war al-Zein ein strenggläubiger, großzügiger und bescheiden auftretender Mensch. Einige andere widerum meinten, dass der Laden, als er noch in seinem Besitz war, einen schlechten Ruf hatte, weil dort angeblich jede Menge krumme Geschäfte gemacht wurden. Und daneben soll seine Familie noch Sozialhilfe kassiert haben. Nachdem man ihn verhaftet hatte – wegen Schutzgelderpressung, Drogenhandel und Körperverletzung, übernahm Mahmut seinen Laden in der Soldiner Strasse. Als ich dort anfing, gab es noch immer einige Waren – Puderzucker, Reisstärke etc.- mit dem Namen „Al-Zein“ drauf. Obwohl das Geschäft immer besser lief und ich immer öfter überfordert war, rentierte es sich kaum, so dass Mahmut den Laden verkaufen wollte, er fand nur keinen Interessenten bzw. nur solche, die auf bestimmte Einrichtungsgegenstände scharf waren. So wurde z.B. eines Tages der Fleischwolf und die Kühltruhe abgeholt.
Ich hatte noch eine weitere Jugoslawin als Kundin. Sie kam regelmäßig – meistens mit ihrer Tochter, die mir oft half: beim Saubermachen und Waren einräumen. Sie und ihr Mann besaßen ein Restaurant. Nachdem sie mitbekommen hatte, wie gut ich mit den Leuten im Laden klar kam, versuchte sie mich für ihr Lokal abzuwerben – als Kellnerin. Zwar fühlte ich mich auf der Soldiner Strasse wohl und es war auch eine gute Erfahrung, dort so ein Lebensmittelgeschäft zu schmeißen, aber nachdem Mahmut auch noch sämtliche Kühlregale auseinandergenommen und abtransportiert hatte, meldete ich mich – ebenfalls an einem Montag – im „Adria-Grill“ zu einem Vorstellungsgespräch. Vorher veranstaltete ich noch eine Art Ausverkauf: Es kamen sogar Kunden aus der Pankstraße und Osloer Strasse.
Buchcover von Lilli Brands gesammelten „Transitgeschichten“. Photo: amazon.de
Einige Wochen nach Veröffentlichung der Speer-Geschichte aus Anlaß des 40jährigen Jubiläums der Schießerei in der Bleibtreustraße meldete sich eine Anna W. in der taz, die damals zu dieser Scene gehörte. Hier das ungekürzte taz-Interview mit ihr, das wir daraufhin machten:
Das häufigste Verbrechen in Deutschland ist der Betrug, und dabei wiederum die Verweigerung von Unterhaltszahlung. Anna W. (48) will Müttern helfen, der Pfiffigkeit der Väter, für ihre Kinder keinen Unterhalt zahlen zu müssen, etwas entgegen zu setzen. U.a. geht es darum, wie man das von ihnen versteckte Gelder ermittelt. Sie hat selbst drei Kinder und ist seit 1997 hinter den Unterhaltszahlungen ihres Ex-Ehemannes her. 2007 bekam sie auf dem Klageweg 3600 Euro: die aufgelaufene Summe seit Oktober 2003: 150 Euro im Monat. Anna W.s Ex-Ehemann, den sie 1989 geheiratet hatte, bezieht Sozialhilfe, er ist aber nach wie vor aber auch noch Geschäftsführer mehrerer Firmen, die seinen Freunden gehören.
2006 wirkten Anna W. und ihr jüngstes – fünfzehnjähriges – Kind in einer Folge des ARD-Ratgebers „Recht“ mit, in der es um die „Unterhaltsflucht“ von Vätern ging. Zuvor arbeitete sie drei Jahre im Ressort „Frauen und Familie“ des Bundestages, Diese Arbeit und rund ein Dutzend Klagen gegen ihren Ex-Ehemann auf Unterhaltszahlung (die derzeitige liegt seit 2007 beim Kammergericht), befähigen mich, so sagte Anna W., anderen Müttern mit ähnlichen Problemen helfen zu können.

taz: Steht ihr Pseudonym „Anna W.“ dem denn nicht irgendwie im Weg?
Anna W.: Mag sein, aber das benötige ich, weil mein Kind und ich immer noch von meinem Ex-Mann verfolgt werden.
taz: Wie kam es dazu?
Anna W.: Dazu muß ich etwas ausholen. Also, mein Vater war 30 Jahre bei der Polizei, meine Mutter Hausfrau, eigentlich Zahnärztin. Ich bin in Steglitz aufgewachsen. 1979 habe ich Abitur gemacht, dann gleich geheiratet und zwei Kinder bekommen – die studieren heute. Mein Mann starb 1982 und ich bekam eine Witwenrente, dazu noch ein Haus, das ich verkauft habe.
Dann lernte ich einen Österreicher kennen, Pauli, mit einem schneeweißen nagelneuen Audi Quatro. Er entpuppte sich wenig später leider als ein Zuhälter. Mein erster Zuhälter. Er schickte mich zum Arbeiten in ein Nobelbordell, das war 1983. Ein Jahr später zeigte meine Ex-Schwägerin mich beim Jugendamt an: Ich würde meine Kinder vernachlässigen. Sie kamen in ein Heim und dann in eine Pflegestelle. Die Ex-Schwägerin hatte gute Kontakte zum Jugendamt, aber ich hatte auch gute Kontakte – Uwe Barschel in diesem Fall, der zu meinen „Gästen“ im Bordell gehörte. Über ihn lernte ich jemand vom Kinderschutzbund kennen, der mir half, meine Kinder zu besuchen. Gerade als ihr Pflegevater meinem Ältesten eine scheuern wollte, kam ich dazu – und ging gleich dazwischen. Anschließend habe ich ihn angezeigt, mit dem „Erfolg“, dass sie in eine andere Pflegestelle kamen. Nach Schleswig-Holstein.
Um ihnen näher zu sein, habe ich im „Hanseaten-Club“ in Timmendorf angefangen. Dieser Edelpuff gehörte einmal dem Westberliner „Bordellkönig“ Hans Helmcke, der 1973 von zwei Hamburger Zuhältern ermordet worden war, anschließend übernahm seine Geschäftsführerin Gertie Baetge den Club in Timmerdorf. Während ich noch dort arbeitete, wurde ich von Pauli an einen Hamburger Zuhälter verkauft. Der schickte mich 1985 an die Cote d’Azur nach Cannes, wo ich in einem Hamburger Club, daneben aber auch in einigen Hotels an der Croisette und in einer Disko am Yachthafen arbeitete.
Danach fing ich im „Bel Ami“ am Berliner Olympiastadion an, das Detlef und Ilona Uhlmann gehörte. Er kam kürzlich wegen Steuerhinterziehung in den Knast – und ab 2011 dürfen dort keine „sexuellen Dienstleistungen“ mehr angeboten werden, d.h. es wird nächstes Jahr geschlossen. Das „Bel Ami“ war berühmt, nicht zuletzt, weil Helmut Newton und Nan Goldin in diesem „exklusivsten Club Deutschlands“ Aufnahmen machten – u.a. für Vogue, Artforum und den Playboy. Ich habe dort auch für Newton posiert. Statt eines Honorars bekam ich Champagner bis zum Abwinken von ihm. Ansonsten verdiente ich aber so gut dort, dass ich meinen Hamburger Zuhälter auszahlen konnte. Noch bevor ich damit fertig war, lernte ich meinen zweiten Ehemanmn kennen – im „Cotton’s Club“ in der Fasanenstraße. Er war Bauunternehmer, entpuppte sich dann aber auch als ein Zuhälter – mein dritter – und letzter.
taz: Haben sie ihn regelrecht geheiratet?
Anna W.: Wir heirateten 1989, eigentlich gegen meinen Willen, aber mit Psychoterror hat er mich gefügig gemacht. Er hatte Schulden: 600.000 DM, und ich sollte seine Geschäftsfähigkeit mit meinem Namen ersetzen. Ich war damals noch so blöd und blond, stand unter permanentem Suff und wurde dann noch von ihm mit Koks gestopft, dass ich gar nicht richtig wußte, was das bedeutete. Es war aber auch eine wilde Zeit, der Champagner floß in Strömen, wie man so sagt. Wir waren im „Bel Ami“ 50 Mädchen, ich habe da Tausende in der Woche verdient.
Nachdem ich geheiratet hatte, wollte ich meine zwei Kinder zu mir holen, aber das Jugendamt hat abgeblockt. Sie verlangten ein festes Einkommen von mir und meinem Mann, eine kindgerechte große Wohnung und die Bereitschaft meines Mannes, die Kinder zu adoptieren. Schließlich hat auch mein Mann abgeblockt. Sein Baugeschäft lief mal gut, mal schlecht und er hat ununterbrochen das Geld zum Fenster rausgeschmissen. Damals kostete ein Gramm Koks 250 DM, er und seine Kumpel trugen alle teure Kaschmirpullover, Budapester Schuhe, Rolex-Uhren und Dupon-Feuerzeuge. Außerdem spielten sie und fuhren oder flogen zu allen Boxkämpfen usw. Kurzum: ein teurer Lebenswandel. Und ich war ja auch durchgestylt. Damals arbeiteten wir im „Bel Ami“ noch in Abendkleidern von Gucci und Prada, trugen Pelze von Lösche, gingen zu Udo Waltz zum Friseur, täglich in den VIP-Bereich von Solarent, und abends aßen wir im Tennisclub Rot-Weiß im Grunewald. Auch das Make-Up war nur vom Feinsten und zwischendurch jetteten wir immer noch nach Sylt.
Der Busenfreund meines Mannes war Manfred Brumme von der Speer-Bande, dem damals das Bordell „Apollo 11“ gehörte, ich wurde dann die Patentante seiner Tochter. Manne wurde 2001 ermordet, man weiß nicht, von wem, er hatte Schulden bei den „Hells Angels“ und bei den „Russen“. Klaus Speer lebt noch – er ist Boxpromoter, einst war er „Leibwächter“ von Hans Helmcke gewesen, seine Bande hatte sich 1970 eine wilde Schießerei in der Bleibtreustraße mit einer persischen Zuhältergruppe geliefert. Als Speer ins Gefängnis kam, wurde Otto Schwanz sein Nachfolger bei Helmcke, der hatte ein DDR-Dauervisum und gute Stasi-Kontakte. Ansonsten war diese Clique um Manne Brumme eher eine Mischung aus CDUlern, Bauunternehmern und Zuhältern. Dazu gehörte neben Otto Schwanz der „Aachener Kalle“, „Chinesen-Kalle“ und „Neger-Kalle“, der allerdings seitdem er die Mädchenband „Tic Tat Toe“ gemanagt hat, nicht mehr so genannt werden will, und noch ein weiterer Kalle – Franke, der einen Billigpuff in der Kaiserin-Auguste-Allee hatte. Außerdem gehörte noch Angelo dazu, ein italienischer Schläger, der das Kudammlokal „Mau-Mau“ besaß und unser Koksbeschaffer Jochen. Wir trafen uns gelegentlich auch im „Ciao“ am Lehniner Platz, dem Vereinslokal der Freunde der Neuen Nationalgalerie, von denen viele Bauunternehmer waren. Außerdem verkehrten wir im „Shell“ und im „Fofi“ in der Grolmannstraße, wo ich einmal Wolfgang Joop wieder traf, den kannte ich noch von Cannes, da hatte er mir ein Kleid versprochen, ich habe es aber nie bekommen. Vorübergehend habe ich mal in der „Hagenstraße 5“ im Grunewald gearbeitet – ein Bordell, das Christa und ihrem Mann gehörte. Die standen in Konkurrenz zum „Bel Ami“. Beide Bordelle haben immer versucht, sich gegenseitig die schönsten Mädchen abzuwerben.
taz: Bekamen Sie nicht in dieser Zeit auch Ihr drittes Kind?
Anna W.: Das war 1995, zwei Jahre später habe ich meinen Mann aus der Wohnung geschmissen, das war am Vatertag, er war besoffen und wollte mein Kind schlagen. Kurz danach habe ich mir ein gute Anwältin genommen: Anne Klein. Mit der stimmte ich vor dem Familiengericht einem Deal zu: Mein Mann unterschrieb, dass wir bereits ein Jahr getrennt lebten – und damit war ich ihn sofort los, aber ich mußte ihm dafür das halbe Sorgerecht einräumen. Seitdem habe ich keine Ruhe mehr – so lange, bis mein Kind 18 ist. Eigentlich bräuchte ich jetzt ganz viel Geld, um uns zu schützen, und damit ich das Kind bis dahin in einem Internat verstecken könnte…
taz: Wieso hat das nicht hingehauen mit dem geteilten Sorgerecht?
Anna W.: Erst mal: Eigentlich wollte mein Ex-Mann gar kein Kind haben, ich wollte eins haben – zwei Jahre früher schon, da habe ich die Piller bereits abgesetzt. Und dann empfand mein Ex-Mann die Scheidung als ein persönliche Niederlage. Er sagte zu mir: „Du hast mein Leben zerstört. Ich bring Dich und Dein Kind um.“ Tatsächlich hat bereits die Schwangerschaft bewirkt, dass ich mich vollkommen verändert habe – weg von Parties, Puffs, Drogen und Alkohol und wieder hin zum Spießigen, Kleinbürgerlichen meines Elternhauses.
Anfänglich mußte ich allerdings noch weiter im „Bel Ami“ arbeiten, da habe ich mir eine „Nanny“ für mein Kind genommen. Es war aber nicht mehr gut dort: Das „Edelbordell“ kam langsam auf den Hund. Wir Mädchen haben uns immer weniger Mühe gegeben und die Gäste wurden auch immer pöbeliger und geiziger. Ich erinnere mich noch an Rolf Eden, der war zwar nett, aber als „Gast“ daneben: Er wollte mir nicht mal einen zweiten Piccolo ausgeben und dann auch noch partout keinen Präservativ benutzen, man mußte ihn regelrecht austricksen. Es kam dann auch so eine Phase, da habe ich jeden Kerl gehasst. Ich habe dann eine Weile auf Domina gemacht und den einen oder anderen „Gast“ mit einem Gürtel ausgepeitscht – gegen Aufpreis natürlich…
taz: Noch mal zurück zum Sorgerechtsproblem…
Anna W.: Mein Ex-Mann hatte nach unserer Scheidung nur noch die Möglichkeit, unser Kind als Waffe gegen mich zu verwenden. Er hat systematisch unsere Sicherheit zerstört. So tauchte er z.B. plötzlich in ihrer Schule auf, so dass das Kind sich auch dort nicht mehr sicher fühlte. „Ich komme mir vor wie Anne Frank,“ hat es mal gesagt. Das ging so weit, dass wir beide schließlich nach Spanien abgehauen sind. Aber vorher habe ich mich noch beim Bewerbungs-Pool des Bundestages als Sekretärin beworben – und wurde auch genommen. Ich hatte früher schon mal kurz als Sekretärin gearbeitet. Ich war dann drei Jahre bei einer Abgeordneten der CDU/CSU angestellt. Dabei hatte ich u.a. mit dem Kinderschutzbund und dem Unterausschuß Kinderkommission zu tun. Den Wahlkampf „meiner“ Abgeordneten in Nordrhein-Westfalen habe ich auch mitgemacht. Sie war außerdem in einer Frauengruppe und im Katholischen Frauenbund, mit dem ich dann den Kontakt hielt. Und es kam immer wieder Neues hinzu. In einer sitzungsfreien Zeit rief mich einmal der Pförtner an: Unten stehe eine Reisegruppe aus NRW, die müßte abgeholt werden. Meine Abgeordnete befand sich in NRW, ich rief dort in ihrem Wahlkreisbüro an. Die wußten von nichts. Und wo ist meine Abgeordnete? Die ist beim Friseur. Da rief ich dann an und fragte sie, was ich mit der Reisegruppe machen solle. Normalerweise werden die von den wissenschaftlichen Mitarbeitern betreut, nun mußte ich die vertreten, und nebenbei sollte ich auch noch 50 Taschen mit Info-Material für diese Gruppe zusammen stellen…Die war aber eigentlich ganz nett, wir haben uns über alles mögliche unterhalten – die drei Tage während ihres Berlin-Aufenthalts, nur nicht über den Bundestag, von dem ich bloß das Nötigste wußte.
Nett war auch das Sommerfest des Bundespräsidenten, damals noch Johannes Rau – im prächtig illuminierten Schloß Bellevue. Ich habe mich da mit Frau Rau unterhalten. Ein andern Mal lud man mich und meine Tochter mit der Bundestags-Sportgemeinschaft und dem Diplomatischen Korps zu einer Hubertus-Jagd auf den Neustädter Gestüten in der Prignitz. Das war auch ganz schön. Joschka Fischer hielt eine kleine Rede und ein Falkner führte seine Vögel vor. Dann servierte das Hilton-Hotel ein üppiges Menü. Anschließend ging die Jagd los, d.h. wir folgten wahlweise in offenen oder geschlossenen Wagen einer künstlichen Fuchs-Fährte. Meine Tochter durfte reiten. Anschließend wollte sie unbedingt und sofort, dass ich ihr da ein Pferd kaufe. Bevor wir nach Hause fuhren gab es noch einmal ein Hilton-Menü.
taz: Solche Produktivitätsanreize machten aber doch nicht das Wesentliche Ihrer Bundestagstätigkeit Tätigkeit aus…?
Anna W.: Natürlich nicht. Meine Abgeordnete hatte einen regen Schriftverkehr – mit Experten und Organisationen, die sich mit den Problemen von Kindern (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom z.B.) und Frauen (Vereinbarkeit zwischen Berufstätigkeit und Haushalt z.B.) befassten. Außerdem gab sie eine Zeitung für ihren Wahlkreis heraus, in der sie über ihre Arbeit in Berlin berichtete. Ich mußte nicht nur ihre Kontakte zur Presse pflegen, sondern z.B. auch zum Verband alleinerziehender Mütter und Väter. Auch an den Reden, die sie für den Bundestag schrieb, habe ich mitgearbeitet. Die Themen waren „sexueller Mißbrauch“, „Jugendschutz“, „Verbesserung der Kinderrechte“, der „Betreuungsangebote“, das „Sorgerecht“ – dazu gibt es jetzt übrigens eine Neuregelung.
taz: Haben Sie diese Stelle als Sekrretärin aufgegeben und sind nach Spanien gezogen, weil Ihr Ex-Mann sie weiter verfolgte?
Anna W.: Ja, 2004 sind wir erst mal nach Mallorca geflüchtet. Ich habe mir da eine Katzenzucht aufgebaut – mit britischen Kurzhaarkatzen. Alles ging gut, aber plötzlich lauerte er dort meinem Kind in der Deutschen Schule auf. Gleichzeitig hatte er einen Haftbefehl wegen Entführung gegen mich beantragt, wobei er behauptete, ich würde sein Kind nicht in die Schule gehen lassen. Außerdem hat er meinen Anwalt bezahlt, damit der alle meine Mandate niederlegt. Ich mußte mir daraufhin einen neuen nehmen und der sorgte erst einmal für die Aussetzung des Haftbefehls: Ich hätte mit meinem Kind nur einen verlängerten Urlaub auf Mallorca genommen, hat er argumentiert. Gleichzeitig versuchte er das alleinige Sorgerecht für mich durchzusetzen. Das hat er aber bis heute nicht geschafft, zumal die Familiengerichte spätestens seit 2004 zunehmend väterfreundlicher urteilen.
taz: Sind Sie dann mit Ihrem Kind zurück nach Berlin gezogen?
Anna W.: Ja, Ende 2004 habe wir uns hier eine Wohnung genommen. Die Katzen mußten wir zurücklassen. Das war ein Drama für mein Kind, auch seine Freunde hat es dort verloren, es hat nur noch geweint. 2005 habe ich einige Abschnitte meiner Geschichte, u.a. den im Bundestag, aufgeschrieben und das Manuskript rumgeschickt, ist aber nichts mit passiert. Dann habe ich meinen Nachnamen ändern lassen, auch den meines Kindes wollte ich ändern, das ging aber nicht. Im Standesamt Schmargendorf hat man mir gesagt: „Ihr Ehemann kann bis zu Ihrem Tod über Ihre Namensänderungen und die ihres Kindes Auskunft verlangen.“ Das erstreckt sich über alle Schengenländer.
taz: Die Ehe ist hier immer noch sehr heilig…
Anna W.: Es war der größte Fehler meines Lebens, diesen Mann geheiratet zu haben. Jeden Fehler kann man korrigieren, aber eine Ehe nicht. Mein Ex-Mann ernährt sich energetisch davon, dass er mich und mein Kind zugrunde richtet. Der wäre schon längst gestorben, wenn er diesen Haß nicht hätte. Und ich habe sowieso schon einen zu hohen Blutdruck, 2005 war ich derart gestresst, dass ich ein Hirnanorisma bekam, das ist eine Blutgefäß-Aussackung, und sofort operiert werden mußte. Bei meinem Kind ist es Nasenbluten, das es im Streß kriegt. Als ich aus dem Krankenhaus kam, war mein Ex-Mann wieder hinter uns her – und wir haben die Wohnung gewechselt, ebenso die Schule. Als er auch das rausbekam, haben wir erneut Wohnung und Schule gewechselt. Und als er uns auch dort wieder auf die Schliche gekommen war, sind wir 2007 nach Spanien geflüchtet. Da hatten wir erst mal unsere Ruhe. Aber immer, wenn irgendwas war, mit Behörden oder das jemand irgendwelche Dokumente verlangt hat, sind wir sofort abgehauen, haben uns ein Hotel genommen oder die Stadt gewechselt.
taz: Aber ihr Ex-Mann hat sie dort nicht ausfindig gemacht?
Anna W.: Als er mitbekam, dass wir nicht mehr in Berlin waren, hat er 2009 erneut einen Haftbefahl gegen mich erwirkt. Davon wußte ich aber erst mal nichts. 2010 bin ich mit meinem Kind wegen meiner Witwenrente und wegen seiner Zahnbehandlung nach Berlin gekommen. Zwei Nächte waren wir hier – im Hotel. Mein Kind wurde schon ganz unruhig und wollte so schnell wie möglich zurück nach Spanien – da haben sie uns mitten in der Nacht verhaftet.
Auf der Gefangenen-Sammelstelle waren wir noch zusammen, in nebeneinander liegenden Zellen. Mein Kind hat geheult wie ein Schloßhund. Wir mußten uns nackend ausziehen. Nach unserer Vernehmung haben sie mein Kind – ohne Geld, Handy und Ausweis – zum Kinder-Notdienst nach Charlottenburg geschickt. Und ich kam dann über Umwegen – Lichtenberg, Moabit – nach Pankow in den Frauenknast, wo ich zehn Wochen blieb. Mein Kind kam in einer Pankower Kriseneinrichtung. Ende Juni 2010 war der Prozeß, ich bekam ein Jahr und neun Monate auf Bewährung wegen Entführung. Ich habe danach zum Glück gleich eine Wohnung hier gefunden.
Und jetzt brauche ich Knete, denn, wie gesagt, ich will eine Initiative starten, um Mütter zu beraten, die ebenfalls Probleme mit Sorgerecht und Unterhaltszahlung haben, gerade arbeite ich an einer Webseite dafür: „http://anna-vv.de.tl“
—————————————————————————–
Literatur:
Werner Rixdorf: „Klaus Speer – Eine Legende?“, Berlin 1995
Günter Prodöhl: „Der lieblose Tod des Bordellkönigs“, Berlin 1979
Peter Bölke: „Geschäfte mit Berlin“, München 1973
B.Härlin/M. Sontheimer: „Potsdamer Straße“, Berlin 1984
M. Sontheimer/M. Vorfelder: „Antes & Co“, Berlin 1986




