Der Bär flattert in südwestlicher Richtung.
Melzers Abmahnung datierte vom »Donnerstag, den 6. März«. Am Montag diktierte ich eine Antwort, darin skizzierte ich meine Arbeit im Verlag von 1965 an, erklärte ihm, daß das von mir vorgelegte Programm – an dessen Art, Umfang, Qualität und Zustandekommen er keinen Anteil habe – gefährdet sei, wenn mir die Lektoratsautonomie entzogen würde. Außerdem wies ich den Verleger auf die Existenz einer Buchhaltung hin, deren Studium seine Fragen zu den Finanzen jederzeit beantworten könne. Schließlich erinnerte ich erneut an die Erfüllung der mündlichen Vereinbarungen bezüglich des Mitarbeiterbeteiligungsmodells, nannte ihm als Termin für eine Stellungnahme den 15. März. Diesen Brief unterzeichneten auch Peter Beitlich, Traudel Brand, Anne Hansal und Adolf Heinzlmeier. Ich befahl es den anderen schlicht: »Keine Diskussion, ohne Vertrag wird keine Olympia Press gegründet! Wir warten so lange mit der Auslieferung, bis Melzer zur Vernunft kommt.« Klar war das meine Dominanz! Die vier fürchteten, wenn sie sich weigern, schmeiße ich sie raus. Sie unterschrieben kommentarlos. Unsere Antwort wurde dem Verleger auf den Tisch gelegt, der sprach mit keinem mehr ein Wort, hockte eine Woche lang mit heruntergezogenen Mundwinkeln in seinem Zimmer, verschwand aber stundenweise. Ich dachte: Er konsultiert einen Rechtsanwalt, und der wird ihm raten, sich mit uns zu einigen. Schließlich war der Kredit der Bank für Gemeinwirtschaft an meine Verlagsleitung gebunden, und die deutsche Olympia Press existierte bisher lediglich in einer ›Spiegel‹-Geschichte.
Deshalb fuhr ich auch am Wochenende in aller Ruhe nach Nieder-Florstadt und besichtigte ein Schloß. Freitag nachts um elf hatte mich nämlich der Baron Erwin von Löw aus Heidelberg angerufen: »Renate Gerhardt erzählte mir, daß Sie ein Auslieferungsgebäude suchen. Unser Anwesen in der Wetterau wäre dafür geeignet. Es gibt dort eine moderne Scheune, Sie müßten nur noch eine Rampe bauen, auch das Herrenhaus ließe sich als Verlagssitz nutzen.« Von der Wetterau hatte ich bisher noch nichts gehört; er erklärte mir die Lage bei Bad Nauheim und Friedberg, in einer fruchtbaren Senke zwischen Vogelsberg und Taunus. Och, warum sollte ich nicht mal einen Ausflug dorthin machen? Vielleicht wäre das wirklich etwas für die Literaturproduzenten, dazu ein schöner Verlagssitz oder sogar der richtige Ort für meine geplante Medienfabrik.
Nieder-Florstadt war ein extrem häßliches Dorf, zweimal zuckelte ich die Hauptstraße auf und ab, nichts von einem Schloß zu sehen. Während ich die dürftigen Häuschen der ehemaligen Leibeigenen betrachtete, die den Herren Löw von und zu Steinfurth neben dem Zehnten alle möglichen Hand- und Spanndienste leisten mußten, kam es mir vor, als wäre die Bauernbefreiung, die doch bereits vor hundertfünfzig Jahren stattgefunden hatte, erst gestern vom Freiherrn vom Stein proklamiert worden. Tatsächlich stand das Dekret für die Häusler ja nur auf dem Papier, bis zum Anfang unseres Jahrhunderts gab es dort keine Arbeit außer auf dem Gutshof.
Schließlich entdeckte ich die Einfahrt, das Straßendorf war dem Anwesen vorgelagert, das allerdings sah imposant aus. Wie ich später erfuhr, gehörte einst sogar noch ein ehemaliger Besitz des fuldischen Fürstabts Amand von Buseck dazu, den die Herren Löw Mitte des achtzehnten Jahrhunderts mit ihrem eigenen Gut zusammenlegten. Vor ein paar Jahren hatte die Familie das Busecksche Gut zusammen mit ihrem angestammten riesigen Landbesitz an einen Landwirt mit dem schönen Nachnamen Alles verkauft. Die Löws saßen jetzt auf dem letzten Stein, ihnen gehörte nur noch das Schloß, ein großer grauer Klotz aus Naturstein – der Barockputz war seit langem heruntergefallen –, aber schön gelegen in einem verwilderten Park mit einer rundumlaufenden Kastanienallee. Rechts daneben die alte Zehntscheuer und ein weiteres Stallgebäude, alles in desolatem Zustand, so wie auch die Adelssitze in Mecklenburg-Vorpommern heute vor sich hingammeln. Neben dem Immobilien-Schurrmurr auf dem fünfzigtausend Quadratmeter großen Grundstück gab es tatsächlich auch die von Erwin von Löw erwähnte »neue« Scheune aus den dreißiger Jahren, ein riesiges Ding von tausend Quadratmeter Grundfläche. Das wären zumindest schon mal die Außenwände, der Rohbau für eine Buchauslieferung, überlegte ich mir.
Einige Zimmer im ersten Stock des Herrenhauses wurden von der jüngeren Schwester des Barons, Hedwig Carita, und ihren beiden Töchtern bewohnt. Die eine war ein kerngesunder blonder Brummer von siebzehn, die andere ein neunzehnjähriges zartes dunkelhaariges Mädchen mit feinen Gesichtszügen, das einen verstörten Eindruck machte. Löws ältere Schwester Dorothea von Holleben, verheiratet mit einem Oberforstrat in Büdinger Diensten, war eigens zu meinem Besuch angereist. So empfingen mich vier Frauen im Salon. Hedwig Carita, eine noch recht attraktive Mittvierzigerin mit guter Figur, hatte ganz offensichtlich einen Sprung in der Schüssel. Wann immer ihre ältere Schwester Dorothea in ihrem dröhnenden Vortrag über die Details der Immobilie, also über den Zustand von Dächern, Wänden, Scheunen, solche Wörter wie ›Loch‹, ›Ritze‹ oder ›Ständer‹ benutzte, ließ Hedwig Carita ein befremdliches Kichern hören. Du kennst doch dieses nervtötende Prusten von Teenagern im Erdkundeunterricht, wenn das Wort ›Titicacasee‹ fällt. Ich sah mir das Zimmer genauer an, da stand ein großer ovaler Tisch mit zwanzig Stühlen, Lütticher Barock – das ist der Eßtisch, den wir jetzt noch benutzen, Schröders letzte Erinnerung an einstigen Schloßbesitz. Dazu gab es in diesem Salon diverse Beistellmöbel, ein großes Buffet mit geschnitzten Jagdmotiven, zwischen den Fenstern zwei riesige Kristallspiegel vom Boden bis fast zur Decke mit breiten Rokokogoldrahmen, Gobelingardinen, in der Ecke eine Nische mit einem Porzellankachelofen, die Decken zierte ein Stuck, der im hessischen Dehio gerühmt wird. Also durchaus adelige Pracht, aber nur auf der äußeren Rinde. Wenn du genauer hingucktest, waren die Teppiche durchgewetzt, die Stühle aus dem Leim gegangen, die Fenster ewig nicht gestrichen worden, der Mucor blühte in den Ecken, und auf dem Stuck zeichneten sich die bräunlichen Landkartenmuster des Teufels ab, sichere Zeichen für ein undichtes Dach.
Zu jener Zeit wollte ich immer noch Filme machen, und als ich dieser seltsamen Familie inmitten ihres patinierten Bruchs begegnete, dachte ich sofort: Wie im Kino! Tatsächlich ist dann ja ein Film daraus geworden. Karlheinz Böhm gab den schöngeistigen Baron Löw, Maria Schell war die mannstolle Hedwig Carita, die nicht einsehen konnte, daß eine Zigarre manchmal nur eine Zigarre ist. Christine Kaufmann spielte die gestörte Tochter und Eva Mattes ihre handfeste Schwester. Durchs Objektiv betrachtet, war der Salon eindrucksvoll, so gesehen ist Patina immer attraktiv, sogar der Dreck von Slums hat dann seinen Reiz. Aber bei aller Schönheit und Liebe zu den Brechtschen ›gebrauchten Werken‹: Patina mußt du schon sehr pflegen, damit du in ihr leben kannst, sonst ist sie nämlich nur ein einziger Siff! Während ich den Drehort besichtigte, dröhnte Dorothea wie eine Roßtäuscherin auf mich ein: »Sie brauchen den Kaufpreis nicht auf einmal zu zahlen, wir können uns auch langfristig einigen.« Dann verabschiedete ich mich, war auf der Rückfahrt nach Darmstadt begeistert von der Idee, den Verlag und ein Medienzentrum in diesem Schloß zu etablieren.
Fortsetzung folgt
(BK / JS)


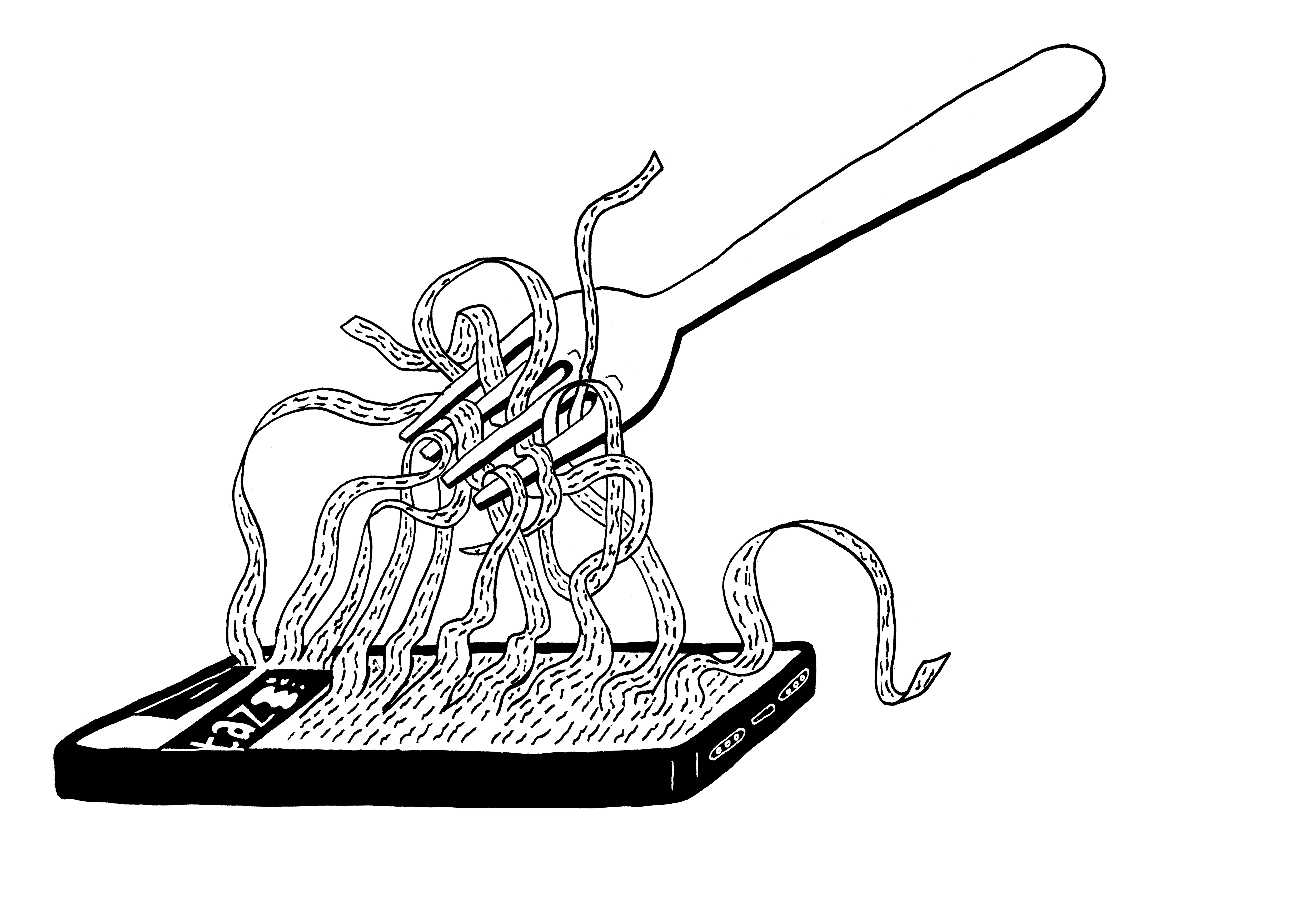
Die Idee hat mit Sicherheit was ganz eigenes und besonderes. Für viele wär es sicher ein Traum.