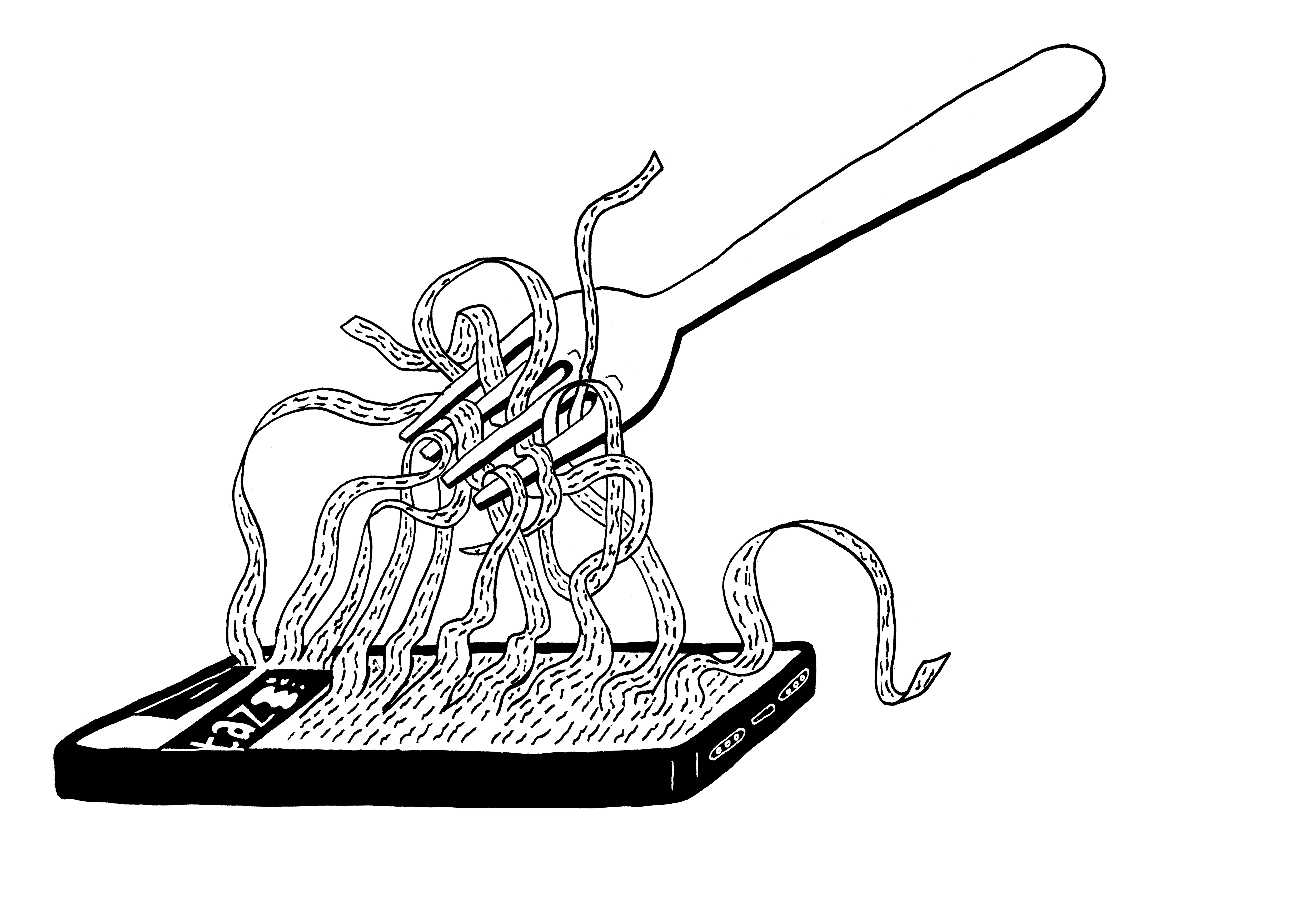***
Der Bär flattert in östlicher Richtung.
***
Und dann lese ich plötzlich, dass der vorletzte Schlossbesitzer Eugen Laib Garbáty war, einer der Zaubernamen meiner Jugend. Garbáty kam bei mir gleich nach dem Alten Fritz und dem Schloss seiner ungeliebten Gattin in Niederschönhausen. Nicht weit davon, sozusagen als säkularisiertes Fabrikschloss, liegt die riesige Garbáty-Zigarettenfabrik. Deren bekannteste Marken waren die ›Königin von Saba‹, die erste Orientzigarette in Berlin, und die ›Kurmark‹. Zwar interessierte ich mich als Achtjähriger noch nicht für Zigaretten, umso mehr hatten es mir die Garbáty-Sammelalben angetan: ›Deutsche Heimat‹ und ›Schienenwunder‹ mit Lokomotiven und Torpedozügen, die Onkel Siegfried, der zweite Mann meiner Mutter, vollständig besaß. Bei den Pankowern war die Garbáty-Familie wegen ihrer sozialen Ader geschätzt, denn die Arbeiterinnen und Arbeiter bekamen Krankengeld, lange bevor solche Errungenschaften allgemein üblich waren. Und es gab Pausenräume, eine Betriebswäscherei, Bäder, einen Werkschor sowie einen Betriebssportclub.
Vermutlich hatte Eugen Laib, der Sohn des alten Garbáty, das Schloss Altdöbern wegen der ehemaligen Zigarrenmanufaktur erworben. Denn etwas außerhalb vom Schlosspark hatte einer der Vorbesitzer in einfachen Werkhallen eine Zigarrenmanufaktur betrieben. Die Sachsen waren ja bekannt als Hersteller von Tabakwaren, wovon die Yenidze in Dresden zeugt, auch Tabakmoschee genannt. Eugen Laib Garbáty ließ einen riesigen Landschaftspark mit großem Teich anlegen, insgesamt 55 Hektar groß, im Stil des Pücklerschen Gartens in Muskau. Auf einer Denkmal-Tafel war Eugen Garbáty vor seinem Schloss zu sehen, wie er im Stile eines Edelmanns von einer blonden Maid huldvoll die Erntekrone entgegen nimmt.
Acht Jahre später musste Eugen Garbáty seine Zigarettenfabrik im Zuge der ›Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben‹ an die Reemtsma Cigarettenfabriken weit unter Wert zwangsverkaufen, die Familie wanderte 1939 in die USA aus. Die Schlossanlage mit ihrem Landschaftsgarten übernahm der Fürst zu Lippe-Detmold, ein 150-prozentiger Nazi, natürlich ebenfalls zu einem Bruchteil des Wertes. Während der letzten Kriegsjahre residierte die schwedische Gesandtschaft im Schloss Altdöbern. Auf das Dach hatten sie die schwedische Flagge gepinselt als Schutz gegen Luftangriffe. Ein Treppenwitz, ausgerechnet die Schweden bewahrten hier ihre Gesandtschaft vor Bomben, und jetzt zerstören sie mit Hilfe ihres Staatskonzerns Vattenfall die Umwelt. Darüber gleich mehr.
Vom Schloss führt ein verwunschener Weg am großen Teich entlang durch den ehemaligen Landschaftspark, der jetzt urwaldartig verwildert ist. Links und rechts vom Weg warnen Tafeln vor »Erdfällen«, eine euphemistische Umschreibung für Löcher, die sich plötzlich auftun könnten. Unwillkürlich musste ich an die makabre Erzählung eines Freundes denken, der irgendwo in einer kleinen Siedlung in Mexiko plötzlich in einem Erdloch versunken war. Nicht weiter tragisch, das Loch war nur einen Meter tief, aber man kann sich gut vorstellen, dass dem Mann vor Schreck das Herz in die Hose rutschte. Denn während man fällt, weiß man ja nicht, wie tief. Überall in der Niederlausitz wird vor solchen Erdfällen gewarnt, die durch den exzessiven, viele Quadratkilometer weiten Braunkohletageabbau entstehen. Allein um Altdöbern wurde von 1937 bis 1994 dreihundert Millionen Tonnen Braunkohle abgebaut. Inzwischen ist die Brache Greifenhain geflutet, und es entstand der Altdöberner See, einer von den vielen in der Niederlausitz, die zur größten künstlichen Seenlandschaft Europas wurden.
»Um eine gefahrlose Nutzung der Seen zu ermöglichen«, heißt es blumig, »sind weitere umfangreiche Rütteldruck-Verdichtungsmaßnahmen notwendig.« 120 Quadratkilometer sollen gerüttelt werden? Wollen diese Geologen uns veralbern?! Tatsächlich werden doch nur Warntafeln aufgestellt, ansonsten vertraut man auf die statische Schläue. Diesen Begriff benutzen Techniker gern scherzhaft in ihrem Jargon. Deshalb sage ich im ›März-Akte‹-Film: »Statische Schläue ist so ein Ausdruck aus dem Bauwesen, wenn eigentlich die Scheune schon längst eingefallen sein sollte und irgendwelche Kräfte der Statik, die gar nicht mehr berechenbar sind, das Ding noch halten.«
Fest steht: Die Grundwasserlage im gesamten Gebiet des Braunkohletagebaus hat sich dramatisch verändert. Die gefluteten Brachen sind nur oberflächlich eine Augenweide, im Untergrund verursachte die Absenkung des Grundwassers, die Entstehung von rotem Eisenhydroxid. Zahlreiche Flussarme im Spreewald führen bereits rotgefärbtes Wasser. Diese Eisenhydroxide sind schuld, dass Kleinlebewesen, Fische und Pflanzen sterben. Da macht eine Kahnfahrt keinen Spaß mehr, und um den Tourismus, der neben den Gurken die wichtigste Einnahmequelle im Spreewald ist, wird es wegen der hässlichen Rotbraunfärbung des Wassers bald geschehen sein.
Schlimmer noch, in Berlin könnte wegen der Kontaminierung des Spreewassers über kurz oder lang die Trinkwassergewinnung zum Erliegen kommen. Der ehemalige Braunkohletagebau setzt nicht nur Eisenhydroxide, sondern auch Sulfate frei. Jeder weiß, dass die Spree die Lebensader Berlins ist und rund siebzig Prozent des Trinkwassers aus den Uferfiltraten von Spree und Havel stammt. Zwar liest man ab und zu bedrohliche Meldungen in der Presse, aber niemand scheint sie ernst zu nehmen: »Eisenschlamm lässt die Spree verrosten«, titelte die ›BZ‹. Oder ein anderes Zitat: »Die Sulfatwerte in der Spree haben eine solche Höhe erreicht, dass die Trinkwassergewinnung aus den Uferfiltraten der Spree für Berlin gefährdet ist.« Jedoch, solche ungeliebten Themen werden schnell durch andere ersetzt, die Politiker zucken mit den Schultern und schieben das Problem dem gewissenlosen Raubau der DDR in die Schuhe. Damit haben sie nur bedingt recht, denn schließlich existiert dieser Staat seit dreißig Jahren nicht mehr.
Fortsetzung folgt
***
BK / JS