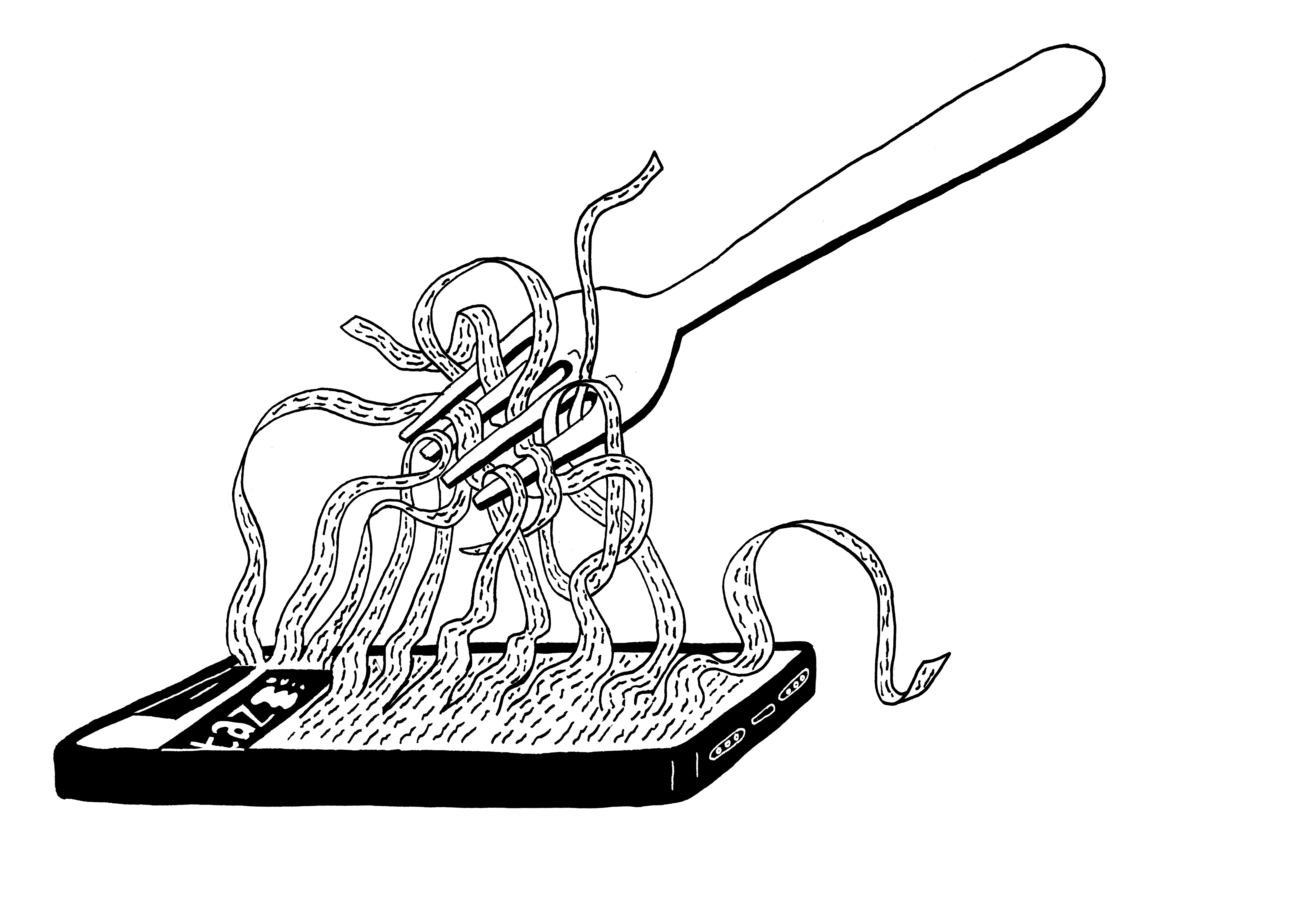Das Stadtbild ist nur eines von vielen Bildern. Wenn Friedrich Merz sich in einer Klinik, in seiner Zahnarztpraxis, in einer Autofabrik oder einem Altenheim umschauen oder die Tür für Paketboten öffnen würde, wenn er mit seiner eigenen weiteren Familie sprechen würde, könnte er feststellen, dass sich zahllose andere „Bilder“ in den letzten 60 Jahren verändert haben – seit den Kindheits- und Jugendjahren des Kanzlers. Bilder von Kleidungsgewohnheiten, Mahlzeiten, Verkehrsmitteln, Landschaften: Das Land hat seit 1945 Jahrzehnte der Liberalisierung und Modernisierung hinter sich. Haben in den sechziger Jahren abends im Dunkeln junge Frauen allein an Bushaltestellen gewartet? Kaum. Haben sich in den zerbombten Nachkriegsstädten, durch die sich bald neue Autotrassen bahnten, öffentliche Plätze gefunden, an denen sich Menschengruppen zusammenfanden? Kaum.
Die veränderten Bilder zu korrigieren und die Städte wieder so idyllisch aussehen zu lassen, wie sie nie waren, ist das Versprechen der Rechtsautoritären – Straßen und Plätze sind da nur ein Anfang. Allerdings glaubt ihnen niemand, dass sie dann wirklich nach ihrem Geschmack „aufräumen“ würden, weil die Konsequenzen viel zu dramatisch wären – es würde nicht mehr geliefert: keine frischen Spargel mehr, keine Pakete, keine neue Hüfte, keine Bettpfanne. Ihre Anhänger:innen wissen das gut, ihnen genügt das Gefühl, etwas Besseres zu sein. Dass die neu angekommenen Fremden gedemütigt und bedroht werden.
Ein deutscher Bundeskanzler hingegen wird an dem gemessen, was er ankündigt. In diesem Fall verspricht er etwas, von dem er selbst weiß, dass er es nicht halten wird. Er wird das „Stadtbild“ nicht verändern und wird deshalb bis zum Ende seiner Kanzlerschaft damit beschäftigt sein zu erklären, warum es ihm nicht gelungen ist. Zumal er als vielbeschäftigter Mann seiner Generation das abendliche Bild vieler Städte vermutlich kaum kennt – die Anmutung west-, aber auch ostdeutscher Kleinstädte und Dörfer etwa, in denen der lokale Döner oft die letzte verbliebene Begegnungsstätte ist, der Ort, wo nach 19:00 Uhr überhaupt noch Menschen sind. Entgangen sind ihm wohl auch die Untersuchungen, die zeigen, wer in diesem Land am meisten Angst im Dunkeln hat. Es sind die Migrant:innen – und die zahllosen Bürger:innen, die aussehen, als könnten sie hier fremd sein.
Und doch ist der Kanzler zum x-ten Mal in dieselbe Falle getappt. Nachdem es ihm passiert war, hat er die Grube, die er sich gegraben hatte, dann entschlossen weiter vertieft und die Töchter des Landes zu seinen Kronzeuginnen erklärt. Allerdings entspricht die Behauptung, dass es für sie heute auf den Straßen gefährlicher sei oder sie mehr Angst hätten als ihre Mütter oder Großmütter nicht der statistisch messbaren Wirklichkeit sondern der kreativen Phantasie einer angstgetriebenen und alten Gesellschaft. Das Gegenteil ist richtig. Und was die jungen Frauen angeht, machen sie bei Wahlen ihre Kreuze nicht bei denen, die sie so für ihre eigene Agenda einspannen wollen, sondern tendieren immer stärker in die Gegenrichtung.
Ist Friedrich Merz also ein Rassist? Ja und nein. Seine Äußerungen über das Stadtbild muss man rassistisch nennen, weil sie junge migrantische Männer zum Sicherheitsrisiko für Frauen erklären, obwohl nachweislich die meisten Übergriffe im Familienumfeld geschehen und obwohl junge deutsche Männer ohne Migrationshintergrund kriminell ebenso auffällig sind wie ihre zugewanderten Altersgenossen. Der Kanzler dürfte sich auf der Rassismusskala im Durchschnitt der deutschen Bevölkerung bewegen. Aber die Vermutung liegt nahe, dass er kein Rassist sein möchte. Dass er eher mit dem Ungewohnten fremdelt. Menschen, die fremd aussehen, können Angst auslösen, und zwar umso mehr, je weniger häufig sie uns im Alltag begegnen. Für diese Angst sollte braucht sich niemand zu schämen, und es sollte auch niemand dafür beschämt werden. Es kommt darauf an, wie man mit diesem Gefühl und mit den „Anderen“ umgeht. Typischerweise fremdeln junge Menschen, auch Frauen, am wenigsten, weil sie schlicht gewohnt sind, von Diversität umgeben zu sein. Aber unsere Gesellschalt ist nun mal alt.
Kulturell und ethnisch diverse Gesellschaften haben schon immer Regeln entwickelt, um die alltägliche Beunruhigung durch „Fremde“ zu bewältigen, die sonst das gesellschaftliche Zusammenleben zerstören kann und gemeinsames Handeln erschwert. Solche Regeln begrenzen Ansprüche mächtiger Gruppen; sie sollen verhindern, dass kulturelle Unterschiede in unruhigen Zeiten genutzt werden, um auf Kosten von Minderheiten Machteroberung zu betreiben. Die Menschenrechte, das hat der Philosoph Hans Joas gerade noch einmal in seinem Buch „Universalismus“ welthistorisch dargestellt, sind ein Kondensat solcher Regeln. Dass die aggressive Missachtung dieser Regeln am Ende zur Selbstzerstörung von Staaten und Gesellschaften führt, ist bekannt.
Wen eine Gesellschaft aufnehmen will kann sie selbst entscheiden, das widerspricht, solange sie das Asylrecht wahrt, nicht den Menschenrechten. Die Ampel hat da harte Entscheidungen getroffen, auf die im Wesentlichen der deutliche Rückgang der Zuwanderung im letzten Jahr zurückzuführen ist. Wie eine Gesellschaft ihre ethnische und kulturelle Vielfalt politisch gestaltet, hängt hingegen von ihrer Verfassung ab, in Deutschland also vom Grundgesetz. Für Politiker:innen und besonders für den Bundeskanzler gilt deshalb, dass sie ihre alltäglichen Gefühle und die Wahrnehmungen ihrer Kindheit durchdenken und an den Realitäten überprüfen müssen, bevor sie sie herausposaunen. Wie verhält sich das „Stadtbild“ zur gleiche n Würde aller? Wie zum Diskriminierungsverbot des Artikel 3? Vielleicht muss diese Frage nicht an jedem Küchentisch gestellt werden. Aber sehr wohl in der Bundespressekonnferenz.
n Würde aller? Wie zum Diskriminierungsverbot des Artikel 3? Vielleicht muss diese Frage nicht an jedem Küchentisch gestellt werden. Aber sehr wohl in der Bundespressekonnferenz.
Es geht bei alledem um harte Politik, und nicht, wie die FAZ insinuiert hat, um moralische Hysterie von „Linken“ (als „links“ gilt heute bekanntlich, wer das Grundgesetz ernst nimmt). Es geht um politische Macht. Friedrich Merz ist fast 70 Jahre alt, eines der einschneidenden Erlebnisse seiner politischen Sozialisation war der fulminante Erfolg seines „Andenpakt“-Kumpels Roland Koch in den Hessischen Landtagswahlen 1999 mit dessen ausländerfeindlicher „Doppelpass“-Kampagne. Das ist längst Zeitgeschichte, doch Merz kommt auch von dieser Erfahrung offenbar nicht los – etwas in ihm glaubt noch immer, durch die Wiederholung eines solchen Manövers Wahlen gewinnen zu können. Nur ist der von Koch damals bespielte Platz ganz weit rechts außen inzwischen von der antidemokratischen Konkurrenz besetzt, die auch diese Vorlage dankend angenommen hat. Weder sein Wahlergebnis noch seine Umfragewerte haben den Kanzler bisher zu einer Überprüfung seiner Impulse und zu einer strategischen Selbstreflektion veranlasst.
Lernfähigkeit ist die Mindestvoraussetzung, wenn jemand an der Spitze eines modernen Staates und einer alten Gesellschaft stehen will. Mit Ursula von der Leyen, Christine Lagarde und ja, auch Angela Merkel beweisen drei ältere Frauen seit langem diese Fähigkeit. Auch ein Mann der in den 1950er Jahren geboren wurde, sollte dazu lernen können.