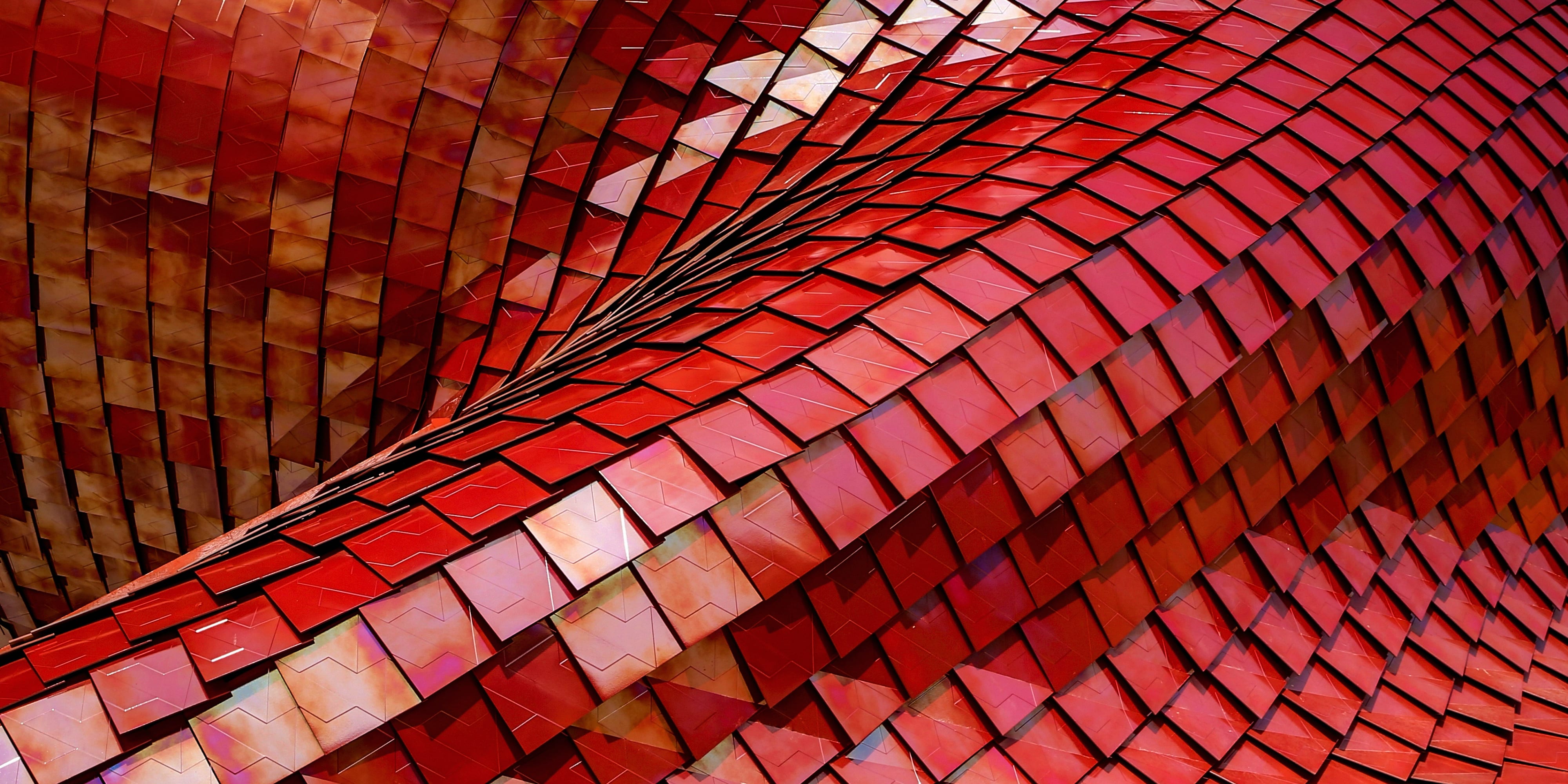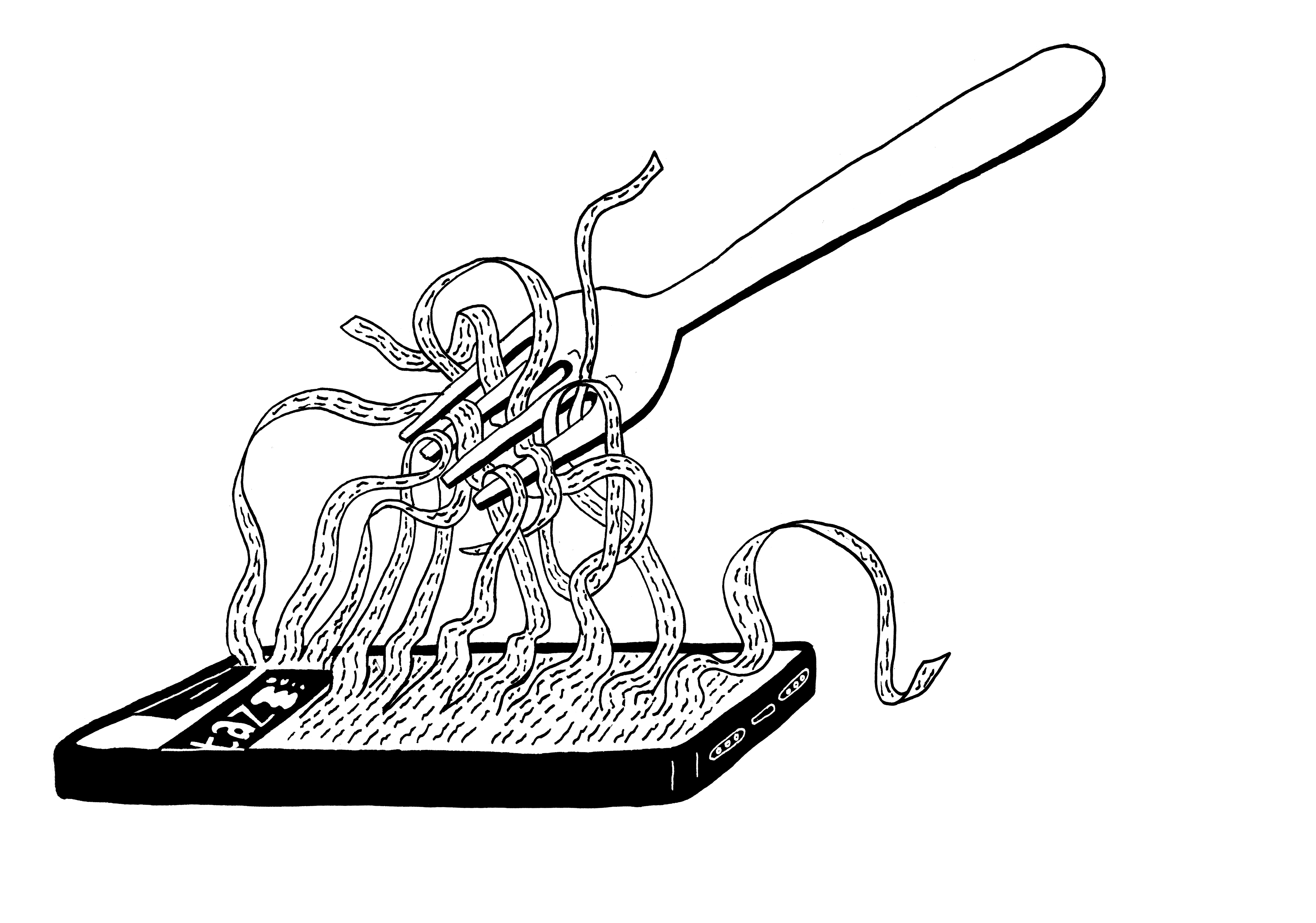Sicher, man kann im 21. Jahrhundert ja nicht mehr Zugfahren wie zu Kaiser Franz Josephs Zeiten. Nur: Wer hat das verlangt? Der dritte Wiener Südbahnhofsbau verdiente noch tatsächlich den Namen Bahnhof, weil er eben keine Shoppinganstalt mit Gleisanschluss war.
Seit Mitte der Neunzigerjahre haben sich fast alle grossen Bahnhöfe in West- und Zentraleuropa in Einkaufszentren verwandelt. Nirgends kann der Fahrgast mehr in Ruhe und vom Kommerz unbehelligt ein- oder aussteigen.
Der dritte Wiener Südbahnhof war damit eine der letzten Oasen im transnationalen Bahnverkehr. Sein Angebot an Geschäften lag übersichtlich und praktisch geordnet nahe der Eingänge: Zeitungskioske, ein Supermarkt, eine Backstube, ein paar Cafés, ein Friseur, ein verrauchtes Restaurant und gegen Ende auch ein Spielsalon. Das Angebot war nicht gerade berauschend, aber für den Reisenden durchaus genug.
Die neuen Bahnhöfe dienen nicht mehr dem Zugverkehr. Es sind knallharte Profitcenter, die sich durch die Öffnungszeiten in der Nacht und am Wochenende in Konkurrenz zu den innerstädtischen Einkaufszentren stellen. Und zwar: auf Kosten der Reisenden, die nun lange Wege bis zum Bahnsteig in Kauf nehmen müssen und sich über fehlende Wartesäle und Ruhezonen ärgern.
Die in Einkaufszonen verwandelten Bahnhöfe zielen nicht mehr auf die Versorgung der Reisenden, sondern auf die Kaufkraft der umliegenden Stadtteile. In Wien baut man vorsichthalber gleich ein Wohnviertel auf dem Bahnhofsareal mit dazu. Schliesslich ist das Einkaufszonen-Konzept bei den erst vor zehn Jahren mit Milliardenaufwand adaptierten Gasometern kläglich gescheitert.
Diese Entwicklung am Südbahnhof hat ihren Ursprung in der mangelnden Wirtschaftlichkeit von Bahnhöfen selbst. Jeder Bahnhof soll in den Bilanzen der neoliberalen Bahngesellschaften seine Kosten selbst decken. Da die Stationsentgelte, die, wie Landegebühren am Flughafen, für jeden haltenden Zug berechnet werden, zur Deckung der Kosten nicht ausreichen, soll der Rest durch Vermietungs- und Werbeerlöse aufgebracht werden.
Den alten Bahnhof kennzeichnete immer noch eine gewisse Bezugslosigkeit und Amorphie, die Wienerische Anarchie des Würstelstands gewissermassen. Darin steckte eine egalitär-demokratische Absicht, ein Grundgedanke, der sich von der Gleichheit aller ableitet. Im dritten Südbahnhof hat es keine Kaiserstiege mehr gegeben, aber auch noch keine VIP-Lounges. Das Bahnhofsrestaurant offerierte jene gemütliche Freiheit, die man in Wien auch dem Heurigen zuspricht: ein Hühnersupperl, tadellos.
Ein von drolliger Schwere durchzogener Luftraum, dann Kaufbuden für allerlei Abstürze. Ein Sammelbecken für die Zurückgelassenen (»Mir lassen nix zruck, des is schon bestimmt!«), Menschen, die keinen Neid kannten, offene Wallfahrtskapellen für Trinker, reisendes Eigengewächs.
Täglich zogen am Südbahnhof die Bruderschaften der burgenländischen Hackler durch. Dazwischen Seiltänzer, Ohrenmaschinisten; solche, die sich ihre Schmerzen verbeissen und nie jammern. Es lag eine Poesie in diesem Leben zwischen grosszügigen Lichtziegeln und mamorierten Steinplatten. Und die Bahnhofsmenschen, die in den Hallen herumgingen, sie fühlten sich sicher, waren nicht von dieser giftigen Krankheit des Sich-gegenseitig-Belauerns erfasst, die unsere Bankomatträume auszeichnet.
© Wolfgang Koch 2009