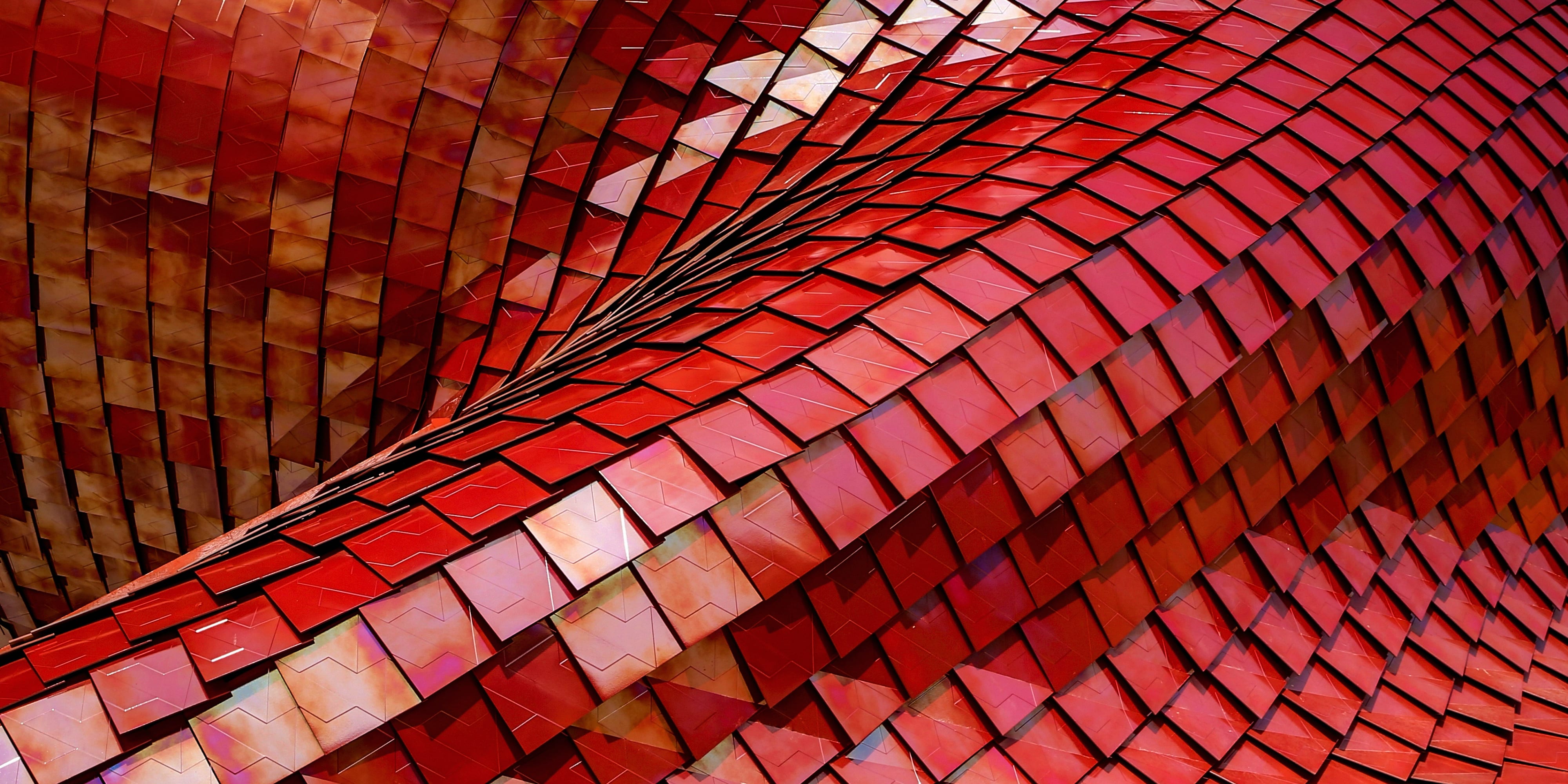Das Ideal des Wiener Essayisten Gerald Schmickl ist der emotional aus sich herausgehende, sich im »Tooor!«-Brüller ekstatisch verausgabende Sportreporter, »ein Begabungsberuf«, zu dem es bei dem bukolischen Fünfzigjährigen allerdings nicht gereicht hat, wohl aber zum dandystischen Kommentator des Zeitgeschehens, der sich freundlich-blasiert der Dichte der europäischen Kultur zuwendet.
Was seine Leidenschaften angeht, überführt sich Schmickl allerdings gleich selbst eines Widerspruchs. Denn das Hohelied auf die expressiven Sportreporter unterläuft Schmickls mehrfach geäußerter Behauptung, jeglicher Heroismus sei ihm fremd. Schließlich feiert er ausgiebig den fröhlichen Impuls des Vernarrtseins.
Gerald Schmickl ist ein intellektueller Schwarmgeist. Man stellt sich am besten einen Gentleman in englischem Tweed vor, braunes Maßschuhwerk, über den Schultern ein Citybag mit den allerneuesten Büchern. Sobald es das Wetter zulässt, wird man ihn durch Augarten oder Prater schlendern sehen; von Zeit zu Zeit bleibt er stehen und liest ein paar Seiten aus dem Vorausexemplar eines Verlages.
Schmickl verschlingt Texte: Romane, Hirnforschung, Soziologie, Formel-I-Sprüche, Ernährungsratgeber, Sendungsmanuskripte, dazu das deutsche Großfeuilleton. Entsprechend kaleidoskopisch ist die Ausbeute aus dem Zettelkasten für die vorliegenden Essays geraten.
Doch Schmickl spielt mit offenen Karten: er will die Bücklinge, die er macht, gar nicht verbergen. Es fehle ihm an Ehrgeiz, sagt er, »alles, was sich im Umfeld eines bestimmten Themas sagen lässt, ausschließlich mit eigenen Worten wiederzugeben«. Entsprechend verbirgt sich das Musische seiner Essays tief in den Collagen, muss häufig erst gesucht werden.
Schmickl ist ein Mann ausgewiesener Prinzipien: unaufgeregte Klarheit, Nachdenklichkeit, Zurückhaltung, Verständlichkeit, Flüssigkeit des Stils, Demokratie als permanente Revision der eigenen Position, Beobachter sein und nur – um Gottes will – kein heimlicher Seher, kein Voyeur, denn das wäre ja eine Machtposition, die man rechtfertigen muss. Diese Rundumvermeidung von Konflikten scheint anstrengend zu sein und kommt nicht immer leichtfüßig daher.
Schmickl verehrt furiose Männer: den Aeronauten Victor Silberer, den Krötenküsser Paul Kammerer (»bewundernswert heroisch«), und den auch nicht gerade unheroischen, um die »Weltgewaltordnung« ringenden Soziologen Karl Otto Hondrich. Schmickl hasst aus ehrlichem Antrieb die Gesellschaft der Selbstoptimierung, die Hektik der Originalitätsjäger und Selbstdarsteller – und so erscheinen seine Texte bald wie die Kehrseite eines Überforderungsprogramms, sie loben das Schwimmen und Scheitern, bejubeln Popklänge und den Zufall.
Depressionen sind in Schmickls lustbetonter Perspektive nur die Konsequenz aus einer Überforderung des Individuums. Die anstrengende Herausbildung von Persönlichkeit erschöpfe die Zeitgenossen, wirke wie ein Spiegel und hindere den Menschen daran, sich dem Wesentlichen anzunähern: dem Universellen.
Unter »Selbststeuerung« versteht Schmickl ein Grundvertrauen in führende Instanzen. »Es geht heute darum, dem Einzelnen wieder etwas von der Last zu nehmen, die ihm die moderne Forderung auferlegt, alles eigenständig entscheiden zu müssen.«
Eine merkwürdiger Rat, über den wohl nicht nur die arabische Revolutionäre schmunzeln würden. Welche gesellschaftliche Gruppe fühlt sich denn heute überfordert damit, Subjekt ihres eigenständigen Handelns zu sein? Die Intellektuellen? Die Migranten? Der saturierte Mittelstand? Die stillgelegten Expromis?
Wir kennen die Antwort nicht; doch da Schmickl nicht ständig Schmickl selbst sein mag, so kann und will er auch nicht ständig ein anderer sein (43). Bleibt Spazieren gehen, bleibt das Schreiben. Der Brust- u. Seitenschwimmer, der mit Frauen in Bassins, in denen er seine »überhitzte Emotionalität abkühlt«, unbedingt mithalten muss, hat sich für die Literatur entschieden. Beim Schreiben »richten sich die Gedanken auf, stehen gerade« (32).
Schmickl ist wohl das, was man einen Solipsisten nennt, und er hinkt in dieser Beziehung den nassforschen Adelsöhnen des Fin-de-Siècle kaum hinterher. Die ideale Form der Beziehung sieht er in der Beziehung zum Dienstpersonal der Kellner und Wirtinnen. Sie erfreuen ihn durch Mutterwitz; der Rest der Welt ist kompliziert aufgestellt in Gut und Böse.
Böse sind Vollwertnahrung, Multitasking, Heilsversprechen, Willensfetischisten, Paul Watzlawick. Schlimm ist die Machbarkeitsidee, man könne Beziehungen (außer zum Dienstpersonal) nach eigenen Vorstellungen gestalten.
Gut hingegen ist Popmusik – »eine Droge«; Fußballspiele – »der organisierte Übertritt ins Selbstvergessen«; edel ist Zurückgenommenheit, gefühlte Erfahrung, Gestalttherapie, Achtsamkeit, Zeitpsychologie überhaupt, und statt kastrierendem Gelächter zeigt uns Schmickl die Geste des inneren Lächelns.
Dieses »Lob der Easyness« umfasst natürlich auch Screwball Comedies, Wrestling und anderen Frohsinn aus der Kultur der guten Laune. Als Schriftsteller fragt Schmickl nach der Spezzatura, der Fähigkeit, das Anstrengende mühelos erscheinen zu lassen.
Lehrreich nennen wir erst die beiden Schlußtexte des Bandes, in denen sich Schmickl endlich freigeschrieben hat von den Karikatursilhouetten der Unterhaltung. Da findet sich eine kurze Meditation über die Ultragegenwärtigkeit, das Hier & Jetzt. Der Autor beschwört das mysteriöse Nu, eine Erfahrung von Zeitlosigkeit, in der Vergangenheit und Zukunft nicht abgetrennt sind vom aktuellen Augenblick.
Spannend auch Schmickls Einlassen auf Koninzidenzen bzw. Synchronizitäten, auf die Welt des Zufalls als die eigentliche, von der Kausalität abweichende Wirklichkeit. Ein Geisterreich von Korrespondenzen und Verbindungen tut sich da vor ihm auf, ein subkutaner Sinnzusammenhang, an dem schon Arthur Koestler herumgekiefelt hat. An dieser Stelle wagt Schmickl auch mal eine eigene These: nämlich, dass der Zufall eine historische Konstante sei, zu allen Zeiten gleich häufig anzutreffen.
In den letzten Beträgen des Bandes wird deutlich, worauf das »Lob der Leichtigkeit« eigentlich hinaus will: eher auf ein »Programm der Dichtigkeit«, eine »Kunst der Balance«, denn auf Nonchalance und Unbeschwertheit. Forcierte Existenzverdichtung, sinnlich-experimentelle Wahrnehmung, unentwegt kreierte mulitperspektivische Tableaus der Kultur – auf diese Weise konfiguriert dieser Schriftsteller das geistige Leben neu.
Gewiss, Schmickls journalistisch geprägtes Denken tendiert zur Lebenshilfe, zum lebensberaterischen Schreiben. Auf den Büchertischen mit solchen Titeln sind in letzter Zeit auch Werke hochaufragende »Philosophen der Psychoanalyse« aus dem Dunstkreis von Slavoj Žižek gelandet; und da war die Fallhöhe ungleich größer.
© Wolfgang Koch 2011
Gerald Schmickl: Lob der Leichtigkeit. Essays zum Zeitvertreib. Edition Atelier: Wien 2011, 160 Seiten, 16,90 EUR, ISBN 978-3-902498-40-3