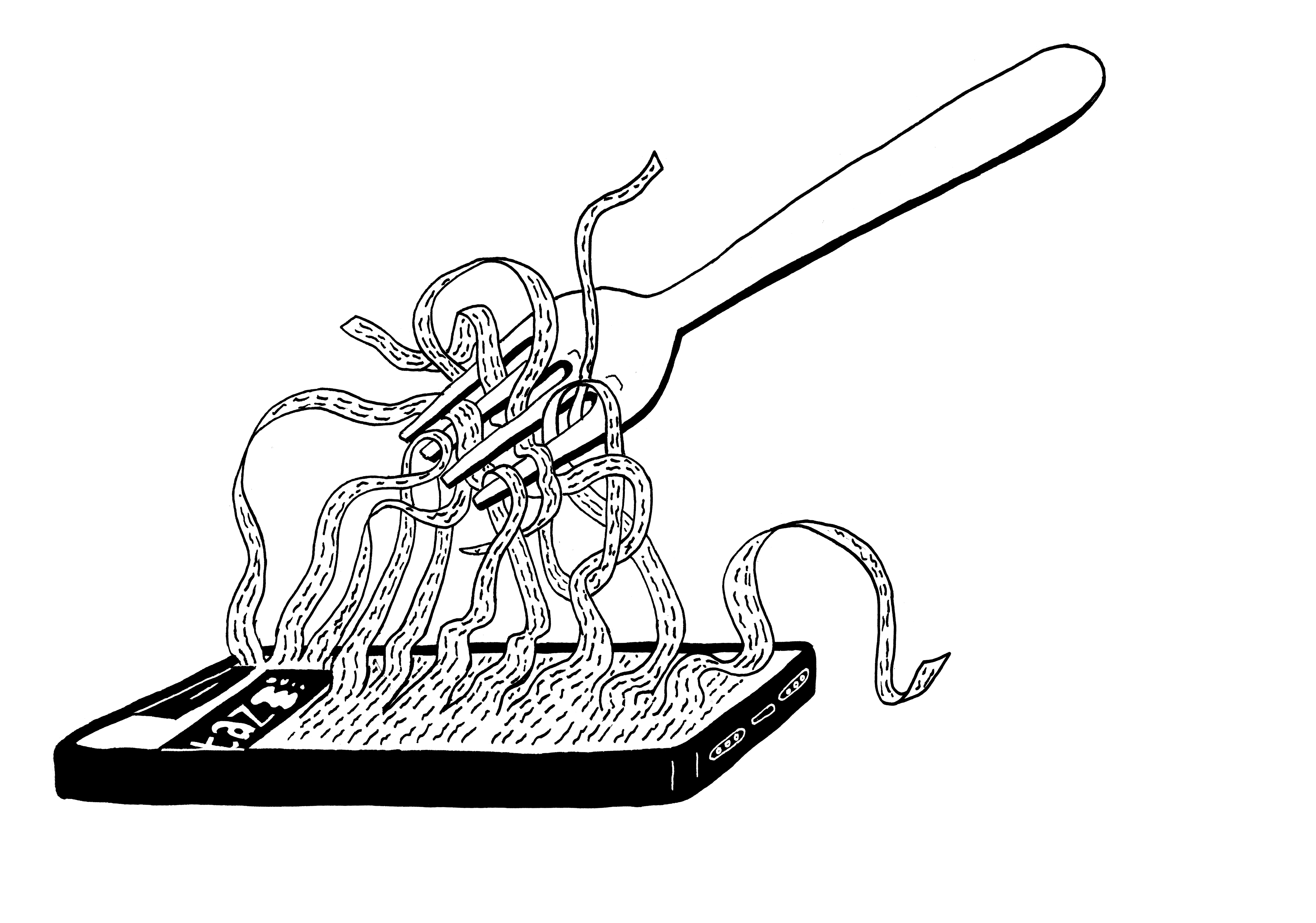Isabell Lorey ist Politikwissenschafterin und Mitherausgeberin des österreichischen Minibuchlabels transversal, das nach eigenem Bekunden »niemals zum Verlag werden will«. Sie lieferte bei der Wiener Foucault-Tagung im Juni 2015 einen zwar gut besuchten, aber doch enttäuschenden Vortrag zur Aktualität des französischen Denkers.
Lorey kam sich arg schlau dabei vor, Foucaults Revolutionsprosa der frühen 1970er-Jahre barrierefrei vorzutragen. Wahrscheinlich muss man ihr sogar dankbar sein dafür, da doch viele Leser heute den französischen Vordenker der Diskursanalyse als eine Art Meta-Geschichtsphilosophen auffassen und Foucaults pathetisches Geraune von der »Selbstermächtigung« und der »horizontalen Organisierung«, Foucaults Koketterien mit »revolutionären Praxen« und der »widerständigen Singularitäten« überhaupt nicht mehr zu Gesicht bekommen.
Isabell Lorey paraphrasierte tatsächlich Foucaults Singsang von einer »entschiedenen Kritik« und dem »Willen, nichtregiert zu werden«, als säße man zwischen zwei Nummern der Doors auf irgendeiner WG-Matratze. Foucault, war zu hören, habe die Idee einer Ganzheit des Gesellschaftlichen aufgegeben, es sollte nichts mehr geben, was Gesamtgesellschaft heißt; er habe die Kritik als eine Haltung entwickelt, in der Beziehungen subversiv und revolutionär vervielfältig werden müssten.
An der Kant’schen Schrift von 1798 habe Foucault »die Revolution als Ereignis« interessiert, der Augenblicksmoment, das Präsentische daran. Denn im raren Ereignis der Französischen Revolution habe sich nichts Geringeres als der Prozess der Aufklärung vollendet.
Hier ging es also um den schönen Widerstreit des Widerstreitenden, das Schillern der Revolte. Und was waren dann die revolutionären Kämpfe heute? – Syriza in Griechenland und Podemos in Spanien, wusste Lorey mit subtiler Eindringlichkeit zu verkünden. In staatsbankrotten Griechenland werde nämlich gerade die »präsentische Demokratie praktiziert« und im massenarbeitslosen Spanien die »Ontologie der Ent-Unterwerfung« hochgehalten.
Mit Limits am Bankomaten? Mit kostenlosen Schulspeisungen? Mit Gratisstrom und Wasser für Bedürftige, die ihre Rechnungen nicht bezahlen können?
Na, hallo! Das war doch ziemlich schräg gedacht. Im Süden Europas experimentieren die Massen ja keineswegs mit »horizontalen Versammlungen«. Da versuchen säumige Hypothekenschuldner den Zwangsräumungen von Wohnungen zu entkommen. Die Zentralregierungen müssen unentwegt bei hochverschuldeten Regionen wie Katalonien oder Valencia als Nothelfer einspringen, damit die laufenden Rechungen, etwa im Gesundheitswesen, überhaupt noch bezahlt werden können.
Wer die Schuld daran trägt? Natürlich Schäuble und Merkel. Man brauchte Lorey gar nicht zu fragen. Die Politikwissenschafterin wollte erkannt haben, dass die ausgabefreudigen Linkspopulistischen in Griechenland und in Spanien die repräsentative Demokartie nicht vollends ablehnen. Daraus zog sie den Schluss, dass sich die mediterranen Menschen von heute »einander affizieren« wollen, dass sie neue Verbundenheiten mit anderen, ja mit uns, herstellen.
Foucault als Gesellschaftsdenker? Das hat etwas Karikaturenhaftes. Was sollte ein homosexeller Philosoph, der vor dreißig Jahren die islamischen Revolution bejubelt hat, zum »Schuldenschnitt« für bankrotte Unionseuropäer und zur »Keule des Stabiltätsgesetzes« zu sagen haben!
Den Linksfoucaultianer bereitete es in Wien die größte Mühe, aus dem Objekt ihrer Begierde einen Demokratietheoretiker zu machen. Dazu musste erst Foucaults Beschäftigung mit der antiken Polis und mit dem Kynismus in Stellung gebracht werden, man erinnerte daran, dass er gerne »die Leute« für Mensch gesagt hat…
Anders taucht der Gleichheitsgedanke bei Foucault nämlich nicht auf.
Die Demokratie als Ereignis verlange einen »Bruch in der Lebensweise«, erklärte Lorey, der politische Erkenntnisinstinkt verlange eine »Produktion neuer Subjektivierung«. – Doch in der Vergangenheit ist immer nur das Plebiszit zu einem spontanen Ereignis der Demokratie geworden, die vorübergehende Anerkennung des Führerprinzips im Augenblick der Gefahr, um für das Kollektiv einen zeitlichen Handlungsraum zu gewinnen.
Das ist sicher nicht die Zukunftsmusik, die wir hören wollen.
Für einen Teilnehmer der Lesegeneration im langen Sommer der Theorie ist es schwer zu verstehen, warum jüngere Akademiker das Revolutionsgeschwurbel aus dem Theatrum Philosophicum von einst nachbetet, warum sie nicht mit einem sprachanalytischen Blick an die »polyvalenten« Illusionen der Linksintellektuellen der 1970er-Jahre herangehen.
Gut, die Welt will verändert werden; das scheint ja auch notwendig – und man braucht eine schlüssige politische Theorie dazu. Aber wer heute politisch etwas bewegen will, braucht nur in eine Parlamentspartei einzutreten und dort die impliziten Gesetze seines Gefangenseins zu durchbrechen. In den wortkargen 1970ern standen die Tore der Sozialdemokratie noch nicht so offen wie heute, und die Grünen standen noch überhaupt nicht zur Verfügung.
Genau das aber – die Spielregeln umkehren, die Systeme der Macht unterbrechen, das Gelächter im Räderwerk des Politikbetriebs anstimmen –, das wollen die heutigen Foucault-Fans ja gar nicht. Ihnen dient das schwierige Denken allein zum Distinktionsgewinn in der Schauarena ihrer universitären Karrierekämpfe.
Die Leistung der Generation Merve lag darin, diese Selbsttäuschung der akademischen Elite nach einer Weile durchschaut zu haben, der »Subversion des Wissens«, dem wilden Denken, dem mit der linken Hand Geplanten, den diskursiven Gegenstrategien in der Kunst, in den Kulturwissenschaften und in der Geschichtsforschung breiten Raum zu geben, im übrigen aber die taz zu abonnieren und wieder wählen zu gehen.
Es gehört schon einige Naivität dazu, die intellektuelle Verantwortungslosigkeit des Franzosen heute schön zu reden. Foucault sagte 1971 vor Studenten: »Was der Philosophieprofessor in seinem komplizierten Vokabular nicht mehr zu sagen wagt, wird vom Journalisten ohne Vorbehalt proklamiert«, und keine zwei Jahrzehnte später führte er uns am Regimewechsel im Iran vor, dass er nicht einmal die elementarste Regel des Journalismus, das Distanzhalten zu den Ereignissen, beherrschte.
Foucault forderte »die revolutionäre Aktion« müsse »zum Angriff auf Machtverhältnisse übergehen«, sie müsse gleichzeitig das Bewusstsein und die Institutionen erschüttern, er sprach von »Fronten« und »Kämpfen« innerhalb der Gesellschaft. »Drogen, Sex, gemeinschaftliches Leben, ein anderes Bewusstsein, ein anderer Typ von Individualität… Ist der wissenschaftliche Sozialismus im 19. Jahrhundert aus Utopien hervorgegangen, so wird der wirkliche Sozialismus im 20. Jahrhundert vielleicht aus Erfahrungen hervorgehen«.
Da hat er nicht getan; er konnte er gar nicht, weil sich Leben und Denken, Erfahrung und Ideologie eben nicht so plump als unversöhnliche Pole gegenüberstehen. Der Reformismus, behauptete Foucault, bestünde darin, die Institutionen zu verändern, ohne an das ideologische System zu rühren; beim Humanismus verhalte es sich genau umgekehrt.
Aber auch das war falsch. In Wahrheit haben sich alle Ideologien ständig weiterentwickelt; der Sozialdemokratismus war im Kalten Krieg ganz ein anderer als der Sozialdemokratismus der Babyboom-Generation. Der Faschismus eines Yukio Mishma war ganz ein anderer als der Faschismus der Rosenbergs, usw.
Ideologien sind von gesellschaftlichen Veränderungen noch nie unbeindruckt geblieben. – Wie hatte es zu solchen Fehleinschätzungen bei Foucault kommen können?
Die Antwort ist: Er war eben außerhalb der Archivalien vor allem ein typischer westeuropäischer Liberaler, der sich durch persönlichen Einsatz zu jenem Verbalradikalismus berechtigt sah, den er seinen Gegnern untersagte.
Ende der 1970er-Jahre hatte sich um Foucault ein fester Diskussionskreis gebildet, der sich im Hörsaal eines Krankenhauses traf. Er versäumte kein Thema, ob es nun um den Libanon ging, um Afghanistan oder Chile, um den Niedergang der Gewerkschaften oder die Sozialversicherung, die antikommunistische Opposition in der Sowjetunion oder die Guerilla in Mittelamerika. Foucault eilte nach Polen, um Solidarność zu unterstützen, er erhob seine Stimme für Vietnamflüchtlinge, in der Gefängnisbewegung, unternahm Meditationen in Auschwitz – Foucault war auch eine überdimensionale Komiteedame, ein sich in der Zivilgesellschaft verausgabender Intellektueller, der die Existenz staatstragender politischer Kräfte insgeheim verachtete.
Die Foucault-Forscher werden eines Tages seine überragende intellektuelle Leistung mit dieser Hyperaktivität seines persönlichen Lebens abgleichen und bilanzieren müssen – all das übermenschlich Gewissenhafte daran, das Weltretter-Syndrom mit Foucaults beeindruckendem Willen zum Wissen, mit seiner unendlich gelehrten Überlagerung von Karten und Blicken.
Dann allerdings wird Foucault als der typische Intellektuelle der europäischen Buchkultur erscheinen, der die bestehende Ordnung immer schon im wesentlichen für unabänderlich hält und dennoch – trotzig, widerständig – meint, dass unbedingt überall geholfen werden muss, wo eben geholfen werden kann.
Das wird wohl noch eine Zeit lang dauern. Im heurigen Sommer können sich die akademischen Linksfoucaultianer, die solidarisch in Griechenland baden gehen, noch im umfassenden Sinn beim Schwimmen als Philosophen fühlen.
© Wolfgang Koch 2015
Foto: Volksgarten Pavillon