Es ist schon erstaunlich, was man heutzutage in Wien alles erleben kann. Da erreicht die Kunstszene eine Hiobsbotschaft nach der anderen: der Maler Ernst Fuchs ergab sich letzte Woche dem Tod und die TBA21-Sammlung der Francesca Habsburg, eine der umfangreichsten Privatsammlungen der zeitgenössischen Kunst in Europa, wandert sang- und klanglos nach Zürich ab.
Unglaublich! Gerade erst sind Bawag- und Generali Foundation für den Standort Wien verloren gegangen. Die Privatsammlung Essl in Klosterneuburg existiert nur mehr dank eines Baulöwen, der gerade auch über das Schicksal des Künstlerhauses befindet.
Ein Erdbeben nach dem anderen wirft die Bildende Kunst in Wien um Jahrzehnte zurück, während sich die für dieses Drama doch eigentlich zuständigen Kulturpolitiker Josef Ostermeyer (SPÖ) und Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ), die gewiss ihre ideologische Nöte bei der Kooperation mit der Privatwirtschaft haben, auf Nestroy- und anderen Galas vom Theatervolk den Hintern auskehren lassen.
Es ist schon erstaunlich, dass sich in dieser für die Kunst wirklich katastrophalen Zeit der von echten Räubern und echten Steuerbehörden drangsalierte Orgienmysteriker aus Prinzendorf in seine Foundation Nitsch setzt und geduldig und scharfsinnig seine Sicht auf das eigene Werk und das Erbe der Psychoanalyse formuliert.
Hermann Nitsch, man kann das nicht oft genug sagen, ist einer der ganz wenigen lebenden Künstler, eine große Ausnahmeerscheinung am Markt der visuellen Sprache, weil er sich im jahrzehntelangen intellektuellen Alleingang eine schlüssige Theorie zu seinem praktischen Schaffen erarbeitet hat.
Nitsch veranstaltet ja nicht nur Aktionspiele, mit denen er eine große Theaterreform verfolgt, er schmiert nicht nur wollüstig Farbpasten auf makellos weiße Leinwände, er wühlt nicht nur in tierischen Innereien, in denen morgen schon die Würmer hausen, er weist dazu auch die passende Kot-Theorien der psychoanalistischen Bewegung zu zitieren, er komponiert nicht nur Symphonien, sondern vermag sein Schaffen auch in einer rhetorischen Prägnanz zu artikulieren, wie kaum ein Künstlergenosse.
Nitsch behauptet tatsächlich einen therapeuthisch-katharsischen Zweck seiner Arbeit. Sein ungeheuerliches Elementarisieren des Blicks gehörte von Anfang an zu einem Plan, der von wohldurchdachten Ideengebäuden auch schriftlich abgesichert ist.
Denn Nitsch hat schon in jungen Jahren die Werke von Nietzsche und Freud, von Alfred Schuler und Oskar Pfister, von Max Scheler, Carl Gustav Jung, Odo Casel und Georg Trakl selbstständig durchdacht. Und er hat sich tief hingehört in die Klangbauwerke von Richard Wagner und Alexander Skrijabin.
Das alles kristallisierte ab den 1960er-Jahren zu einem Gesamtschaffen, von dem die Menschheit noch zehren wird, wenn der Hype des Virtuellen längst wieder vergangen ist.

Von Sigmund Freud hat Nitsch die Repressions- und Verdrängungsthese übernommen, nicht aber dessen Kulturbegriff, der die Kultur in einen Gegensatz zu Triebhaften positioniert. »Meine Schmierereien«, sagt er «sind das nonverbale Ausloten eines Triebhaften, das meiner Erfahrung nach mit den Mittel der Sprache nicht mitgeteilt werden kann«.
Und Freuds Faszination des Sexuellen, der stellt Nitsch eine pantheistische Seinsmystik im festlichen Exzess gegenüber. Auf diese Weise baut er in seinen Werken unablässig an einer agonalen Verausgabung, an einer Skala der Selbstverschwendung aus dem unabweislichen Gefühl einer Verpflichtung gegenüber der Natur, dem Kosmos und der Tragödie der Menschheit.
»Kunst kann durch Form bewusst machen«, betont Nitsch und berichtet: »Wir haben nach jeder unserer Mysterienspiele drei Tage lang geschlafen und dann vierzehn Nächte lang farbig geträumt. Das Ritual ist aus meiner Sicht eine metaphysische Sprache; man wiederholt etwas, bis es auch der Dümmste kapiert. Meine Kunst geht im taoistischen Sinn den Weg, der das Sein ist«.
Nitsch ist der tiefen Überzeugung, dass wir immer noch mitten in einem dionysischen Zeitalter leben. Nicht nur die Rolle der Weinkeller im Winter deute darauf hin, auch das Hervorbringen der Künstlers in der einmaligen Weltecke des Weinviertels selbst. »Ohne unsere dionysische Landschaften hätten wir keinen Beethoven und keinen Schubert hervorgebracht«.
Für Gottfried Benn, betont Nitsch, sei Kunst »die einzige akzeptable metaphysische Tätigkeit« gewesen, die ein Mensch ausüben kann. Diese elementare Tatsache werde in dem »heutigen Scheisssbetrieb der Kunst, in dem sich alles ums Marketing dreht« völlig übersehen.Kunst ist eine praktische und notwendige Weise der Weltbehandlung.
Das werden die Claquere der Nestroy-Gala nie verstehen.
© Wolfgang Koch 2015
Fotos: Manfred Mikysek



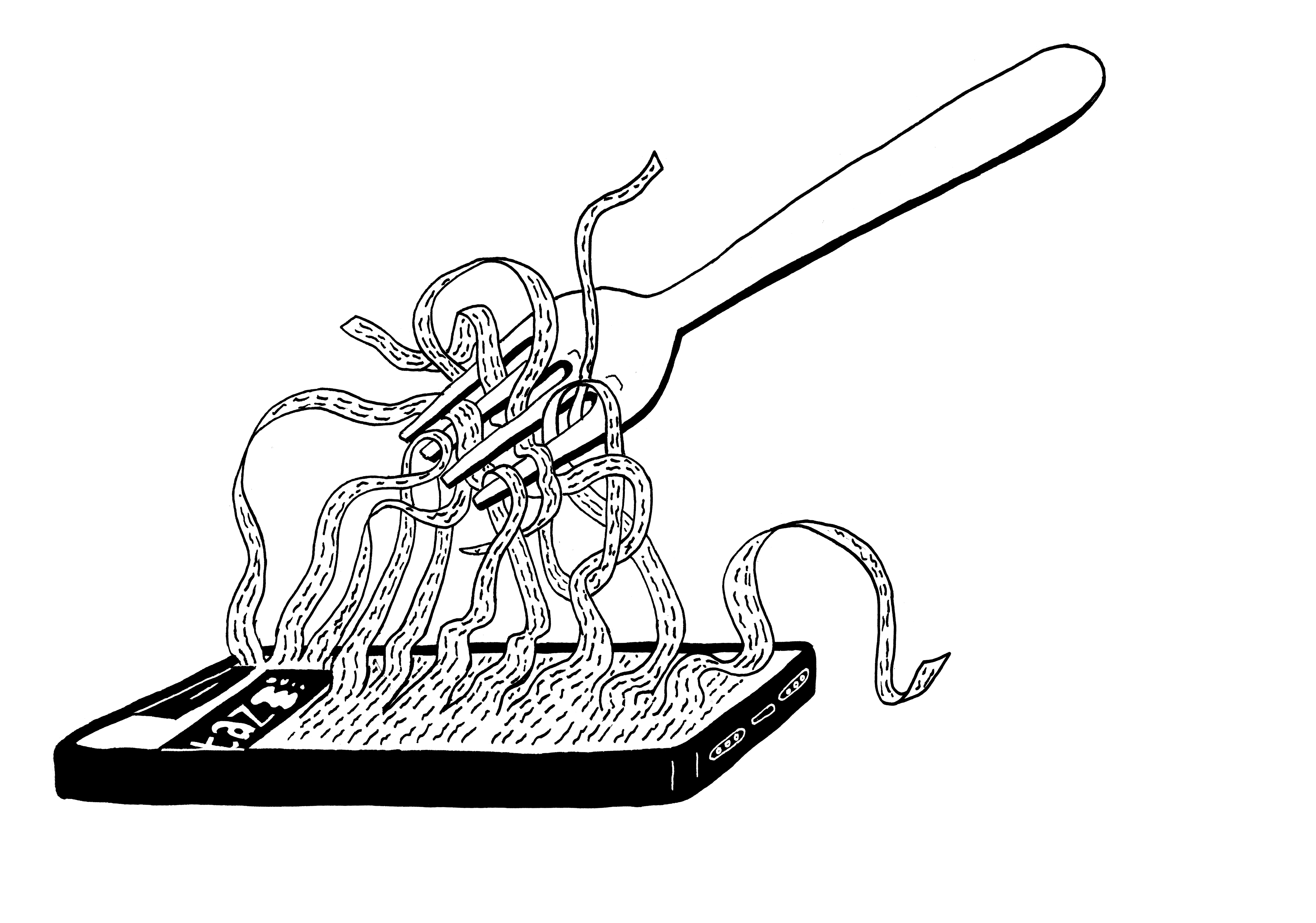
Sehr Cool!