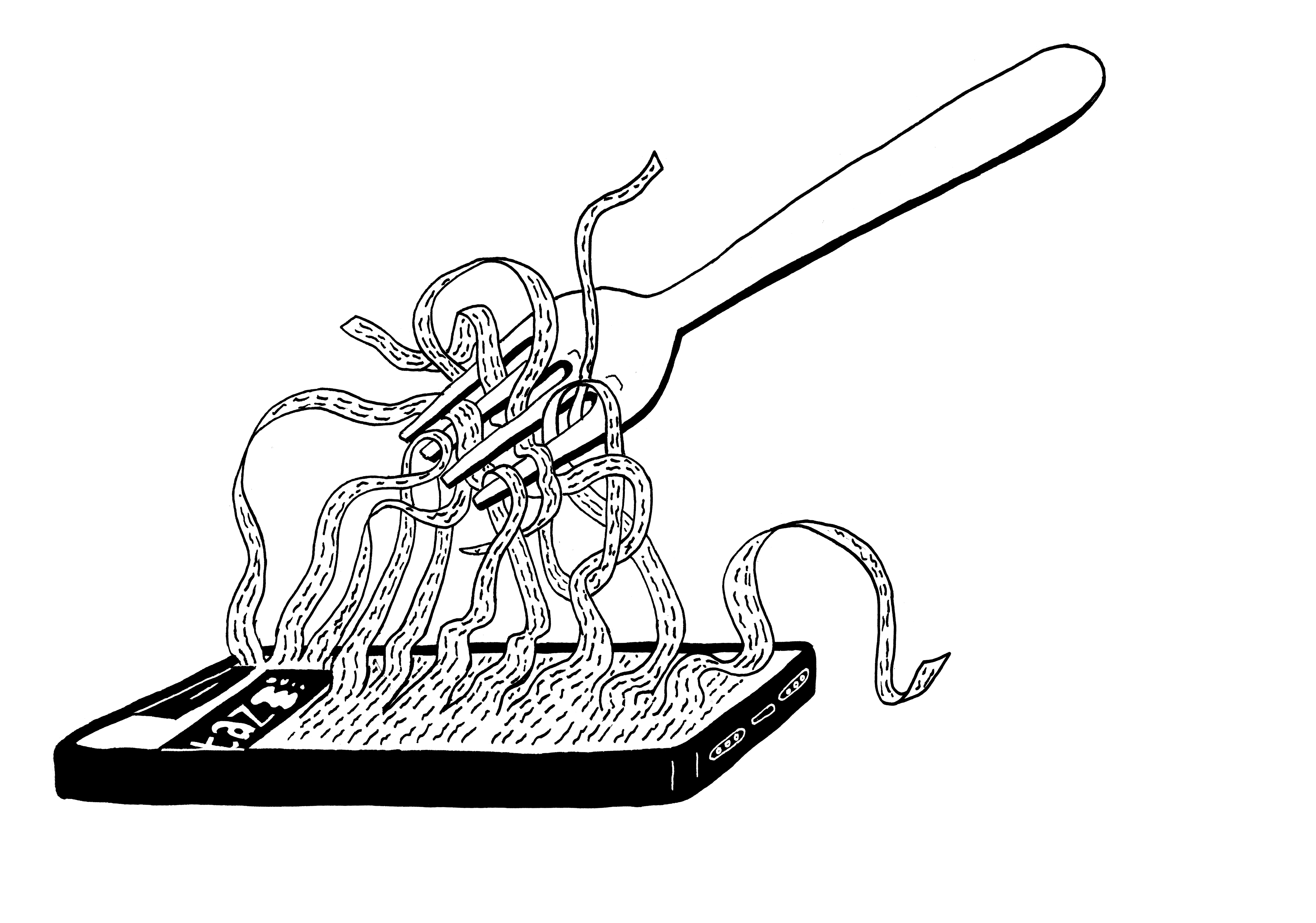Emmanuel Todd ist einer der wertvollsten Intellektuellen, die wir seit Jahren in Europa haben. Natürlich hat der französische Anthopologe und Historiker vollkommen recht mit dem, was er kürzlich in verschiedenen Interviews, unter anderem für den italienischen Corriere della Sera, geäussert hat. Westeuropa wird früher oder später sein Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen, es wird nicht für immer unter der Obhut der Vereinigten Staaten bleiben können.
Trotz des Ukrainekriegs sieht Todd langfristig die Wiederherstellung der Autonomie des europäischen Kontinents voraus. Sie wird in seinen Augen dank der Annäherung zwischen Russland und Deutschland in Gang kommen. Für den Franzosen sind das die beiden Länder, welche die bittere Gewalt von Totalitarismen auf diesem Kontinent überlebt haben – eine vereinigende, zusammenschweissende Erfahrung.
Europa in 100 Jahren
Emmanuel Todd hofft weiters »auf die Wiederbelebung des ursprünglichen europäischen Trios – Deutschland, Italien und Frankreich –, das gemeinsam Europa der Kontrolle der USA entziehen könnte«. Der psychologische Schock, der uns Westeuropäer erwartet, werde darin bestehen, dass wir erkennen müssen, »dass die Nato nicht existiert, um uns zu schützen, sondern um uns zu kontrollieren«.
Emmanuel Todds sympathische Zukunftsvision ist von der politischen Realität der Gegenwart allerdings so weit entfernt wie die Wiedervereinigung der beiden Koreas oder die Verleihung des Friedennobelpreises an Ali Chamenei und die jemenitischen Huthi-Rebellen. Andererseits: Dass die Dinge nicht mehr lange so bleiben könne, wie sie liegen, das dämmert inzwischen sogar der Grünen-Partei, die den hässlichen Bellizismus der deutschen Ampelregierung anführt.
Mit schöner Regelmässigkeit zerpflückt F.A.Z.-Feuilletonredakteur Christian Geyer-Hindemith das akademische Kauderwelsch in den Pressekonferenzen der Grünen-Regierungsriege. Diese Glossen gehören zum Unterhaltsamsten, was der aktuelle Medienbetrieb in Deutschland zu bieten hat.
Ex-Umweltminister Jürgen Trittin beherrscht zwar den abgehobener Jargon seiner Parteikollegen ebenfalls, er arbeitet sich in seinem taz-Essay aber zu einer geostrategischen Begriffsdiskussion vor, die die sprachlichen Masturbationsakte der amtierenden Minister·innen wohltuend hinter sich lassen.
Trittin ventiliert, ohne eigens darauf hinzuweisen, eine schon vor Jahren geäusserte These von Thomas Kleine-Brockhoff, Experte des German Marshall Fund, wonach die Welt heute schlicht zu komplex sei, um noch weiterhin von dem »Westen« zu reden, und er schliesst sich Kleine-Brockhoffs Vorstellung an, dass die internationale Ordnung durch einen »muskulösen Liberalismus« neu legitimiert werden muss.
Trittins geostrategische These: Es trifft die neue Weltlage nicht mehr, vom »Westen versus Autokratien« zu reden. Eine solche Sicht auf die Kriege und Konflikte werden vom globalen Süden nicht geteilt. Die arrogante Begrifflichkeit sei in der Aussenpolitik bei der Suche nach neuen Partnern wenig dienlich.
Kein unschuldiger Begriff
Was genau »in Kooperation mit Andersdenkenden, Andersregierten und Andersregierenden« geschehen soll, das lässt der Autor im Dunkel. Mehr Multilateralismus zur Koordination nationaler Politiken in internationalen Organisationen? Oder mehr negative Sicherheitsgarantien von Nuklearwaffenstaaten, Nichtnuklearstaaten nicht zu bedrohen?
Solche politischen Details erfahren wir nicht. Dem Kritiker des »politischen Westens« stört vor allem, dass China und Russland sich darin gefallen, mit dem Begriff die universellen Rechte der UN-Charta als »westliche Werte« zu diskreditieren und zu denunzieren.
Natürlich ist der Westen, wie bereits der Globalhistoriker Jürgen Osterhammel festgestellt hat, auch für Trittin »kein unschuldiger Begriff«. In seinem Bedeutungskern ist die Vorstellung der eigenen Überlegenheit einbaut, und Anspruch und Wirklichkeit klaffen auf jedem der fünf Kontinente weit auseinander. »Der demokratische Kapitalismus Europas wie der USA lebte den Widerspruch zwischen Demokratie und Kapitalismus im Zweifel regelmässig zulasten der Demokratie aus«, so Trittin.
So einfach, dass wir den politischen Westen auf ein uneingelöstes Versprechen der bürgerlichen Epoche reduzieren, oder dass wir, wie Todd, den Westen für eine Zivilisation halten, »die ihr moralisches und soziales Kapital erschöpft hat«, wollen wir es uns mit Geschichte und Gegenwart nicht machen.
Um die ganze Wucht des Begriffs zu verstehen, ist es notwendig, tiefer in die Vergangenheit des Abendlands zurückzugehen. Und was seine Wirksamkeit in der planetarischen Politik betrifft, kann ein »ökonomisch resilientes Europa« schwerlich durch »verstärkten gemeinsamen Rüstungsanstrengungen« als Player auf die Weltbühne wiederkehren, wie sich Trittin das vorstellt.

Nach Ansicht des Ex-Ministers genügt es in der multiplar gewordenen Welt einfach das Gerede von »dem Westen« ad acta zu legen. »Es schadet Europa mehr, als es nützt. Denn der politische Westen, der 1789 und die Französische Revolution, der die amerikanische Verfassung und die Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte meint, war nie der reale Westen«.
Dem ist entgegen zu halten, dass die Ethik der Pleonexia, des Rechts des Stärkeren, deren Gerechtigkeit darin besteht, dass der Stärkere im Zustand der Natur bedingungslos über die Masse der Schwächeren herrscht, und die Ethik der Kultur, in der die Masse der Schwachen dem Starken Fesseln anlegt, innerlich zusammen gehören. Aus der Leugung eines mächtigen Gewaltzusammenhangs erwächst noch keine neue Souveränität.
© Wolfgang Koch 2024