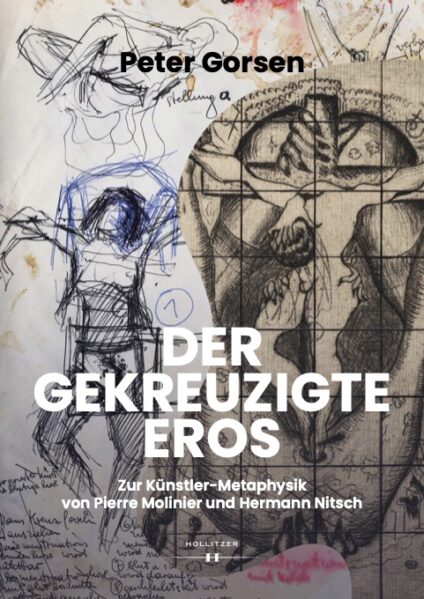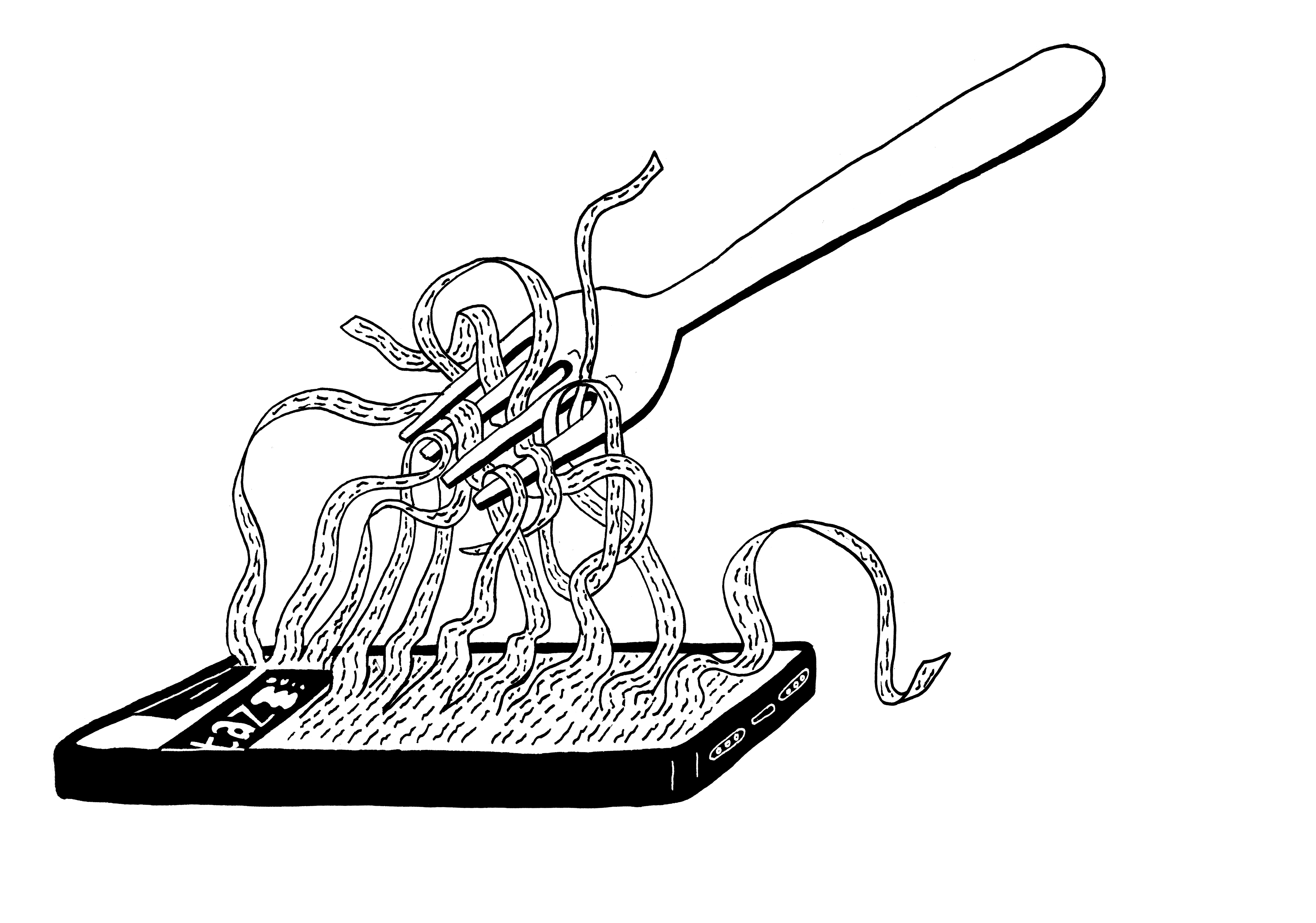Es begann mit einer fulminanten Werbekampagne. Durch die Stadt kurvte eine mit Aktionsfotos beklebte Bim, wie in Wien die Strassenbahn genannt wird. Aber die Eröffnungsausstellung des Wiener Aktionismus Museums (WAM) war doch nur eine brave Fotoschau; der für Sommer 2024 angekündigte Katalog hat leider weitere sechs Monate auf sich warten lassen, und Chefkuratorin Eva Badura-Triska liess sich bei der Eröffnung mehrfach als »Grande Dame des Wiener Aktionismus« ansprechen, was die verdienstvolle Kunsthistorikerin natürlich nicht ist.
Es gab nie eine »Grande Dame des Wiener Aktionismus«, und wenn es eine gegeben hätte, dann wären Anna Brus, Hanel Koeck-Gorsen oder Ingrid Wiener als eine solche anzusprechen gewesen. Der Wiener Aktionismus war eine Männerveranstaltung mit stark viriler Ausstrahlung, in der sich junge Aufsteiger im Kunstbetrieb ihre Freudinnen und Gattinnen als Versorgerinnen, als Musen, Inspiratorinnen, Managerinnen und als im Wesentlichen passive Akteurinnen hielten.
Hier sind wir bei einem weiteren Schwachpunkt des WAM. Es blieb uns im ersten Jahr seines Bestehens die grossspurig angekündigte Neubewertung der Geschlechterdifferenz im Handlungsfeld der Aktionisten ebenso schuldig wie den versprochenen kritischen Umgang mit dem zweifelhaften und rechtskräftig verurteilten Mitstreiter der Bewegung Otto Muehl.
Üble Praktiken des Kunsthandels
Umso erfreulicher ist, dass das von Privatsammlern getragene WAM mit der Halbjahresausstellung ›Vier Aktionen‹ endlich einen Weg gefunden hat, eine hochinformative und zugleich geschmackvolle Präsentation jener Avantgardetruppe vorzunehmen, die den Körper als bevorzugtes Ausdrucksmittel gewählt hat.

Zu sehen sind in der Wiener City alle vorhandenen Fotodokumente von vier klug und spannend ausgewählten Aktionen, welche die Protagonisten in der ersten Hälfte der 1960er-Jahre in einem Kellerraum und in einer Privatwohnung nach zuvor festgelegten Partituren durchgeführt haben: ›3. Aktion‹ (1963) von Hermann Nitsch, ›Mama und Papa‹ (1964) von Otto Muehl, ›Silber‹ (1965) von Günter Brus und ›4. Aktion‹ (1965) von Rudolf Schwarzkogler.
Die Materialaktion ›Mama und Papa‹ mit viel nacktem Fleisch, Federn, Farbe und Blumen fand in dem 2014 wiedererwachten Perinetkeller in Wien-Brigittenau statt. Kurator Pascal Zoss hat in jahrelanger Recherche mehr als 300 Schwarzweiss-Negative, die von zwei Fotografen stammen, gesichtet und damit (ergänzt noch durch Filmstills in Farbe) entlang einer Timeline das gesamte Aktionsgeschehen rekonstruiert. Dazu muss man wissen, dass der Wiener Kunsthandel seit Jahrzehnten mit dem dokumentarischen Material der Aktionen Schindluder betreibt: Es wurden und werden Negative, Dias, Abzüge und Kontaktstreifen willkürlich dupliziert und an Sammler·innen verschachert. Die Künstler haben aber nur ganz bestimmte Aufnahmen aus dem Material autorisiert. Detallierte Werkverzeichnisse fehlen bis heute.
Informative Gegenüberstellung
Das Wiener Aktionismus Museum fand eine intelligente Lösung für das Dilemma der Kunstgeschichte. An den Wänden sind kanonisierte Aktionsbilder zu sehen und im Idealfall darunter das gesamte verfügbare Dokumentarmaterial, so dass wir uns 60 Jahre danach ein recht gutes Bild vom Ablauf des Aktionsgeschehens machen können.

Die Bilder im Nitsch-Raum stammen vom legendären »Fest des psychophysischen Naturalismus« im Perinetkeller, einer Aktion, die damals in der Strasse einen Polizeieinsatz unter reger Anteilnahme der Anwohner·innen auf den Plan rief. Zu sehen sind fotografische Aufnahmen von Ludwig Hoffenreich und Georg Mikes, von denen der Künstler viele nie gezeigt hat.
Das hatte trifftige Gründe! Wir sehen auf den Bildern, dass damals auch ein Kind im Raum war. Wir sehen, dass die Akteure beim Hantieren mit Farbeimern, Gedärmen, Fleischerhaken und Mauerklampfe auch miteinander kommunizierten, dass sie lachten und scherzten. Wir sehen, dass sich die Dokumentaristen gegenseitig im Weg standen. Und Hermann Nitsch scheint auf einer Aufnahme beim Blutorgeln über dem beschmutzten Bett geradezu zu schweben.
Das Bild hätte, so meine ich, wie ›Bichonnade‹‹ (1905) von Jacques-Henri Lartigue, wo zu sehen ist, wie eine Frau lachend die Treppe hinabfliegt, während die Balustrade stur nach oben schreitet, eine weitere Ikone der modernen Kunst werden können. Der über dem Bett schwebende Akteur hätte die Fortsetzung von Philippe Halsmans Jumpology (1950/59) oder, noch besser, von Yves Kleins berühmten ›Leap into the Void‹ (1960) werden können, bei dem der Künstler von einem Dach im Pariser Vorort Fontenay-aux-Roses scheinbar in die Tiefe sprang, was von den Fotografen Harry Shunk und Jean Kender zur Illusion montiert wurde, dass Yves Klein fliegen konnte.
Konsequqnter Verzicht auf Bildgags
Hermann Nitsch hat sein Wirken zeitlebens historisiert, das heisst auf die Rezeption, wo sich die Gelegenheit bot, Einfluss genommen. Dazu gehörte es auch, solche Aufnahmen zu marginalisieren. Der Bildwitz verdankt sich ja der technischen Apparatur der Kamera, welche die Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Augens weit übertrifft.
Das war nach Ansicht des Künstlers vollkommen uninteressant. Für ihn ging es einzig und allein um intensives sinnliches Erfahren der Welt, nicht um virtuose Bildergags. Nitsch strebte mit seinem Werk zum Theater und zum Gesamtkunstwerk. Was ihn auszeichnete, war sein Glaube, ein durch die Tragödie vermittelter Optimismus könnte die eigene Epoche mit Luftkrieg, funktionalistischer Architektur und Windparks wie eine Schuld zurückweisen.
Die Gegenüberstellung von unbeschnittenen und beschnittenen Fotosujets in der Ausstellung zeigt also haarscharf, worauf es den Wiener Aktionisten eigentlich ankam. Sie brachen radikal mit der Logik der Bildunterhaltung. Brus benötigte keine Leinwand; er bemalte seinen Körper. Doch es ging ihm dabei nicht um einen spektakulären Schaueffekt. Nitsch benötigte keinen Sprung in die Leere. Für ihn lag das Sakrale im Bewusstsein unserer Beziehungen zu Kosmos und Tod.
Das Dasein sollte in der Performance als reine Aktualität auferstehen. Wiener Aktionismus – das hiess einen Raum mit Körpern und Materialien füllen und so eine geistige Situation zu schaffen, die sich auf einer konstruierten Ebene mit ihren eigenen inneren Gesetzen abspielt.
© Wolfgang Koch 2025
Ausstellung ›Vier Aktionen‹ im Wiener Aktionismus Museum (WAM), 1010 Wien, Weihburggasse 26, bis 27. Juli 2025. wieneraktionismus.at