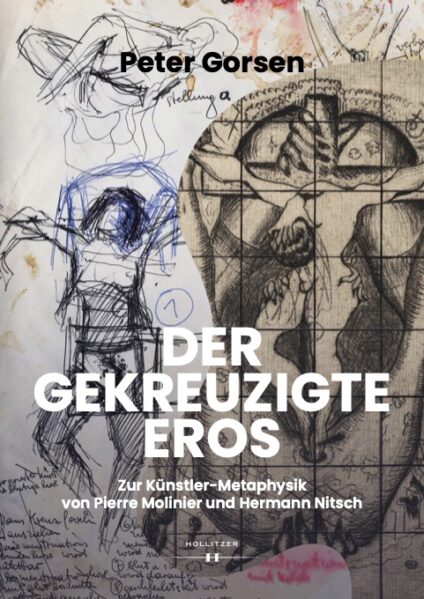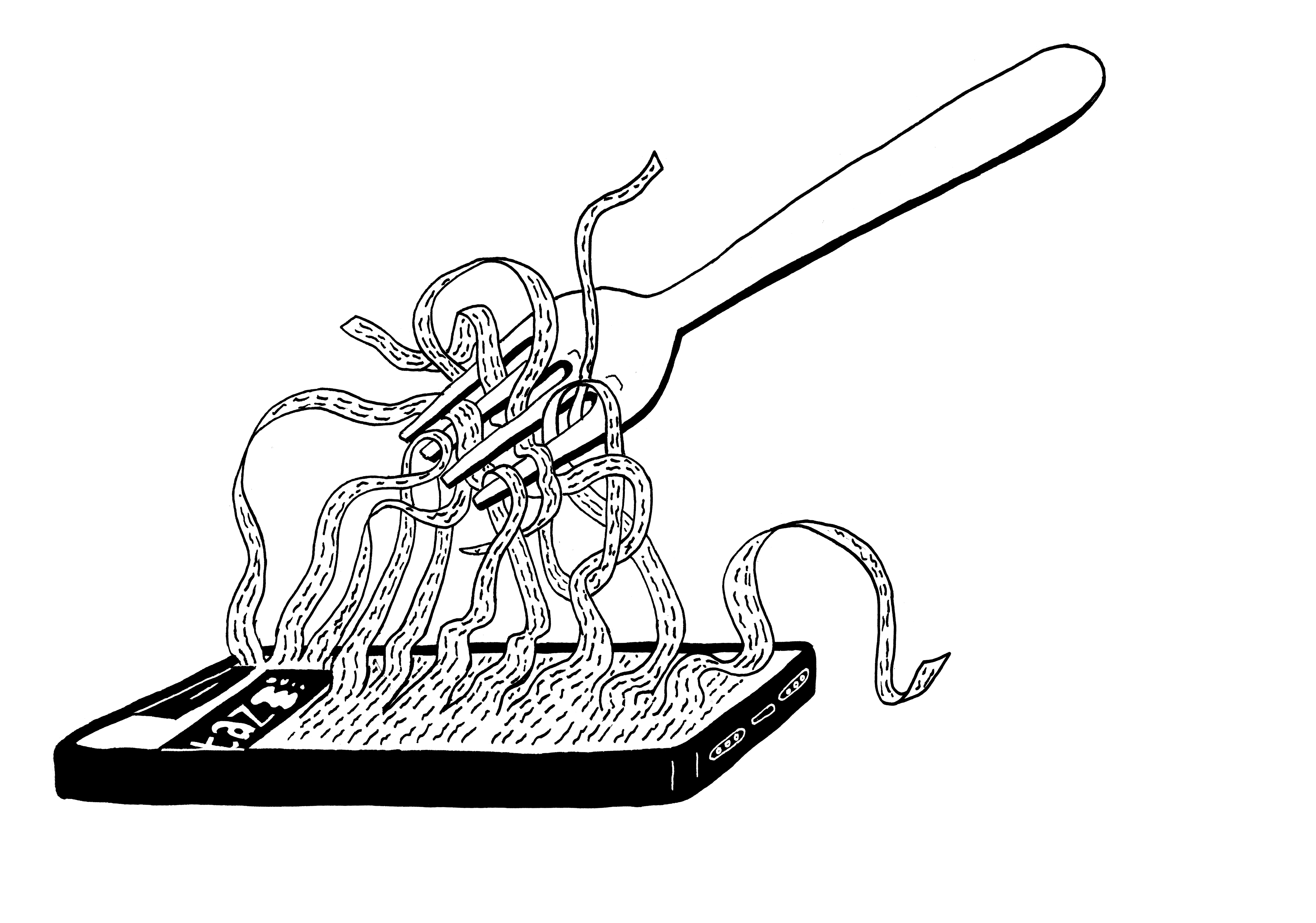Der Wiener Künstler, Kunstpädagoge und Non-Profit-Aktivist Frank Gassner ist seit 27 Jahren an den Aktionsspielen des Orgien Mysterien Theaters in vielfältiger Form beteiligt. Er hat Hermann Nitsch, den Schöpfer des spektakulären Gesamtkunstwerks, kurz vor dessen Eintritt in das Krankenhaus im Jänner 2022 das letzte Mal gesehen. Sie besprachen damals, was nun vollendet wird.
In Film- und Fotodokumentationen ist zu sehen, dass das Stamm-Team der Mitwirkenden gemeinsam mit dem Orgien Mysterien Theater altert. Das einstige Ideal des griechischen Körpers scheint auf den Tragen, am Kreuz und beim sogenannten Ballett auf der schrägen Ebene schon vergessen.
GASSNER: Der Grossteil der Akteure ist heute über vierzig Jahre alt, und das ist auch der Grund, warum es das Orgien Mysterien Theater in der Originalbesetzung bald nicht mehr geben wird. Nitsch hatte zwar ein androgynes Körperideal, der Rippenbogen und die Atmung sollten gut zu sichtbar sein, aber im Aktionsvollzug hatte er auch mit Abweichungen kein Problem. Er hat sogar einmal, vielleicht aufgrund seiner eigenen Physiognomie, den Wunsch geäussert, eine Aktion ausschliesslich mit wohlbeleibten Menschen zu machen. Schwierigkeiten hatte er nur mit Bärten und Tattoos.
Was ist die härteste Herausforderung für die Regie?
GASSNER: Mit der Hälfte der siebzig Akteure proben wir nur drei Tage lang. Das ist sehr knapp. Bei den Proben unterscheiden wir zwischen der Regie, die in der Aktion nicht mehr zu sehen ist, und der Spielleitung, die Leo Kopp und ich quasi als Zeremonienmeister im Spielvollzug übernehmen. Um ohne Partitur dazustehen, müsste man wirklich zwei Monate lang proben.

Die Einsätze der Orchester werden von Unter- und Hauptdirigenten unauffällig per Handzeichen koordiniert. Warum gelingt das der Aktionsregie nicht?
GASSNER: Dazu ist unser Aktionsablauf immer noch zu komplex, obwohl der visuelle Aspekt gegenüber dem auditiven deutlich abgenommen hat. Der Spielraum, um die Elemente Klang, Bild, Geruch, Geschmack, usw. aufeinander abzustimmen, ist relativ gross.
War es nicht ein Hauptmotiv des ganzen Wiener Aktionismus, die synästhetische Erfahrung gegenüber der Netzhautseeligkeit der bildenden Kunst aufzuwerten?
GASSNER: Das ist richtig. Hermann Nitsch war auch schon alt und wohl auch müde, als er die letzte Partitur schrieb. In meiner Aufgabe verstehe ich mich als Handwerker, der sein Theater werktreu umsetzt. Nitsch legte grossen Wert darauf, und das halte ich für wirklich wichtig, dass sein Theater von Dilettanten, also Liebhabern, realisiert wird. Er nannte sich selbst einen »Musikdilettanten«. Würden professionelle Schauspieler sein Spiel ausführen, würde das eine sehr komische, eine total cleane Sache werden.
»Wenn das Ganze wie ein Ballettabend
ablaufen soll, wird es eine blutleere Sache«
Aber die Akteure wären disziplinierter. Sie würden nicht im unpassenden Moment lachen, was schlecht zur Tragödie passt, aber immer wieder vorkommt.
GASSNER: Mit Profis würde einfach kein reales Ereignis stattfinden. In der Partitur ›Die Eroberung von Jerusalem‹ sind die unterirdischen Architekturanlagen nicht als Lebensraum angelegt, sondern damit dort Aktionen stattfinden. Es hat also einen guten Grund, warum das OM Theater »Spiel« heisst. Es steht im Zauberkreis des Spiels ausserhalb des Alltags. Genau das hat man Hermann Nitsch ja auch zum Vorwurf gemacht: dass er in das tatsächliche Leben der Leute eingreifen will. Wir erkennen heute, dass er diesen Anspruch mit dem Wiener Aktionismus teilt, und der ist leider auch bei der AAO-Kommune von Otto Muehl gelandet.

Wie passt der Eingriff in das reale Leben zu Nitschs Mitwirken an Operninszenierungen?
GASSNER: Ich war drei Mal als Assistent in Opernhäusern mit dabei. Wir standen dort der zwingenden Mechanik eines riesigen Theaterapparats gegenüber. Da kann man nicht einfach etwas machen, da müssen Dinge erst »in die Wege geleitet« werden, da müssen Listen abgearbeitet werden. In der konventionellen Struktur der Theaterhäuser hat man immer alles so und so gemacht, und will es jetzt wieder genauso so und nicht anders machen. Schon allein das Schütten von Flüssigkeiten auf der Bühne war ganz schwierig. Das Schütten macht Lärm, es plätschert, es stört die Musik. Bei Nitsch-Aktionen liegt der Reiz aber immer in der Frage, ob die Idee zu einer Form jetzt wirklich funktioniert. Wenn das Ganze mit strikten Zeitvorgaben wie an einem Ballettabend ablaufen soll, wird es eine blutleere Sache.
Sie plädieren also für einen strengen Realismus?
GASSNER: Wir sehen, dass einem Nackten wirklich kalt ist, einem anderen graust wirklich vor den Gedärmen. Soll denn ein Schauspieler so tun, als wäre ihm kalt? Soll einer tun, als ob es ihn graust? – Würde man das Sechstagespiel perfekt einstudieren, wäre es tot.
»Es sehe es als meine Aufgabe,
das OM Theater noch einmal
werktreu aufzuführen«
Nitsch wusste, dass Sigmund Freud die Vorstellung von Abreaktionshandlungen abgelehnt, weil er die Gefahr der Wiederholung von Neurosen hoch einschätzte. Nach der Theorie des OM Theaters soll die Neutralität des Spiels eine Absicherung gegen diese Gefahr gewährleisten. In der bewusst gemachte Form entkommen wir dem Wiederholungszwang. Mir stellt sich darum die Frage: Wieviel Zufall ist denn in dem Ablauf eingeplant?
GASSNER: Mehr als auf jeder Theaterbühne möglich wäre. Ich bin fast froh, dass die Zeit für Proben zu kurz ist. Meine Sorge war, das Ganze könnte zu glatt ablaufen. Mein Kollege Leo Kopp hat bis jetzt noch jedes Mal etwas Unvorhergesehenes eingeschoben, weil anwesende Personen auch noch mal schnell auf Kreuz wollten.
Hätte das Hermann Nitsch auch so gemacht?
GASSNER: Ja, sicher. Wir geben dem Zufall durchaus viel Raum. Dabei entstehen auch Situationen, die wir nicht gut finden. So sind etwa beim letzten Spiel um die Räucherschalen herum kleine Meditationsrunden entstanden, die nach Esoterik aussahen, was Nitsch ausdrücklich nicht wollte. Es ist ein schmaler Pfad. Oder wir hatten eine tolle Akteurin, die mit dem Kübel stramm wie ein Soldat dastand. Auch das begann komisch zu werden.

Welchen Gefahren drohen den Szenenbilder noch?
GASSNER: Lackierte Fingernägel, Schmuck, extravagante Frisuren, Sonnenbrillen. Wenn ein Träger betrunken ist und stolpert, haben wir ein Problem. Es gehört zu meiner Verantwortung, die richtigen Leute mit der richtigen Aufgabe zu betrauen. Nicht wenige Szenen bergen Unfallgefahr. Fast alle Akteure sind sehr vernünftige Leute. Dass vereinzelt auch Selbstverwirklicher dabei sind, die aus der Aktionskunst etwas Mysteriöses machen wollen, sehen wir zum Beispiel an Marina Abramović, die in den 1970er-Jahren bei einer Aktion mitgewirkt hat und nun Retreat-Seminare in Griechenland anbietet.
Hermann Nitsch zitiert in seiner Mythenarchäologie kultisches Handeln. Er hat sich dadurch vor genau dem Pseudo-Religösem, das Abramović in den letzten zehn Jahren um ihre Person herum geschäftstüchtig ausgebaut hat, wirksam geschützt.
GASSNER: Die Kunst von Nitsch wird heute auch gerne von Lebensberatern und Coaches aufgegriffen. Nach meiner Wahrnehmung behaupten sie Bezüge zwischen behavioristischen Theorien und dem Aktionsdrama. Ich baue da Distanz auf. Genau wie gegenüber dem Versuch, die Arbeit von Hermann Nitsch als moralische Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieg zu lesen.

Ist nicht die Einführung des Intensitätsbegriffs in die Philosophie der Kunst die zentrale Leistung von Nitsch? Ich halte das gradualistische Eingehen auf das Objekt für den Hauptgewinn. Der Gedanke der Intensität entzieht sich der Logik des Ausschlusses. Bis in das 18. Jahrhundert dachte man in den Naturwissenschaften, dass ein Objekt entweder da ist oder eben nicht da ist. Mit neuen Messverfahren von Licht, wurde die Empfindsamkeit zentral. Hermann Nitsch hat diesen Gedanken aufgegriffen und Innigkeit an die Wahrnehmung gebunden. Der Erwerb von Weisheit lässt sich bei ihm nur im Modus eines intensiven Erfahrungsreichtums denken.
GASSNER: Ich glaube, exzessiv zu Leben war in den 1960er-Jahren, als Nitsch seine Dramentheorie entwickelt hat, ein allgemeiner gesellschaftlicher Anspruch. Eine junge Generation befand sich damals im Aufbruch. Ihre Lust und ihr ganzer Enthusiamus ist in seine Arbeit eingeflossen. Nitsch hatte ein gutes Gespür für den Zeitgeist und er zögerte nicht, das, was gerade in der Luft lag, auch aufzugreifen. Unsere Zeit hinterfragt jetzt, ob das intensive Streben nach einer immer stärkeren Dosis, das unmittelbare Aufwallen der Gefühle, auf Dauer so weitergeht. Schliesslich kann sich ja niemand intensiv entspannen.
Nitsch bezog sich ausdrücklich auf den Dionysoskult, den einzigen Kult im alten Griechenland, dem es um die dynamische Entfaltung der Seelenkräfte ging. Aus den polaren Spannungen, die in den Kulthandlungen angesprochen wurden, dem Entgegen von Liebe und Hass, Krieg und Frieden, usw. ging dann die Tragödie als Gattung hervor.
GASSNER: Das theoretische Fundament des OM Theaters ist gut durchdacht. Aber es wird von heutigen Bedürfnissen scharf in Frage gestellt. Ist es wirklich so sinnvoll, permanent Hochleistungen zu vollbringen? Muss ständig alles maximal gross und stark gemacht werden? Das intensive Leben ist eben eine moderne Obsession.
Worauf freuen Sie sich in den Pflngsttagen 2025?
GASSNER: Darauf, liebe Leute wieder zu treffen, und darauf, bei der Realisierung eines grossen Kunstwerks zehn Tage lang gestaltend mitwirken zu können. Das Orgien Mysterien Theater ragt da herein in unsere Zeit.
Die Fragen stellte Wolfgang Koch © 2025