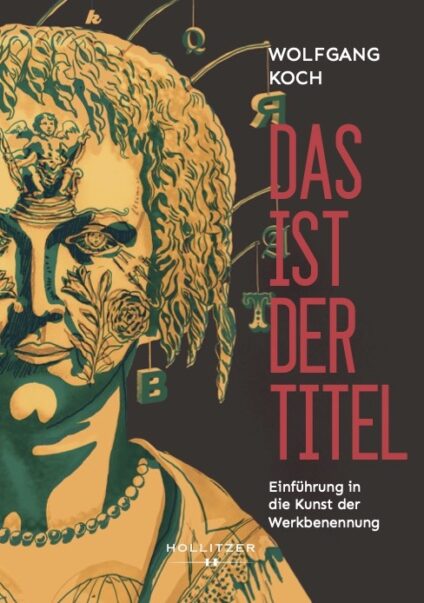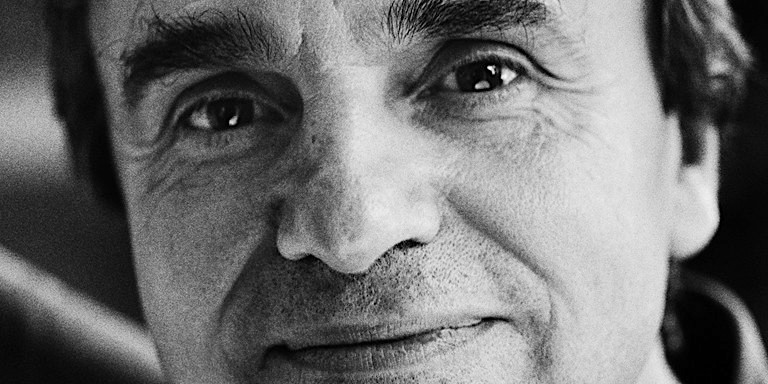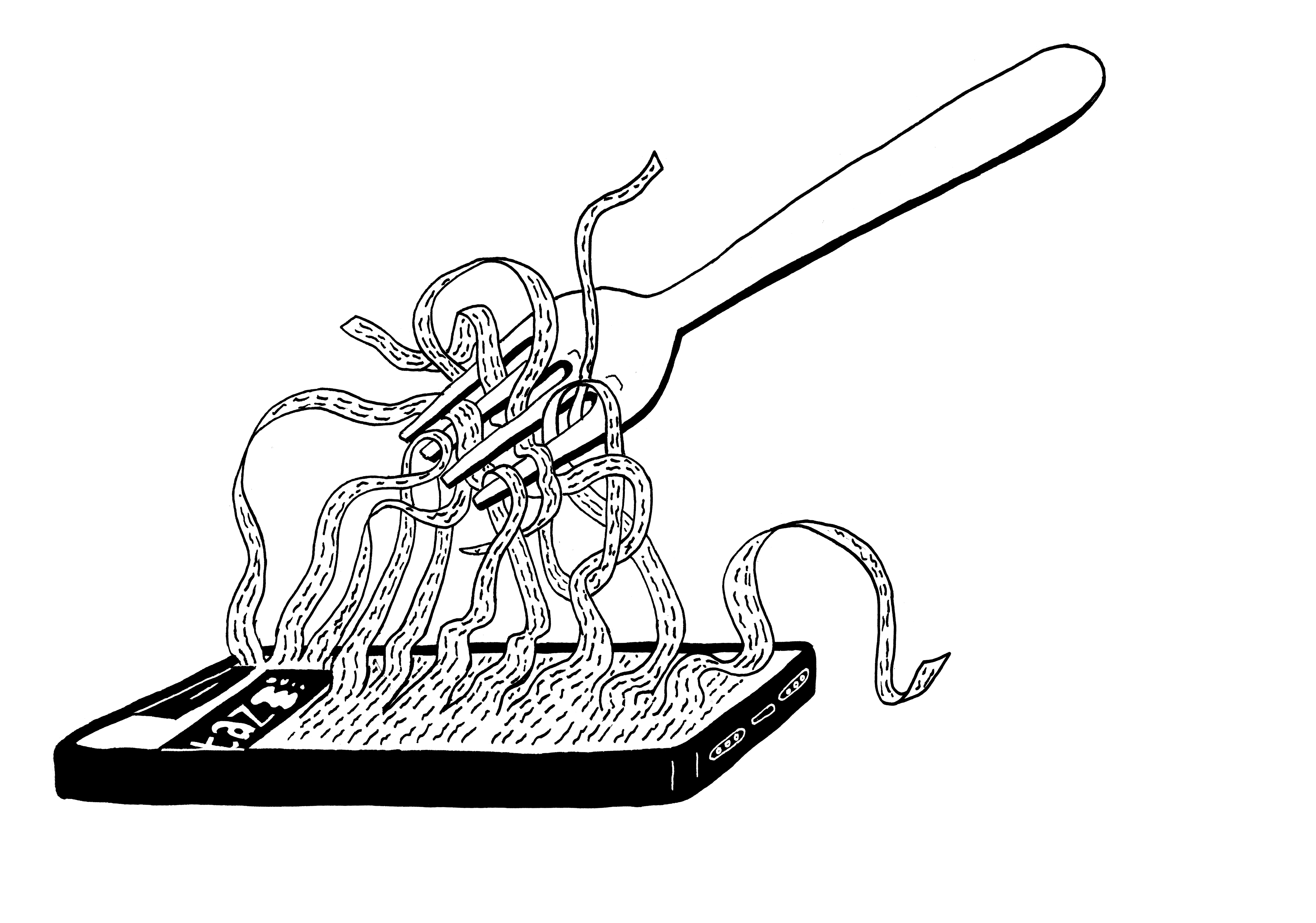Ich bin alles andere als ein Experte für Liebesromane, und möchte das auch bleiben. Wenn man dem Mysterium der Liebe vertraut, meine ich, der zufälligen Einmaligkeit der Emotion, bleibt ihr Sinn immer unversehrt; es gibt keine Wahrheit davon, die sich in Worte fassen liesse. Man kann von ihr überhaupt nicht sprechen, weil die gesamte eigenen Existenz davon betroffen ist.
Unter dieser Voraussetzung bin ich gezwungen, bei Autoritäten nachzufragen. – »Alle Romane, wo wahre Liebe vorkommt, sind Mährchen«, antwortet der Romantiker Novalis auf meine Frage in ›Das Allgemeine Brouillon‹ (1798/99), und das scheint perfekt auf Enrico Palandris italienischen Bestseller ›Boccalone‹ von 1979 zu passen. Die Liebe zwischen dem verwahrlosten Studierenden Enrico und der 16-jährigen Schülerin Anna versucht die Liebe in einer Sphäre langsam scheiterender Wunscherfüllung nachzuvollziehen.
»Wenn ich mich jemals für eine Arbeit
entscheiden muss, werde ich Bettler«
Dieses Märchen erlaubt mitträumendes Verweilen, einfühlendes Mitempfinden. Sofort nach dem Kennenlernen bedrängt das Paar das Gefühl, nichts anderes wahrnehmen zu können als die Wirkung der Welt auf sich. Die Tatbestände im Bologna von 1977: dunkle Ringe unter den Augen, Füsse ausgestreckt auf das Amaturenbrett, Nudeln mit Bohnen. Es gibt keine Mobiltelefone und man versendet noch Liebestelegramme, ach wie schön!
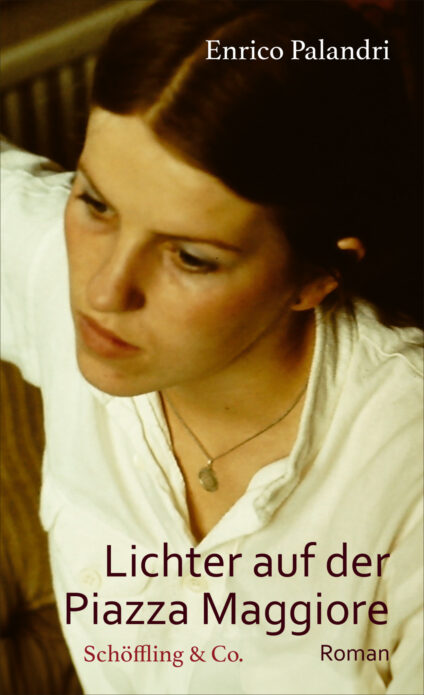
Cesare Pavese hielt die italienische Literatur (von Dante und Boccacio über Macchiavelli und Vico bis zu Leopardi) für »wenig erzählend«, und zwar ausgerechnet dort, wo es sie hätte sein müssen. Italiens grosse Texte seien »zerebral und argumentativ« und sie negierten den Naturalismus. So ist es auch hier.
Von Palandris Enrico wird zwar übersprudelnd ein Liebesgefühl behauptet, es gibt lange Küsse und »voll peinliche« Geständnisse nach dem Sex. Doch wir erfahren keine typische Geste, keine Gewohnheit, keine unverwechselbare Eigenart, nichts, was diese Frau für ihn begehrenswert macht. Nie entnehmen wir dem Dauergeschnatter Enricos zwei Liebende, die wechselseitig ineinander aufgehen oder in denen einer im anderen enthalten ist.
»Ich wünsche mir ein besseres Leben
und einen weniger komplizierten Kopf«
Das grösste technische Handicap des Romans dürfte dabei die Monoperspektive sein. Die Stimme des Ich-Erzähler bildet einen nervigen Dauerstrom. Das kann auch auch gar nicht anders sein, wenn man seine Selbstbeschreibung kennt:
»Ich bin eine Quasselstrippe und kann nur schwer für mich behalten, was mir durch den Kopf geht; mein Mund ist die Verlängerung meines Gehirns und die Erweiterung meines Denkens, besser gesagt: Mund und Gehirn sind bei mir nicht voneinander zu trennen. // Dabei bin ich nicht einmal besonders ehrlich, überhaupt nicht, ich spreche eben nur alles aus; die Lüge liegt in der Satzkonstruktion, nicht im Inhalt; mit einem Wort, ich sage niemals klar ja oder nein, sondern weiche immer aus; // aus Erfahrung weiss ich, dass meine Art zu reden anderen schnell auf die Nerven geht, genau wie meine Art zu leben. // ich habe ein loses Mundwerk, aus dem es ständig herausplätschert.«
Gefährlich schlecht drauf
Das stimmt bedauerlicherweise, und wird auf 209 Seiten atemlos durchgehalten. Der Quasselkopf hat ein loses Mundwerk, — die entscheidenden Dinge aber verrät er uns nicht. Entweder, weil er sie nicht wahrnimmt, oder weil er sich selbst einfach nicht zuhört. Der Charakter bleibt so flach, als besuchte A. Square die zweite Dimension in ›Flatland‹, um sofort wieder in die erste Dimension zurückzukehren. Wenn Palandris Held mit seiner Dulcinea Madrid besucht, schleckt er dort ein Eis und rennt in den Prado. Wenn er nach Florenz saust, erlebt dieser verkrachte Bildungsbürger was? O ja, »grossen Spass« in den Uffizien.
In der Talkurve der Beziehung ist Enrico-Boccalone dann meistens »schlecht drauf«, der Verlust der Beziehung ist »schlimm« für ihn – »mir geht es viel schlechter, als ich zugebe«. Diese sprachlichen Stanzen halten auch noch schiefe Bilder an der Wand, wie das der Hysterie, die in einem Kopf »heroisch ihre Kreise zieht«. – Nein, eine Hysterie zieht nicht »heroisch« Kreise; ihre Überreaktion, das lässt sich in jedem Medizin-Reader nachlesen, stört ichbegogen und geltungssüchtig den Bewegungsapparat, die Gefühle, die Sinne. Souverän und glänzend ist an der Hysterie überhaupt nichts.
Immerhin besitzt der Roman an anderen Stellen eine ausgelassene Heiterkeit, die darauf beruht, dass es keinen dramatischen Ausgang geben kann. Auch wenn die Liebe von Enrico und Anna scheitert, besteht sie über ihre Protagonisten hinaus doch weiter.
Vitale Proteste in Bologna
Die Liebe auf der Piazza Maggiore scheitert nicht, sie wird nur von ihren Figuren verlassen. ›Boccalone‹ referiert diese Botschaft, und hier kommen wir zum wichtigsten Punkt, vor dem Hintergrund der »antikapitalistische Wiederangeignung des Körpers, der Zeit und des Lebens«. Die Liebe spielt in der Zeitkulisse der autonomistischen Revolte, des Movimento ’77. Doch, was typisch war für diese lebendige und gefährliche Zeit – dass jeden Abend mehr als tausend Leute auf der Piazza herumstanden; dass sich die jungen Menschen als harter Kern eines Kollektivs verstanden (»ein Sicherheitsnetz aus besonderer Zuneigung«); dass politische Verhaltensweisen partout keine Theorie mehr haben sollten, die sie anleitet –, das alles erfahren wir nur im Vorbeigehen. Es wird vom Autor gestreift, aber nicht erzählt.
Das Zeitpanorama des Movimento del Settantasette gelang Lidia Ravera mit ihren Generationsgeschichten und Nanni Balestrini mit ›Gli invisibili‹ (Die Unsichtbaren) viel eindringlicher zu schildern als Palandri. In ›Ammazare il tempo‹, unter dem Titel ›Die Zeit totschlagen‹ in der Übersetzung bei Rowohlt erschienen, schildert Ravera die erhitzte Atmosphäre damaliger Vollversammlungen:
»Hinter dem Rednerpult stehen sie meistens zu dreissig, und den Vorsitz führen sie zu zehnt. Alle brüllen, niemand gewinnt. Dann erklimmt ein kleiner gedrungener fröhlicher Junge ohne Hemd und von undefinierbarer Farbe das Podium und lässt einen erbosten Bariton ertönen, lehnt mit bühnenreifer Geste das Mikrofon ab, was ihm anhaltenden Applaus einbringt, und beginnt, dem Publikum seine Bescheidenheit entgegenzudröhnen: er ist es nicht gewohnt auf Versammlungen zu reden, er ›scheisst wirklich drauf‹, er möchte, dass alles reden, auch die, die Angst haben, also redet jetzt auch er, und er hat Angst, und ›Genossen, klatscht nicht Beifall, sondern hört mal zu‹, als wäre die Forderung nach Aufmerksamkeit weniger eingebildet als der Beifall«.

In solchen grandiosen Passagen der Literatur ist das aufständische Milieu des Küchentischsenders Radio Alice, des Kollektivs Jacquerie, der Indiani metropolitani, des Maodadismus, der Graffiti, der Autoriduzione, der Kommunikationsguerilla, die den Minoritarismus schlagen wollte, in solchen Passagen ist der damalige Hass auf die Staatsmaschine, die Fabriksarbeit und die Herrschaftsmechanismen der Verwertung viel glaubwürdiger eingefangen als im Selbstmitleid von Palandis Quatschkopf.
Postmoderne Reflexionsorgie
In Staunen setzt Palandris Roman durch zwei Dinge. Er schildert die unerhörte Mobilität der aufständischen Genoss·innen. Die bewegten Emarginierten wechselte öfter Städte und Plätze als ihre Hemden. Nie ist bei Tageslicht schon klar, wer wo übernachten wird. Palandri erklärt uns allerdings nicht, ob dieses Sozialverhalten der »Zerstörung der sexuellen Rollen und der Institution Familie« oder einfach der Armut der einkommenslosen jungen Menschen geschuldet war.
Das zweite Plus des Romans ist der postmoderne Gestus, mit dem im Satzgestrüpp immer wieder das Verfassen des Textes selbst zur Sprache kommt. Das Erzähler-Ich muss allen erzählen, »dass ich an einer Geschichte schreibe«. Amüsiert werden wir Zeugen seines Durchatmens beim Schreiben. »Ich bin nicht exakt enrico palandri und will es auch nicht sein … ich bin ein ein wandelndes Psychodrama …«
Nett, wieder mal sowas zu lesen! Wir erinnern uns aber auch, zu welch drögen Diskursflächen diese selbstreflexive Prosa geführt hat, bevor Autor·innen des Millenniums es wieder wagten, Geschichten mit Hand und Fuss zu erzählen.
Vier Jahrzehnte später
Die Lektüre des Liebesromans über die rhizomatische Linke wirft auch ein Licht auf Enrico Palandri als Ganzes. Denn am Bologna-Roman sehen wir, dass sein Erfinder durch die Jahrzehnte hindurch dem Thema des Schreibens im Schreiben treu geblieben ist. In der Gegenwart nimmt er jedoch viel stärker die Perspektive der Lesenden ein.
In seinem letzten publizierten Buch, dem vor zwei Jahren veröffentlichten Alterswerk ›Sette finestre‹ (Sieben Fenster), ruft Palandri die berühmten Schriftstellerkollegen John Milton, John Keats, Leopardi, Proust sowie die Heiligen Bücher der Religionen zu Zeugen seiner Erfahrungen auf. Das möchte man nun natürlich genauer wissen. Was hat sich denn seit den psychomotorischen Schwierigkeiten und der politischen Niederlage der Autonomia Organizzata so radikal geändert?
Palandi warnt heute vor der Gefahr, in den Asozialen Medien zu viel über uns selbst zu erzählen und ein Idealbild der eigenen Person zu vermitteln. Die wichtigen Dinge des Lebens, sagt er, bewohnen uns tiefer als wir uns vorstellen. Sie sind schon da, tatsächlich existent, bevor wir von ihnen wissen. Ihre Handlungen umhüllen uns, bevor sie sich entfalten und uns in die Welt hinein stossen. (Warum denke ich da an ein angeborenes Ensemble von Sehnsüchten und Bedürfnissen in den Gestalten von Vater und Mutter?)
Lag für Enrico Palandri, als er sich mit Enrico-Bottalone in einem Kollektiv vereint sah (»das Kollektiv ist kein Projekt mehr, es ist Teil meiner Träume«), die »eigentliche Crux am alleine Schreiben darin, dass man auf eine Stimme beschränkt ist«, so hinterfragt er nun, vier Jahrzehnte später, luzide den Status der literarischen Charaktere und unseren Status als Zuschauer-Leser des Lebens anderer. Palandri sagt heute: Alle Erzählungen (sei es Familie, Ideologie, Überzeugung, Mode, Identität, Vergangenheit) produzieren irgendwann das Bedürfnis, sie auch wieder loszuwerden. Dies sei dann die Stunde der Kritik. Kritik helfe, die richtige Auswahl mit der Delate-Taste zu treffen.
Enrico-Bottalone tickte da noch komplett anders. Der liebende Revoluzzzer hielt Kritik für »eine sozialdemokratische Angewohnheit, ein Thema wird im Kopf gedreht und gewendet, herumgetragen und weitergegeben, damit der Nächste es eine Viertelstunde lang begutachten kann, so dass er recht zu haben scheint, und nach einer Weile versteht keiner mehr irgendwas«.
Sonnenhell dagegen der aktuelle Palandri. Das Wichtigste für den Menschen der Gegenwart, sagt er, sei die Fähigkeit, sich im Unbestimmten bewegen zu können. (Warum denke ich da sofort an ein Surfbrett?) In der Stille, im Schatten würden die Mythen der Vergangenheit weiterleben. Palandri sieht keinen Grund, die Erinnerungsreste an die grossen Aufbrüche der Menschheitsgeschichte zu liquidieren. Es existiere immer »eine Andersartigkeit, die sich nicht auf das Gewöhnliche reduzieren lässt«. Selbst die Heiligen Texte würden in den grossen Kontext von Erzählungen gehören, die subjektale Deutungen anstossen. Tanach … Bibel … Guru Granth Sahib – sie alle trösten uns mit dem Versprechen, dass der Ärger morgen nicht so weiter geht, wie er heute begonnen hat, und dass das Böse nicht ewig triumphiert.
© Wolfgang Koch 2025
Enrico Palandri, Lichter auf der Piazza Maggiore, Übersetzung: Esther Hansen, 220 Seiten, Frankfurt: Schöffling Verlag 2024, ISBN 978 3 89561 154 4, 24,- EUR