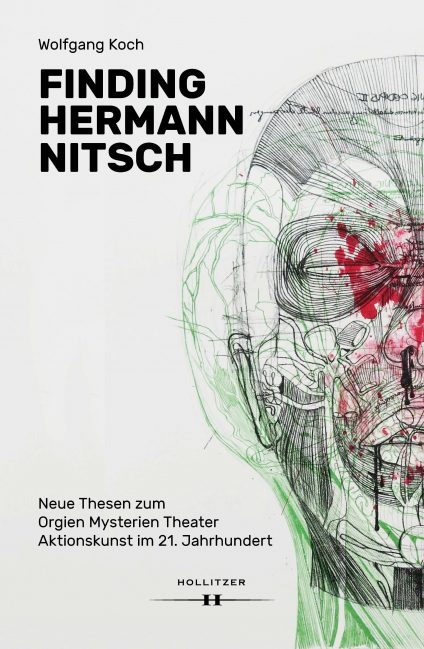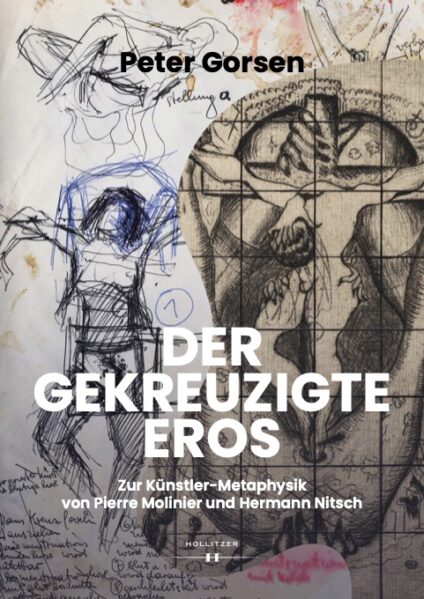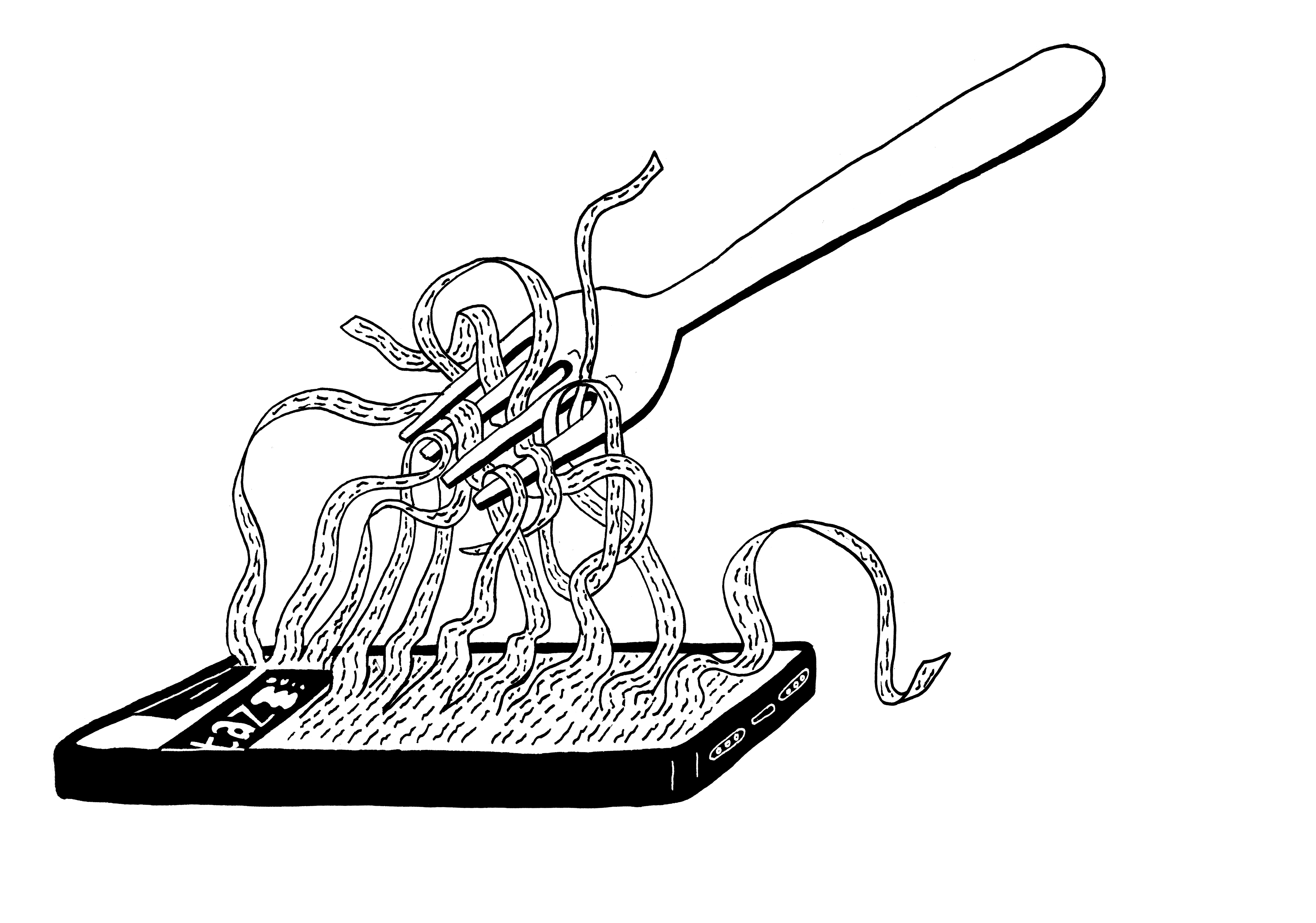Kunst stellt die Frage, was behauptet werden kann; Lösungen stehen dabei selten an. Bei dem vor drei Jahren verstorbenen österreichischen Existenz-Abenteurer Hermann Nitsch sieht das deutlich anders aus. Er bot dem Publikum weit mehr, als die günstige Gelegenheit, erlesenen Geschmack zu beweisen.
Hermann Nitsch sah ab dem Alter von 19 Jahren in der Kunst eine Möglichkeit, sich einem Absolutum zu nähern, ohne es freilich je festhalten zu können. Er verband sein jahrzehntelanges ästhetisches Schaffen als Maler, Grafiker, Theatermacher und Komponist mit dem Anspruch, aus der Gestaltung der Form Selbsterfahrung und Selbsterlebnis zu ziehen. Das Leben sollte in der Performance selbstwirksam werden. Malerisch und grafisch zu arbeiten sah er als Übungs- und Planungsfeld für reales Geschehen.
Diese künstlerische Position traf sich nur punktuell und zeitlich begrenzt mit der Haltung der konkurrierenden Wiener Aktionisten. Nitsch verteidigte vor der »spürbaren Unzulänglichkeit der Empfindungsarbeit« (Reinhard Priessnitz) konsequent eine Wahrnehmungstheorie, mit deren Hilfe er Wortdichtung, abstrakten Expressionismus und Darstellungstheater weit hinter sich liess.

»hermannnitsch«, wie der Universalkünstler 1960 seinen Namen unter das Manifest ›die existenzsakrale malerei‹ (für die Ausstellung im Wiener Loyalty Club) setzte, teilt heute in Österreich mit Gustav Klimt den ehrenvollen Titel »Halbjahrhundertkünstler«. Ausstellungsredner weisen gerne auf die Ebenbürtigkeit dieser beiden herausragenden Erscheinungen der Kunstwelt hin. Aber nur selten geben sie an, worin sich nun die Grösse des einen mit der Grösse des anderen trifft.
Beide Künstler, Klimt und Nitsch, wirkten zunächst am Spielfeldrand des Kulturbetriebs, durchliefen sämtliche Stadien der Kellerbohème, beide verwarfen auf der Leinwand bildimmante Gesetzlichkeiten, beide scheuten nicht vor den Möglichkeiten von Figuration und dekorativer Expression zurück, beide liebten ernste Feierlichkeit, beide schufen zerschmetternde, aufwühlende Meisterwerke, der eine folgte dem malerischen Gebot der Goldfarbe, der andere der Magie von Blutrot, beide förderten selbstlos Talente von Jüngeren, beide liebten schlanke Modelle von klassisch-griechischer Statur und beide Männer vergassen nie die Hochachtung vor dem Handwerk.
Widerstand gegen die Zeit
Im Alter von 14 Jahren sah Hermann Nitsch in der Selbstverwirklichung der Person die »Selbstwerdung Gottes«. Damit hatte er die eigenen Erlöserqualitäten entdeckt (was ihm späterhin weder die Kirche noch die Linke nachsehen wollte). Das Thema des Künstlertums als Priesterschaft, von dem bereits Klimt geträumt hatte, stand erneut im Raum. Die Nachkriegsmoderne zog den Malerkittel des Jugendstils über. Und dass Nitsch den Klassikern (Eckhart, Nietzsche, Freud, Jung, Heidegger, Artaud) mehr verdankte als seinen Zeitgenossen (Foucault, Derrida, Flusser, Sontag, Butler), hat ihm ermöglicht, der Zeit zu widerstehen.
Von welcher Zeit sprechen wir? Hermann Nitsch kam aus einer Vorstellungswelt der 1950er-Jahre, die kein »sowohl / als auch« kannte. Allein mit der Formelhaftigkeit des Gegensatzes, mit dem »entweder / oder« schien das Lebensgefühl der Wiederaufbaugeneration vereinbar: Ost oder West, Kapitalismus oder Kommunismus, Mann oder Frau, Abstraktion oder Figuration, Geist oder Körper. Die Verteilung von Wohlstandsgewinnen basierte bis in die 1970er-Jahre auf einer Kultur der sozialen Hoffnung. Der tief verwurzelte Glauben an den intergenerativen Fortschritt, der in den Weltkriegen zerbrochen war, war zumindest im Westen wiedererlangt.

Es ist immer wieder faszinierend zu lesen, wie Nitsch gegen die harten Begriffsdualismen seiner Epoche ankämpfe. Europa ist ja bekanntlich ganz vernarrt in die antithetisch-normativen Dualstruktur. Wir lieben es, in Gegensätzen zu denken und aus polarisierten Ideen dialektische Dreischritte zu bauen.
Nitsch verwarf nicht nur asymmetrische Gegenbegriffe wie »Hellenen / Barbaren«, »Christen / Heiden«, »Inländer / Ausländer« oder »Kunst / Kitsch«, in denen eine Seite der Unterscheidung positiv-identitär besetzt ist, wohingegen die andere Seite als nicht anerkennungswürdig abgewertet wird.
Nitsch fegte auch symmetrische Begriffspaare wie »Inhalt / Form« oder »Geist / Fleisch« vom Schreibtisch, bevor sie ihn ins Atelier begleiten konnten. Der assoziative Reichtum des Werkes, also sein symbolischer, pychologischer und philosophischer Inhalt, waren seiner Ansicht nach als fester Bestandteil in der Form eingeschlossen. »Philosophie und Kunst haben sich in der Form untrennbar miteinander vermählt«, erklärte Nitsch.
Dieses Empfinden tat den Mann weit auf für den grossen Gottesdienst des Seins. In einen Rotfilter getauchte rote Rosenblüten – das zeigt die Coverabbildung von Nitschs wichtiger Maerzverlag-Publikation (1969), und in dieses gerötete Rot, beinahe unmöglich für das Auge, gebettet die 22 weissen Buchstaben der Worte »ORGIEN MYSTERIEN THEATER«.
In seiner 1982 formulierte Mythentheorie verwarf Nitsch dann auch die mit einer Vielzahl von Bedeutungen belasteten Begriffe »Fleisch« und »Geist«. »Für mich gibt es nur Intensität offenbarendes Seins«, lehrte der neuer Gestalter der Suprematie (der Vorherrschaft der reinen Empfindung) seinen Schülern in Frankfurt. Synästhesie war ihm alles: die gegenseitige Beeinflussung von Geruch und Blick, physisch erlebbare Töne, durchscheinende Mehrstimmigkeit, mit heftiger Erregung verbundene Körperlichkeit.

/ Foto: Atelier Nitsch (eSeL) 2025
Um es noch deutlicher zu sagen: Hermann Nitsch verlangte die Feierlichkeit der unendlichen Erregung zu spüren, die Feierlichkeit des Weltalls. Er zeichnete, malte und komponierte den Schlag, den man in seiner Existenz empfindet. Und je älter der Künstler wurde, je üppiger er seinen Vollbart wuchern liess,
desto gleichgültiger wurde er gegen die Ablehnung seiner Arbeit,
desto knabenhafter begleitete ihn das Licht.
Überwindung von Schwarz und Weiss
Sind denn Weltenteile etwas anderes als Teile dieser Welt? Nein, das sind sie nicht. Darum konnte Nitsch Blumenblüten und Zuckerstücke neben Mullbinden und totem Fisch arrangieren, er konnte leidenschaftlich nach der Poësie von immer neuen Konstellationen seiner Materialien suchen, er konnte selbst Anstössiges und Verbitterendes kompositorisch vereinfachen.
Noch 1995 sprach er von der »Enthaltung subjektiver Freiheit«, das heisst davon, dass Objektsein zu überwinden und zum »absoluten Subjekt zu gelangen«. Es ging ihm also nicht nur um sich, seinen Genuss und sein Seelenheil. Die vielen Anekdoten vom Genussmenschen Nitsch, dem überdimensionalen Heurigenwirt, dem Schlemmermaul mögen unterhaltsam sein, sie werden der kulturellen Dimension seines Unternehmens sicher nicht gerecht.
Nitsch hatte das Schwarz-Weiss-Gewitter des Kalten Krieges schadlos überstanden. Statt Vernünfteleien und kommunikativer Rationalität liebte er zirkuläre Schlüsse, über die man auch lachen kann (Gott hat die Natur, die Natur den Menschen und der Mensch hat Gott erschaffen). Nitschs Welt war schön, Nitschs Welt war gut. Sie gab hellen Sinn, auch dort, wo sie aus um sich greifender, abstrakter Angst vor Grausamkeiten erst eine bearbeitbare Furcht machen musste.

Nitsch hat sich mit über 3.000 Seiten Theatertheorie weit aus dem Fenster namens Avantgarde gelehnt. Er schrieb so komische Sätze wie: »Kot der Gedärme und Eiweiss des Gehirns bedingen einander«. Alles sorgfältig in Kleinschrift natürlich. Nitsch wusste, dass das wahre Staunen aus Gedächtnis besteht und nicht einfach darin, dass etwas auftaucht. Die Situation der griechischen Tragödie ist: Was sein muss, sei.
Angenommen das Leben setzt sich nach dem Tod durch Wiederholung kontinuierlich fort (was wir nicht wissen, sondern nur glauben können), wäre der kleine Hermann aus Wien-Floridsdorf im nächsten Leben nun schon wieder drei Jahre alt. Der Vater zieht in den verbrecherischen Krieg im Osten und kehrt nicht mehr heim, weder tot noch lebendig. Was vom Vater zurückkommt, ist die blutverschmierte Lederbrieftasche. Ich habe mit Nitsch immer wieder über diesen später verloren gegangenen Fetisch gesprochen. Seine Schlampigkeit der Verwahrung ärgerte ihn masslos.
Verschobener Wahrnehmungsfilter
Aber was geschehen ist, ist geschehen. Der Tod des Vaters: geschehen. Das traurige Verschwinden des herzlichen Familienandenkens: geschehen. Wer Nitsch-Arbeiten kennt, wird an sich bemerken, wie sie seine Wahrnehmungsfilter verschieben oder erweitern, um ein paar Grade nach links oder rechts rücken, zur Wärme des Objekts hin oder in die Kälte des Weltraums hinaus. Hier hat man das Gefühl, dass sich die Dinge auf ihrer Reise durch Zeit und Raum unweigerlich verändern und vermischen; und dass, falls wir nicht an der Vergangenheit festhalten können, der Versuch, dies zu tun, dazu führen kann, dass etwas Unerwartetes und Neues entsteht.
In der Natur lauschte Nitsch auf die Abwesenheit der Menschen; Neues wollte er nur noch unter der Erde gebaut sehen; seine Farben rannen auf Flächen nahe an der Stille. Dann aber fasste er plötzlich ein Kantholz oder Lineal und clusterte auf der Orgel drauflos, dass es eine Lust war bis in die Kastanienallee des Schlossparks hinunter, chromatische Tontrauben auf die Wiesen und Weiden hinaus, über die Hügel weit bis zum Horizont.

Unsere Angst vor Grausamkeit, die ist universal. Täter und Opfer warten nur darauf, die Plätze zu tauschen. Und Nitsch sah in der Kunst eine Möglichkeit, mit der Erfahrung dieser Enttäuschung umzugehen. Er wusste, dass die schönsten Leidenswerke (Tragödien) in der Freude geschrieben sind. Denn der Künstler ist einer, der leidet, indem er nicht leidet, wie Henry de Montherlant sagt.
Nitschs Lebenswerk war ein Totaltheater in der Formensprache des griechischen Dramas, der antiken und der mittelalterlichen Mysterienspiele, von Anti-Kunst, Fluxus und Happening. Das performative Megafestin in dem die ganze Anstrengung kulminiert, leistet keinen Beitrag zur Elitenherrschaft, es nimmt nicht Anteil an der liberalen Weltvergesellschaftung, der Undurchsichtigkeit der Politik und den betreuten Meinungen. Hermann Nitsch fühlte, dass er war, und er fühlte, dass sein Sein nur ein Abglanz war der beseligten Welt in ihm.
Dieser Künstler versuchte wie wenige andere das Unaussprechliche zu kommunizieren. Und da er die Worte, die er dafür suchte, nicht fand, sandte er ein Gefühl, ein Absicht, durch Gesten, durch Lärmklang, durch entkleidete Körper, durch die Fantasie von begattetem Schaf-Fleisch, durch die Fantasie von Rorschach-Protokollen und Blutpumpwerken.
Von hier war es nur mehr ein gedanklicher Schritt, den Eigenwert gegen den Symbolwert in der projektiven Selbstauslegung des menschlichen Daseins zu setzen. Nitsch verstand die Naturmythologie radikal subjektiv. Bilder und Szenen in der umgebenden Natur waren für ihn ein Niederschlag von Jahrtausenden evolutionärer Erfahrung der menschlichen Gattung. Sie stellen ein Inbildes des Kosmos dar.
Er blieb das grosse Kind
1969 fühlte sich Nitsch in seinem Münchner Exil als »heimatloser Fremdling«, und er ist – bei aller Liebe zu den Kellergassen des Weinviertels, zu den Menschen in der Provinz und zum Himmel über Neapel –, immer und überall dieser Fremdling geblieben.
Zeremonienmeister des nicht additiven Gesamtkunstwerks,
Maler des psychischen Automatismus,
Sammler der Geräusche der Nacht.
Das grosse Kind, an dem er zeitlebens festhielt, fragte: »Wie können wir erblühen unter der Last von soviel Licht? Wie können wir uns erneuern im verloren gegangenen Schauen, das die zu beschauenden Objekte vollsinnlich wahrnimmt?«
Nitsch befand, dass er nur auf einer Art Durchfahrt sei, er schätzte das Vergängliche. Liebend berührte er, was von den Göttern geblieben war: Zeichen, Rituale, leere Kirchen.
War dieser Künstler denn überhaupt ein Maler? Die Antwort kann die Frage verneinen, ohne eine künstlerische Leistung zu schmälern. Denn jede Figurengruppe, die Nitsch in seinem OM Theater hinstellte, war die eigentliche Erfahrung des Malens des Bildes. Sie illustriert nicht. Jedes Tableau ist das Gefühl seiner eigenen Verwirklichung. Es ist eher so, als hätte Nitsch lieber eine Erfahrung gemacht, in Echtzeit gefühlt und gelebt, als ein Bild herzustellen.
Auch über seine Umgebung hatte er manches anzumerken: Das Beste im eigenen Land schmeckt nach Wein, dem »Begeisterungstrank der dynamischen Weltschau«. Das Schönste im Land glänzt wie wundes Fleisch, es riecht wie Opiumschlaf und duftet wie die Kräuternamen. Das Klügste im Land, auch das wusste er als gelernter Österreicher, ist musikalisch.
Keine Ehrfurcht vor der Menge
Doch komplett anders als seine Landleute vertrug Nitsch nur die grosse tragische Klage (der Griechen, Wagners), nicht aber das kleinliche, masseninformierte und massengelenkte Lamentieren, das einem in der Alpenrepublik an jedem Tisch entgegen brandet. Nitsch schlug, um sich vor der Öffentlichkeit zu schützen, nie den Ton des Mitleids an, er heuchelte nicht Ehrfurcht vor der Menge.
Sagen wir so: Nitsch war ein ernsthafter Künstler, der aus voller Brust lachen konnte. Er lehrte, dass wir von unserer Stimmigkeit gerade so viel verstehen, wie wir von uns als Menschen verstanden haben. Jenseits des umfassenden Blicks, der knabengöttlichen Wahrheit, um die es ihm ging, wäre die Welt nicht nur neutral in ihrer Schönheit, sondern würde einem ewig zögerndem Aggregat ähneln.
Im Hier und Jetzt das Numinose erfahren …
Ergriffensein vom Ganzen …
Das genügt.
© Wolfgang Koch 2025