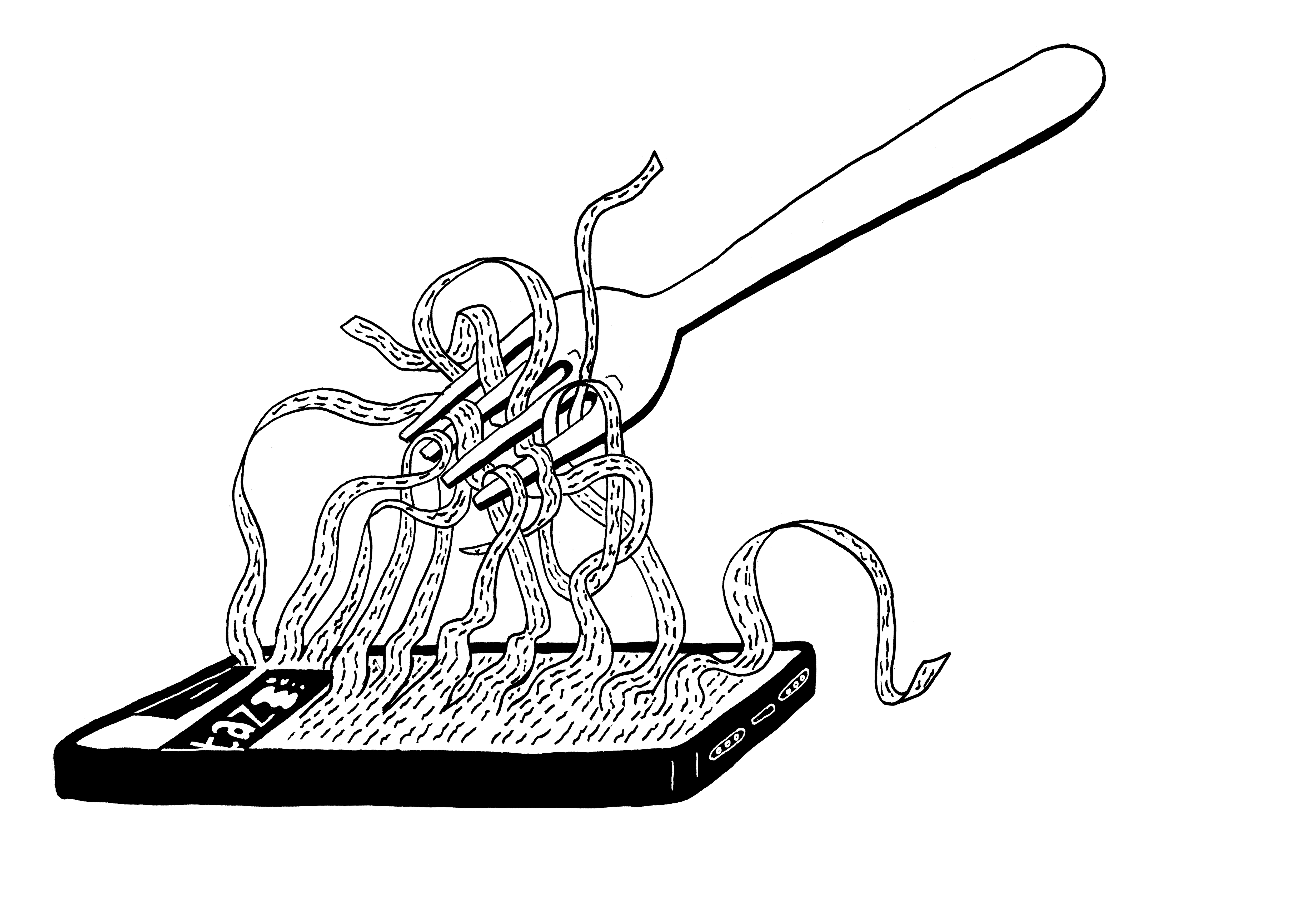Taz-Lab 2025 im Live-Stream. Der Titel »weiter machen – Jenseits der Empörung« spricht mich sehr an. Zur Begrüßung erläutert Programmchef Joel Schmidt, dass es in Zeiten von »Krieg, Disruption und dem Aufstieg der extrem Rechten« darum geht, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Ich glaube, in Anbetracht der Nachrichtenlage ist es gerade jetzt wichtiger denn je, weiter zu machen.
»Lohnt sich Klimaaktivismus noch?« – Zwei Klimaaktivist:innen im Gespräch
Rote Bühne, 9h – 10h: Tadzio Müller bemerkt eine außerordentlich hohe Ignoranz und Verrohung der privilegierten westlichen Gesellschaften im Umgang mit dem Klimawandel. In den USA sei zu beobachten, wie man um die eigenen Privilegien kämpft und sich abzuschotten versucht. +++ Unsere deutsche Gesellschaft sei ein »moralischer Sauhaufen«, eine »fossil-kapitalistische, spätimperiale Beutegemeinschaft«. Wir würden »über unsere Verhältnisse leben« bzw. »über die Verhältnisse anderer«. +++ Originelle Metapher: Es gebe einen Beziehungskonflikt zwischen »der Klimabewegung« und »der Gesellschaft«, wobei Tadzio Müller letztere mit einem toxischen Mann vergleicht: Zehn Mal höre »die Gesellschaft« aufmerksam zu, wenn man ihr Defizite vorhält. Zehn Mal reagiere sie ungehalten und möchte nicht an ihre Versprechen erinnert werden. Und ab dem 21. Mal werde sie aggressiv und schlage im schlimmsten Fall sogar zu. Klimaaktivismus dürfe sich an »der Gesellschaft« nicht wie ein »abused partner« abarbeiten. Carla Hinrichs fragt zurecht: »Wer ist ›die Gesellschaft?‹« Die »abused partner«-Metapher ist zwar literarisch brilliant und nicht ganz falsch, überzeugt mich aber nicht. +++ Carla Hinrichs hat die »Neue Generation« gegründet, das ist die Nachfolgeorganisaton der »Letzten Generation«. +++ Sie steht vor Gericht, die Anklage lautet auf »Bildung einer teroristischen Vereinigung«. Es wird deutlich, wie belastend so ein Prozess ist. +++ Sie betont ihr positives Menschenbild, möchte aus der Zivilgesellschaft heraus Veränderungen anstoßen und wirbt für einen »Gesellschaftsrat«. +++ Auch sie kritisiert unsere Lebensweise mit einer Metapher: »Wir leben in einem Kartenhaus«. +++ Sie vertraut beim Kampf gegen den Klimawandel auf einen großen demokratischen Aufstand, der von einigen wenigen vorbereitet wird, und verbreitet Zuversicht. – Applaus!
Wie schaffen wir das, Frau Neubauer? – Eine Stunde Intervention
Rote Bühne, 10-11h. Luisa Neubauer rät dazu, nicht über Dinge überrascht zu sein, die nicht überraschend sind: Tech-Milliardäre sind nicht die stabilsten Demokraten … Diejenigen, die vor vier Jahren bayerische Bäume umarmt haben, haben es doch nicht so gemeint … Friedrich Merz ist das Klima gar nicht so wichtig … +++ Es sei eine Strategie, die Öffentlichkeit durch täglich neue Schlagzeilen und »neue kleine Feuer« auf Trab zu halten und die Opposition zu entmutigen. Wir dürfen nicht hinterher hecheln. +++ Wir sollten stattdessen einen Schritt zurücktreten und anerkennen, dass die Rechtsextremen gerade erst angefangen haben. Es sei unsere Pflicht zu antizipieren, was da wohl noch kommt, und uns darauf vorzubereiten. Das sei in den USA nicht geschehen. +++ Sie warnt davor, sich in den Zynismus zu verabschieden. +++ Sie erläutert Bernd Ulrichs Begriff der »Nebenfolgenwelt«: Dinge, die wir lange nicht wahrhaben wollten, fallen uns auf die Füße, beispielsweise die gefährliche Abhängigkeit von russischem Gas. +++ Klimapolitik müsse in Verbindung mit der Markt- und Medienmacht rechtsdrehender Konzerne, mit Rechtspopulismus und mit fossiler Propaganda gedacht werden. +++ Klimapolitik sei heutzutage ein Kampf um die Wahrheit. Wissenschaftliche Erkenntnisse gäben in der politischen Willens- und Urteilsbildung nicht zwangsläufig den Ausschlag. Informationen verlieren ihr Gewohnheitsrecht auf Akzeptanz, da Fakten so viel wert seien wie Meinungen. +++ Sie mahnt, keine falschen Konsequenzen aus dem Heizungsgesetz zu ziehen, etwa im Sinne von: »Wir haben zu viel gewollt.« +++ Die Geschichte des Heizungsgesetzes sollte korrekt erzählt werden: Ein Gesetzentwurf wurde an die Springer-Presse durchgestochen. Es gab keine Auseinandersetzung in der Sache, stattdessen wurde populistisch gehetzt. +++ Wolfgang Kubicki habe selbst eine Wärmepumpe im Keller. +++ Besonders die Beschreibung des Klima-Diskurses als »Kampf um Wahrheit« hallt bei mir nach.
Heimspiel für Habeck
Rote Bühne, 11-12h. Die Petition, sich nicht aus der Politik zurückzuziehen, habe Robert Habeck dazu bewogen, sein Bundestagsmandat anzunehmen, sonst säße er nicht auf der taz-Bühne. +++ Er überlegt, ob Friedrich Merz mit ehrlichen Aussagen zur Finanzpolitik ein schlechteres Ergebnis als 28,5 Prozent geholt hätte. Dann schiebt er eine kluge Frage nach: Würde Merz, wenn er die Wahrheit gesagt hätte, jetzt auch bei 24,5 Prozent stehen? +++ Habeck beschreibt seine Politik der ausgestreckten Hand, die allerdings nur funktioniere, wenn die andere Seite darauf eingehe und einem nicht »in die Fresse schlägt«. +++ Man müsse in Ruhe über die Machtoption der liberalen Demokratie in Deutschland nachdenken, zumal viele prominente Unionspolitiker Schwarz/Grün ausgeschlossen haben. +++ Habeck zitiert Merz‘ legendären Satz: »Das Richtige wird nicht falsch, wenn die falschen Leute zustimmen« und lässt ein gewisses Verständnis dafür erkennen, dass junge Wähler:innen sich bei der Bundestagswahl der Linkspartei zugewendet haben. +++ Habeck weist auf vier Mordanschläge vor der Wahl hin, die das Momentum verschoben hätten. Auch vor den Europawahlen und den ostdeutschen Landtagswahlen habe es jeweils einen Anschlag gegeben. +++ Habeck warnt eindringlich vor den rechtsautoritären Kräften, die sehr zielstrebig ihren »Matchplan« verfolgen und nicht nach den Regeln spielen. +++ Er beobachtet eine Waffenungleichheit: Es gewinnt nicht der »zwanglose Zwang des besseren Arguments« (Habermas). Der rational-aufklärerische Diskurs scheitert, sobald aggressiv-zerstörerische Kräfte auf den Plan treten, die die Interessen und Bedürfnisse anderer nicht achten, sondern Freude daran haben, gewaltsam alles plattzuwalzen, getreu dem Motto: »Wenn wir an der Macht sind, dann werden wir nicht mehr abgewählt, dann werden wir auch nicht mehr belangt.« +++ Eine bemerkenswerte These zum Scheitern der Ampel: Wenn Scholz Lindner nicht zum Finanzminister ernannt hätte, dann hätte die Regierung und das gesamte Bündnis wahrscheinlich überlebt. +++ Habeck unterscheidet drei Typen von politischer Kommunikation: Das »Wohlfühl-Modell« (Merkel) erspart der Bevölkerung Zumutungen. Das »Andere-Beschuldigen-Modell« (Söder) beruht auf der Annahme, dass immer die anderen schuld sind. Habeck verfolgt das »Ernsthaft-Sprechen-Modell«: Politik wird als »lernendes System« aufgefasst, das Fortschritt organisiert. Habeck bezweifelt, ob die Gelingens-Voraussetzungen für das dritte Modell noch gegeben sind. +++ Der Gedanke überzeugt, dass Politik zum Funktionieren einen gewissen Rahmen benötigt. Dass der reflektierte Regierungspolitiker Habeck die Existenz dieses Rahmens anzweifelt, stimmt mich nachdenklich.
»Wie weiter mit Russland?«: Ulrike Herrmann und Nicole Deitelhoff im Gespräch
Studio Rosa, 12-13h. Nicole Deitelhoff: Donald Trumps »Friedensplan« verdiene diesen Namen nicht, da er weitgehend russischen Interessen entspreche und Putins militärischen Expansionsdrang belohne. +++ Die USA drohen mit Rückzug aus dem Konflikt, wenn das »Friedensangebot« nicht angenommen wird. +++ Die USA scheinen nicht die Rolle einer Garantiemacht übernehmen zu wollen, die kraft ihrer militärischen Stärke den Frieden sichert. +++ Angebot der USA: Das Rohstoffabkommen und die Anwesenheit US-amerikanischer Firmen in der Ukraine stellen eine Art symbolischen Schutz dar. Deitelhoff stellt die Wirksamkeit dieses Schutzschirms jedoch infrage. +++ Sie unterscheidet zwei Szenarien: A: Die USA ziehen sich zurück, aber überlassen Europa das Feld. B: Die USA ziehen sich zurück und erwarten von Europa, sich ebenfalls zurückzuziehen. Falls diese Erwartung nicht erfüllt wird, drohen die USA, Europa den Rücken zuzuwenden. +++ Ulrike Hermann: Europa könne sich eigentlich nicht aus der Ukraine zurückziehen, denn die Folge wäre eine Fluchtbewegung weiter Teile der erwerbstätigen ukrainischen Bevölkerung in Richtung Westen. +++ Die Finanzierung eines Aufwuchses der europäischen Ukraine-Hilfe sei nur durch Euro-Bonds finanzierbar (die allerdings anders genannt werden). +++ Südliche europäische Länder wie Spanien und Portugal könnten für eine gesamteuropäische Ukraine-Hilfe gewonnen werden, indem dort Rüstungsindustrie angesiedelt werde. +++ Nicole Deitelhoff hofft auf politische Durchbrüche auf europäischer Ebene aufgrund des hohen »Krisendrucks«. »Gemeinsame Beschlüsse mit Verteilungswirkung« seien allerdings sehr schwer zu erreichen. Problematisch ist, dass jederzeit eine Abkehr der USA drohe. Die EU benötige jedoch Zeit. +++ Diese schwache militärische Position der EU erklärt die defensive Strategie der EU im Zollstreit. +++ Die neue schwarz-rote Regierung plant evtl. eine Abkehr von der deutschen Tradition restriktiver Kontrolle von Rüstungsexporten. Nicole Deitelhoff ist hingegen der Überzeugung, dass Menschrechte in Fragen der Rüstungsexporte eine Rolle spielen sollten. +++ Ulrike Herrmann betont die militärische Innovationskraft der Ukraine, dadurch könne sie zur größten und bedeutendsten europäischen Waffenschmiede werden. Auch die Kampferfahrung der Ukraine sei wirtschaftlich relevant, auch wenn aufgrund der medialen Berichterstattung der Eindruck vorherrsche, die ukrainischen Soldat:innen würden von westeuropäischen Ländern ausgebildet. +++ Putin habe gemäß Herrmann kein wirtschaftliches Interesse daran, die Kriegswirtschaft wieder auf Friedensproduktion umzustellen. Darum werde er weiter Krieg führen wollen. Nicole Deitelhoff unterscheidet Trump und Vance. Trump sei kein Ideologe, Vance hingegen schon. +++ Putin habe sehr wohl ein Interesse an einer Kriegspause, da die Sanktionen wirken würden und da eine Inflation drohe. +++ Das Wort »Krisendruck« kannte ich noch nicht. Dieser »Krisendruck« macht mir Hoffnung, zumal auch Robert Habeck im Gespräch zuvor dargelegt hatte, wie reibungslos sogar die notorisch zerstrittene Ampelregierung unter »Krisendruck« regiert hat.
Was auf dem Spiel steht – die neue Weltordnung
Studio Rosa, 13-14h: Carlo Masala weist darauf hin, dass Russland massiv aufrüstet und zwischen 2028 und 2030 die eigenen Streitkräfte nicht nur vollständig rekonstituiert habe, sondern sogar über größere und noch dazu kampferprobte Truppen verfügen werde. Dann könnte Russland, wenn es das wollen würde, eine militärische Aggression gegen einen Nato-Staat lostreten. Allerdings wäre das abhängig von politischen Aspekten, u.a. vom transatlantischen Verhältnis und von der Kohärenz der Nato. +++ Marc Saxer (Friedrich Ebert Stiftung) zu den Verhandlungen zwischen USA und Russland: »Nothing is agreed until everything is agreed.« Die Zukunft der Ukraine hänge vollständig vom geopolitischen Kontext ab, dabei träfen eine russische und eine US-amerikanische Vorstellung aufeinander. Russland möchte eine anerkannte Einflusssphäre in Osteuropa und wahrscheinlich im Kaukasus etablieren und strebe in einem neuen »Konzert der Mächte« die Rolle der dritten Großmacht neben den USA und China an. Die USA bemühen sich um eine Annäherung an Russland, um Putin im Hegemonialkonflikt mit China auf die eigene Seite zu ziehen. Saxer sieht derzeit keine gegenseitige Anerkennung der russischen und der US-amerikanischen Vorstellungen. Die russische Einflusspäre ginge auf Kosten der Amerikaner, während Russland kein Interesse daran haben könne, im Hegemonialkonflikt zwischen den USA und China auf die US-amerikanische Seite zu wechseln. +++ Carlo Masala: »Wir erleben das Ende der globalen, liberalen Weltordnung.« Von dieser Weltordnung profitierte die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer exportorientierten Volkswirtschaft in besonderer Weise. +++ In der Vergangenheit kümmerten die USA sich beispielsweise um sichere Seewege, die essenziell für die Bundesrepublik sind. +++ »Da kommen ganz andere Zeiten auf uns zu.« Das geopolitische Umfeld der Bundesrepublik ändere sich dramatisch und die Koordinaten des alten Erfolgsmodells verschöben sich. +++ Er bemängelt das fehlende Verständnis dafür, dass Demokratie in Deutschland verteidigt werden müsse. Es gebe einen Zusammenhang von der bedrohten »äußeren Sicherheit« und Angriffen auf unsere demokratische Staatsform von innen durch eine »hybride Kriegsführung«. +++ Antiliberale Parteien haben bei der Bundestagswahl über zwanzig Prozent erhalten. Mit Verteidigung der Demokratie meint Masala ausdrücklich eine Steigerung der demokratischen Resilienz der Gesellschaft auch durch politische Bildung. +++ Marc Saxer nimmt eine geopolitische Perspektive ein und benennt eine Überdehnung der Großmacht USA aufgrund dreier Konfliktherde: Ukraine, mittlerer Osten und der Hegemonialkonflikt in Ostasien. +++ Trump werde scherzhaft als »amerikanischer Gorbatschow« bezeichnet, der ein Imperium zerstört und eine Überdehnung beendet. Es greife zu kurz, Trump als »erratischen Idioten« zu bezeichnen. Die USA geben die Rolle als liberaler Hegemon auf, der die Weltordnung aufrechterhält, und verhalten sich fortan wie ein riesengroßer Nationalstaat, »ein Bully«, der seine Interessen wahrnimmt, die in Asien von China bedroht seien. +++ Die US-Regierungen vor Trump haben Europa vor die Wahl gestellt, gemeinsam China einzudämmen oder die sicherheitspolitische Verantwortung für Europa und den es umgebenden Ring an Konflikten zu übernehmen. Trump hat bestimmt, wo es langgeht. Da Europa nicht mit nach China komme, erhalte es die Verantwortung für Europa. +++ Auf die Bundesrepublik Deutschland kämen gigantische Aufgaben zu: Aufbau von Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit, Reparatur der Infrastruktur sowie Stärkung der Innovationsfähigkeit der Industrie würden jetzt anstehen. Diese Kosten belaufen sich pro Jahr auf ca. 4 Prozent des BIP. +++ Er fächert drei Arten der Bezahlung auf: Kürzung der Transferzahlungen an das untere Drittel, höhere Besteuerung der arbeitenden Mitte oder höhere Besteuerung der Vermögenden. Keine dieser Lösungen sei vom Geselllschaftsvertrag gedeckt. Deshalb sei es politisch schwierig, die anstehenden Aufgaben in der gebotenen Eile zu erledigen. +++ Das Ende der liberalen Weltordnung sei mental noch nicht bei der Bevölkerung angekommen. Das System, welches die liberale Weltordnung aufspannt, sei »weg«. »Wir müssen mental in der Welt ankommen, wie sie ist, und aufhören zu glauben, dass wir in einer Welt sind, die es nicht mehr gibt.« +++ Carlo Masala vermisst eine Erzählung der neuen schwarz-roten Regierung, wohin Merz und Klingbeil das Land außenpolitisch, innenpolitisch und gesellschaftlich steuern wollen. Dazu gehöre Ehrlichkeit in der Frage, in welcher Situation wir uns befinden. Die gute alte Zeit sei perdu. »Der Urlaub, den wir von der Geschichte hatten, ist vorbei.« Ohne eine solche Erzählung sei es unmöglich, die Menschen in Bezug auf die anstehenden Reformen mitzunehmen. Reformen würden dann lediglich als Einschränkungen der persönlichen Freiheit erlebt werden. »Wir haben so ’n Wahlkampf geführt, als ob wir noch in ’ner Zeit leben würden, wo nicht sowohl innenpolitisch wie auch außenpolitisch alles gerade in die Luft geschmissen wird, und wir nicht wissen, welche Teile wieder auf dem Boden landen.« +++ Marc Saxer knüpft daran an, dass Masala eine große Erzählung und politische Führung anmahnt und erläutert den populistischen Moment, den wir gerade erleben. Er nennt drei Vermutungen in weiten Teilen der Bevölkerung: 1. Es kann nicht so bleiben, wie es ist. Es wird schlechter. 2. Uns wird nicht die ganze Wahrheit über das Ausmaß der Probleme gesagt. Sei es, weil man uns anlügt oder weil die liberalen Eliten selbst nicht den richtigen Weg kennen. 3. Am Ende sind wir die Dummen, die die Zeche zahlen, und zwar nicht nur finanziell, sondern auch durch Todesfälle im Krieg. +++ Um diese Vermutungen zu widerlegen, müsse erklärt werden, warum »der Himmel eingestürzt« sei. +++ Carlo Masala lobt die Präambel des neuen Koalitionsvertrags. +++ Die neue Regierung sollte Ziele formulieren, beispielsweise Wohlstand, Sozialstaat und außenpolitische Sicherheit, und anhand dieser Ziele die anstehenden Reformen begründen. +++ Jan Feddersen: »Geopolitik ist kein Stuhlkreis.« +++ Marc Saxer versucht Zuversicht zu verbreiten und betont, dass das »Konzert der Mächte« im 19. Jahrhundert politisch ebenso stabil war wie das »Gleichgewicht des Schreckens« im Kalten Krieg. +++ Saxer kritisiert, dass das Thema Abschreckung und Aufrüstung eine soziale Schlagseite hat. Die »Kevins« und »Mehmets« sollen kämpfen, aber die »Torbens« und »Marie-Luises« nicht. Darum plädiert er für eine allgemeine Wehrpflicht. +++ Außerdem erläutert er die Vorteile einer europäischen Armee. Kleinere Länder würden sich dann nicht von Deutschland bedroht fühlen. Sonst könnte die deutsche Aufrüstung womöglich Fliehkräfte entfesseln, die die Europäische Union zerstören. +++ Hoffnung macht mir der Gedanke, dass das Ende der liberalen Weltordnung nicht zwangsläufig in einer kriegerischen Auseinandersetzung münden muss (»Konzert der Mächte« im 19. Jahrhundert). Aufschlussreich finde ich Saxers Erklärung des populistischen Momentums. Dass Masala das» Ende der liberalen Weltordnung« ausruft, überrascht mich, obwohl ich es geahnt hatte. Trumps Ukraine-Friedensplan ergibt mehr Sinn, wenn man ihn geopolitisch einordnet, wie Marc Saxer es tut. Sehr sehenswertes Gespräch!
Eigentlich hatte ich mir noch weitere Veranstaltungen rausgesucht, aber die sehe ich mir nicht live, sondern nach und nach in der Mediathek an.