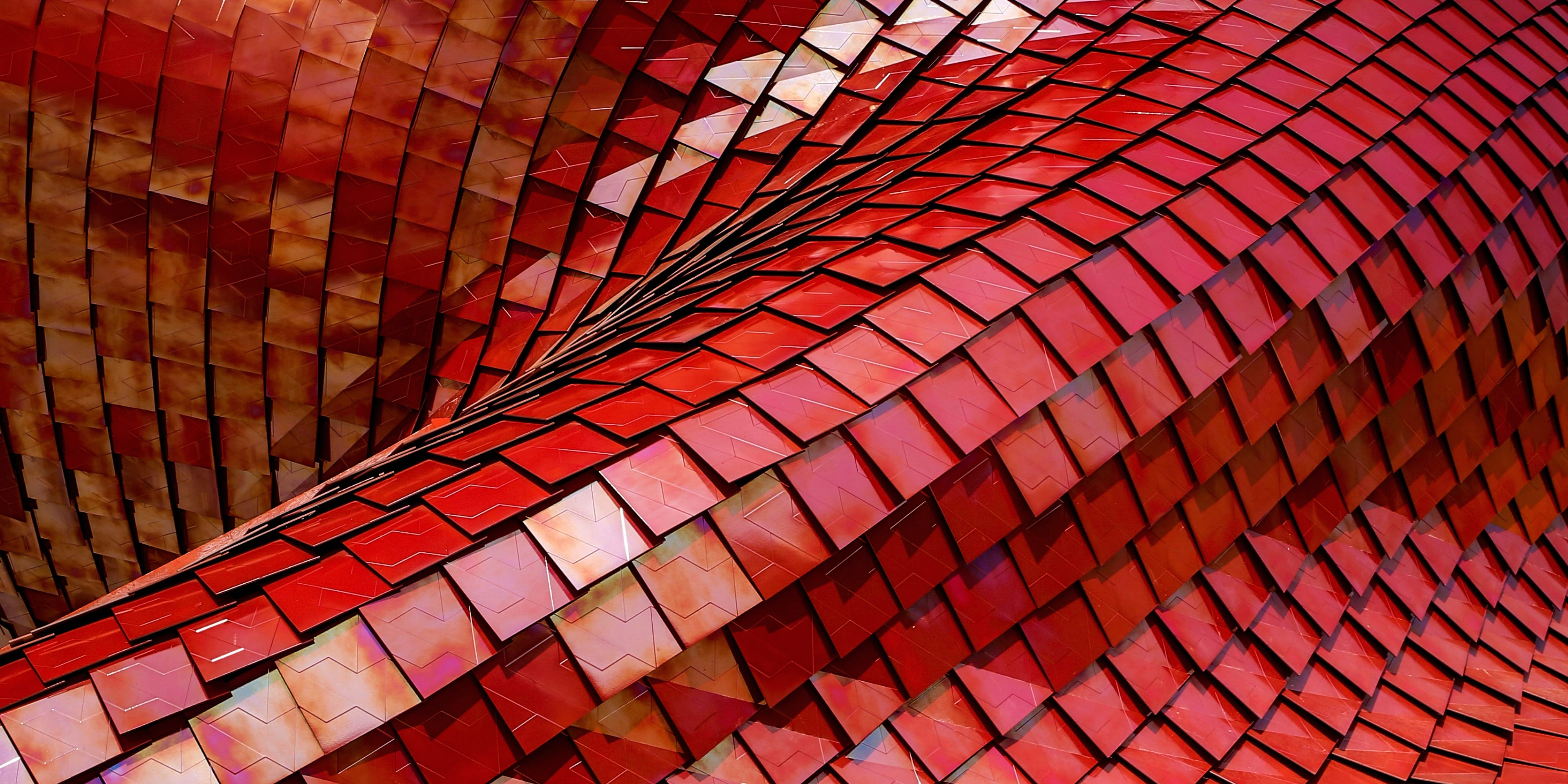Heutzutage geht es bei diesem Stiftungs-Vorläufermodell hin und her – und ständig entgleist dabei der Dialog. Während um mich herum viele Leute ihr Einkommen fast schon kontinuierlich steigern, Aktien gar kaufen oder ein Bauernhaus an der Elbe bzw. an der Oder erwerben, versuche ich krampfhaft, nicht weiter ins Minus zu rutschen. Dies gilt auch und erst recht bei den im Zusammenleben geltenden nicht-geldlichen Dingen: wie Einkaufen und Abwasch etwa. Mehreren Freundinnen blieb ich bereits nach meiner Trennung – unterm Strich – eine enorme Summe schuldig. Eine ebenfalls vom Schreiben lebende Freundin tröstete mich – und sich: Eigentlich komme es nur darauf an, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen, und zwar vor allem nicht-verwertbare: so wie die zwischen Mutter und Kind. Ein arbeitsloser Soziologe fügte später hinzu: Zwischen Männern und Frauen bestehe immer noch eine Ungleichheit in der Anerkennungs-Ökonomie – dahingehend, daß z.B. wenig-verwertbare Geschichten auch weniger wert sind.
Die Besitzerin der Bordellbar “Psst”, Felicitas, erwiderte neulich einer Berliner Sozialpolitikerin, auf die Frage, wie sie die Ausbeutung der Prostituierten durch Männer sehe, daß sie nichts gegen Zuhälter habe: “Warum dürfen nicht auch mal die Männer ökonomisch von einer Frau abhängig sein?” Dazu erzählte mir die ehemalige Juso-Aktivistin und Journalistin Pia, die zu den wenigen Frauen gehört, die gerne als Prostituierte arbeiten – was einen bleibenden Eindruck bei ihren Kunden hinterläßt, daß sie zwar ihren Freund leichten Herzens finanziere, er jedoch das Geld leider bei (anderen) Prostituierten lasse.
Ganz anders dagegen die ehemalige US-Playmate Janet: Sie reist als kamasuthra-erfahrene Film- und Restaurant-Kritikerin in der Weltgeschichte herum, ein Sugar-Daddy finanziert ihr eine Luxus-Wohnung in Bombay und ein anderer die Flüge, sie gibt nicht einmal zehn Mark für ein Taxi aus, stattdessen organisiert sie sich einen “Driver”, wo immer sie sich aufhält. Ihre Lebenskunst besteht überspitzt gesagt darin, aus Möchtegern-Zuhältern mutige Mäzene zu machen.
Die Bild-Zeitung berichtete unlängst über einen umgekehrten Fall: Eine junge drogenabhängige Prostituierte aus Pankow brachte einen LKW-Fahrer vor Gericht, weil er sie mehrmals vergewaltigt hatte: “Ich bring dich groß raus!” Mit diesem Spruch hatte er sie ans Bett gefesselt – ohne zu zahlen.
Zwischen diesen Extremen oszillieren anscheinend die prostitutiv-mäzenatischen Beziehungen. Mehr als alle anderen sind sie jedoch von einer gewissen Klarheit – sprich: Wahrheit – gekennzeichnet. Wobei die Frauen eine größere Fähigkeit zur Selbstentblößung besitzen. So finanzierte z.B. eine Berliner Slawistin nicht nur ihrem Geliebten, einen russischen Schriftsteller, fünf Weltreisen, sie kümmerte sich auch um die Vermarktung der daraus gemeinsam entstandenen Texte und posierte aus Werbegründen dann sogar halbnackt im “stern” dafür, während er angezogen hinter ihr stand. Bloß um die russische Ausgabe ihres gemeinsamen Buches sollte er sich kümmern. Als diese erschien, kamen jedoch nur seine Texte – und sein Name – darin vor. Seine Ko-Autorin wurde ob dieser allzu unausbalancierten Beziehung – reaching for the stars – bitter. Auf der anderen Seite gibt es einen sozialdemokratischen Bestseller-Autor, der freimütig seit Jahrzehnten eine Anarcho-Schriftstellerin finanziert, mit der er ansonsten gar nichts zu tun hat. Und die Künstlergruppe “Endart”, die anfänglich von einer Frau gefördert wurde, die ihr Geld in einem Bordell verdiente, unterstützte ihrerseits jahrelang eine zum Sozialfall abgerutschte Sozialarbeiterin mit monatlichem “Taschengeld”. Ähnlich großzügig verhalf ein Bremer Professor einmal einer begabten Studentin zu einer Hochschulkarriere. Wobei ich jedoch nicht weiß, welchen Preis sie dafür zahlte – und ob überhaupt.
Meine diesbezüglichen Recherchen in den letzten Wochen förderten eher Generelles zu Tage: Daß z.B. im homosexuellen Milieu mehr eindeutig mäzenatische Beziehungen existieren als im heterosexuellen, und dort wieder unter Lesben mehr als unter Schwulen. In gewisser Weise gehören auch noch eine Reihe Berliner Stiftungen – von linken Erben – zu diesem mäzenatischen Milieu, das sich aus einem gewissen Druck der Gesellschaft herausbildet – als eine Art Gegendruck. In der Moderne, die für Kunst und Wissenschaft Märkte sowie Institutionen schuf, überlebte der selbstlose “Freund und Gönner” denn auch zunächst im jüdischen Wohltäter. Später umfaßte das Spektrum dann sogar römische Gräfinnen, die linksradikale Organisationen unterstützten und indische Maharadschas, die Feministinnen finanzieren. Bei den Parsen in Bombay kommt so etwas besonders häufig vor. Die Studentenbewegung wurde u.a. von Augstein und Bucerius alimentiert.
“Tu nicht so gönnerhaft!” Dieser Frauenspruch deutet darauf hin, daß hinter einer scheinbar großzügigen Geste oft ein nichtausgesprochenes Eigeninteresse steckt. Der Jerusalemer Ornithologe Amoz Zahavi hat darüber geforscht. Seine Überlegungen anhand von Beobachtungen wilder Vögel veröffentlichte bereits die von Birgit Breuel geleitete “Expo 2000? in Hannover – im Kontext eines Katalogs über “Hyperorganismen”. Zahavi, der sich insbesondere mit der “Hilfe beim Nestbau und beim Füttern von Lärmdrosseln” beschäftigte, sowie auch mit dem “angeblichen Altruismus von Schleimpilzen”, hat dabei zwar nichts Neues entdeckt, aber er interpretiert diese fast klassischen Fälle von Kooperation nun einfach in “ein selbstsüchtiges Verhalten” um, das er dann mit Darwinscher BWL-Logik durchdekliniert: “die Individuen wetteifern untereinander darum, in die Gruppeninteressen zu investieren…Ranghöhere halten rangniedere Tiere oft davon ab, der Gruppe zu helfen.” Es ist von “Werbung”, “Qualität des Investors” und “Motivationen” die Rede. Zuletzt führt Zahavi das Helfenwollen quasi mikronietzscheanisch auf ein egoistisches Gen zurück, indem die “individuelle Selektion” eben “Einmischung und Wettstreit um Gelegenheiten zum Helfen” begünstige – der “Selektionsmechanismus” aber ansonsten erhalten bleibe. Interessant fand ich die dabei eine von ihm erwähnte Beobachtung an Pinguinen, bei denen sich manchmal alleingelassene Jungvögel vor ihren vielen männlichen Helfern, die sie partout wärmen und beschützen wollen, geradezu fluchtartig in Sicherheit bringen müssen, um nicht von ihnen erdrückt zu werden. Durch solche Umdeutungen des Altruismus in Egoismus wird aus dem Mäzenatentum ein Parasitismus.
Im Zuge der Postmoderne, da aus Gegner Partner wurden und man nicht einfach mehr miteinander reden darf, sondern kommunizieren muß, spricht man (im Projektemachermilieu) am Liebsten gar nicht mehr von Mäzenatentum, sondern von Sponsoring. Der Sponsor hat ein explizites Eigeninteresse, das als erfrischende Ehrlichkeit daherkommt – und nicht als brutale Blödheit. Auf diese Weise soll alles Ausbeuterische und Demütigende sich in glückliche Fügungen verwandeln.
So schreibt z.B. Marita Haibach in einem Campus-Reader über das “Fund-Raising”: Speziell Frauen würden das “Klinkenputzen bei der “Sponsorensuche” oft noch als erniedrigend empfinden. Die Autorin rät ihnen deswegen, das damit verbundene “Sich-Verkaufen” als etwas ganz “Normales” zu begreifen, “das zu diesem Vorgang dazu gehört”. Dazu müßten zuvor aber die “Hauptinteressen der GesprächspartnerIn ergründet werden”. Auch das Sponsoring ist also nur einen Wimpernschlag von der Prostitution entfernt – und vielleicht sogar noch näher dran.
So daß es nicht verwundert, wenn russische Prostituierte ihre Kunden durchweg als “Sponsoren” bezeichnen. Wie das deutsche “Jahrbuch Sponsoring” feststellte, steigen die dafür bereitgestellten Ausgaben von Jahr zu Jahr: 2000 wurden 4,4 Milliarden DM für Sport und Kultur-Sponsoring ausgegeben (im Jahr 2002 rund 5,4 Milliarden). International liegt die BRD damit an 3. Stelle – hinter den USA (11,5 Mia) und Japan (4,8 Mia). Das Sponsoring ist in der Regel eine Firmen-Investition. Und die Gesponsorten sind meist Personen von öffentlichem Interesse bzw. solche, die es werden wollen. Aber wenn z.B. die Schwimmerin Franziska van Almsieck mehr Sponsorenverträge hat als Medaillen, oder wenn jede Einladung eines “Playmates” von wo auch immer zum Playboy-Chefredakteur nach Chicago automatisch mit einschließt, dass sie mit allen Filmstars und Freunden von Hefner vögelt, dann deutet auch das darauf hin, daß die russischen Prostituierten der Wahrheit näher kommen als alle Marketing-Strategen. Übrigens bezeichnen die Russinnen auch ihre (reichen) deutschen Ehemänner gerne als “Sponsoren”. Und im Straßenverkehr sieht man immer öfter junge Mädchen, die an ihren ersten Opel-Vectra oder VW-Golf Schilder geklebt haben – mit der Aufschrift “Sponsored by Opa” oder “Sponsored by Daddy”.
Die TV-Moderatorin Arabella Kiesbauer gestand oder behauptete einmal keck: “Für 1 Million würde ich mit jedem schlafen”. Der Wirtschaftsforscher Rapoport hat versucht, diese libidoökonomische Logik durchzurechnen – am Beispiel der Oper “Tosca” von Verdi: “Der Polizeichef Scarpia verspricht Tosca, ihren Geliebten Caravadossi freizulassen, wenn sie mit ihm schläft. Er denkt jedoch gar nicht daran, den Rivalen am Leben zu lassen. Tosca wiederum verspricht, sich Scarpia hinzugeben, um ihren Geliebten zu retten. Sie will jedoch dessen Freilassung ohne diesen Liebesdienst erreichen”.
Für den Ökonomen in der Oper ist deswegen klar: “Weder für Scarpia noch für Tosca gibt es ein Argument dafür, daß es besser wäre, den Markt zu respektieren – also ein ehrliches Spiel zu spielen, als den anderen zu verraten”. Aber zu welchem Preis? Ausgehend von einem Gewinn von plus fünf kostet es Tosca minus fünf, mit Scarpia zu schlafen, es bringt ihr aber plus zehn, Caravadossi das Leben zu retten. Eine Täuschung Scarpias bei gleichbleibenden Preisen brächte ihr jedoch plus 15 ein (d.h. plus zehn für Caravadossi und plus fünf dafür, “der Umarmung Scarpias entkommen zu sein”). Der Ökonom schreibt ihr nur plus zehn an, weil es zwar wirklich unangenehm ist, Scarpia nachzugeben, aber nichts zu tun “ganz einfach gleich null ist”: Daher null plus zehn und nicht plus fünf plus zehn. Ist diese Wertsetzung gerecht? Man kann sie ökonomisch damit rechtfertigen, “daß der Gewinn einer Entscheidung, der mit plus zehn beziffert ist, für Tosca zwar hoch genug ist, um sie zu interessieren, aber doch noch so niedrig, daß sie zögert: Plus 15 würde zu einer unmittelbaren Entscheidung führen! Auf der anderen Seite ist es die gleiche Gewinnminderung, die Scarpia dazu bringt, Caravadossi zu erschießen, wenn er von Tosca bekommt, was er begehrt. Das Ende des Deals sprengt jedoch – unwillkürlich – den ganzen Handelsrahmen: Tosca tötet Scarpia!
Inzwischen ist die Verletzung von “Spielregeln” gängige Alltagspraxis geworden. Da ist z.B. der Fernsehredakteur, der sich in eine junge Kollegin verliebt hat und nun seinen 10.000 DM-Job aufgibt, um seine Frau und das gemeinsame Kind nicht mit monatlich 5000 DM alimentieren zu müssen: “Da bleibt mir ja nichts mehr übrig!” 1997 sorgte ein diesbezüglicher Spiegel-Artikel – “Geschlechterkampf um Kind und Geld” – für Furore. Wenn man dem Autor, Mathias Matussek – in seiner Argumentation folgte, und tausende von Mittelschichts-Männer taten das, dann geht die staatsfeministische Tendenz derzeit dahin, daß die klugen Frauen nur heiraten – und dann ein Kind bekommen, um sich anschließend sofort wieder scheiden zu lassen, wobei sie eine Rechtslage ausnutzen, die die Kindsväter im Endeffekt zu ihren unfreiwilligen Mäzenen macht – und das auf Jahrzehnte. Zuletzt war ein solcher Arschloch-Journalismus in Zimbabwe/Rhodesien am Werk: Weltweit jammert die Öffentlichkeit über vier erschlagene weiße Farmer, weil gegenwartsverdummt ausgeklammert wird, daß die selben Weißen 100 Jahre lang die Schwarzen zu tausenden und zigtausenden folterten, verstümmelten und ermordeten. Ähnlich ist es auch mit den Müttern, die nach Jahrhunderten der Rechtlosigkeit jetzt auch mal pekuniär auf den Putz hauen können.
Ich kenne eine ganze “Gruppe” von hochqualifizierten Frauen, die alle reiche Juristen heirateten. Sie “schenkten” ihnen Kinder, richteteten das Heim her – und erledigten den Background für ihre Ehemänner, vor allem aber machen sie mehr oder weniger nicht-verwertbare Kunst. Die Männer können sich – zumindestens in dieser Hinsicht – zu Recht als die Mäzene ihrer schönen, klugen Frauen sehen. Aber dieses “Beziehungs-Modell” funktioniert nicht (lange). Höchstens in den Fällen, wo der Mann ein Deutscher und die Frau eine Jüdin ist – und also nach innen ein gewisser Gegendruck des Gelingen-Müssens aufgebaut wird, eine Art persönliche Wiedergutmachung. Dies trifft auch auf eine Reihe Berliner Akademikerinnen zu, die erfolgreich die Künstler-Karriere ihrer afrikanischen Liebhaber managen. Einer meinte neulich: Früher hat nie was geklappt, aber seitdem Du mir hilfst, geht es vorzüglich voran. Seine weiße Freundin freute sich über dieses Kompliment via Ferngespräch – mußte sich dann aber von ihm sagen lassen, daß es eher vorwurfsvoll gemeint war.
Einige dieser “Managerinnen” gehören zu einer Gruppe von Frauen, die alle mehr oder weniger erfolgreich ihr Leben meistern – und ständig weitere Reisen bzw. größere “Projekte” in Angriff nehmen. Das ist nichts Besonderes mehr: es gibt inzwischen weltweit ein derartiges “Fräuleinwunder” – seit dem wirklichen Ende des 2.Weltkriegs: 1990. Wobei Frauenemanzipation, Deindustrialisierung und Medialisierung zusammenwirken. Zwischen 1991 und 1997 fanden allein in Deutschland 500.000 Frauen im “Dienstleistungsbereich” einen neuen Job, während zur gleichen Zeit 900.000 Männer – vor allem im verarbeitenden Gewerbe – ihren Arbeitsplatz verloren. Bei der e.e. “Gruppe” ist auffallend, daß sie sich gerne mit Luschen-Männern – ebenso intelligenten wie drogenkonsumierenden und depressiven Losern – umgeben, deren “Kunst” bestenfalls schwer-verwertbar daherkommt, schlimmstenfalls aus abstrus-verstiegener Theoriebildung (am laufenden Band) besteht. Hier sind es die (kinderlosen) Frauen, die die Männer mäzenieren – mindestens emotional.
Früher hätte man gesagt – im Falle der Juristen-Männer: Sie ruinieren sich (für ihre Künstler-Frauen). Während die Projekt-Frauen sich (für die Luschen-Männer) erniedrigen. Was einmal romantisch-pornographisch – mit dem Gärtner von D.H.Lawrence – begann, ist heute mit dem Sextourismus epidemisches Scheitern geworden – bei Mann und Frau.
Es gibt eine Feministin, die sich schon recht früh – vor dem Ersten Weltkrieg – Gedanken gerade über dieses Existenz-Problem – zwischen Mäzenatentum, Leidenschaft und Freiheit – gemacht hat: Franziska Gräfin zu Reventlow. Über den “schlimmsten Typus – den Retter” schrieb sie: “Oft wünscht sich der Retter ein Kind – gerade von dieser Frau, ich weiß nicht warum…Die Idee vom ‘vollen Glück’ hat für mich immer etwas Trostloses, Bedrückendes”. Männer, die Frauen finanzieren wollen, gibt es sicher genug, meint die Autorin, “aber solche, die angenehm und dauernd finanzieren, dabei sympathisch oder wenigstens erträglich sind, nicht zuviel persönliche Ansprüche stellen und uns nicht plagen – ich fürchte, die muß man mehr oder weniger als seltenen Glücksfall betrachten”. Dabei ist es “immer empörend für eine Frau, wenn das äußere Dasein sich nicht angenehm und schmerzlos abwickelt”…Andererseits braucht die erfolgreich sich aushalten lassende Frau “eiserne Nerven und eiserne Ausdauer: Sobald die Männer Geld hergeben, sind sie viel scharfsinniger und wissen besser Bescheid über Einkaufspreise…”
Und dann sind die Frauen aus den oberen Schichten oft auch noch dadurch gehandicapt, daß ihre gute Erziehung die Entwicklung “der praktischen und kaufmännischen Instinkte” stark beeinträchtigt hat. Während die Mädchen, “die aus unteren Schichten heraufkommen, viel energischer und zielbewußter danach streben, Karriere zu machen. Sie wollen um jeden Preis nach oben kommen und reüssieren deshalb auch viel eher”. (Freud hat diesen Befund der Reventlow bestätigt.) Besonders in Paris wimmelt es – auch heute noch – von jungen hübschen Unterschichtmädchen aus der Provinz, die sich reiche alte Männer geangelt haben, welche sie finanziell aushalten, intellektuell weiterbilden und in die Gesellschaft bzw. in das was davon übrig geblieben ist einführen. Die Bohème-Gräfin Reventlow grauste sich vor diesem Typus: “Wir wurzellosen Existenzen haben alle nur so einen dunklen, verschwommenen Begriff von Eltern und Senioren, die uns übelwollen”. Sie blieb lieber bindungslos – und unruhig unterwegs. Die Anzahl ihrer Liebhaber und ihrer Gläubiger hielt sich deswegen in etwa die Waage: “Wäre ich noch einmal 18 Jahre alt, so würde ich die Sache anders angreifen, mich entweder ganz in die Tiefe begeben oder darauf schauen, gesellschaftlich durchaus oben zu bleiben. Der Mittelweg ist in diesem Fall an Freuden vielleicht reicher, aber jedenfalls bei weitem der unbequemste”. Franziska zu Reventlow starb 1918 – mit 47.
“Wenn Denken bedeutet, etwas zu Geld zu machen, dann ist das Denken der Leidenschaft Prostitution,” meint mein Lieblings-Libidoökonom Lyotard, fügt jedoch hinzu: “So einfach ist es aber nicht”. Neuerdings haben – inbetween – wieder zwei Frauen für Schlagzeilen gesorgt: 1. Das sogenannte “Superweib” Hera Lind, weil sie Ehemann und vier Kinder verließ, um mit einem windigen Loser namens Engelbert das ‘volle Glück’ zu erleben. Der Neue lebte zwar mit einer schöneren und klügeren Frau zusammen, hatte aber laut Bild-Zeitung “nur Schulden”. 2. Die “Big Brother”-Blondine Sabrina, die als “Sex-Weib” im TV-Container einsprang, weil man ihr und ihrem Freund zu Hause alles “total gepfändet” hatte (wieder laut Bild-Zeitung). Im ersten Fall prostituierte sich der Mann, im zweiten die Frau. Es ist anzunehmen, daß sich sowohl die Bestseller-Autorin als auch der TV-Sender als großzügig erweisen, denn beide Loser gaben ihr letztes. Mitunter sind aber die besten Wirte auch die besten Parasiten, wie der Philosoph Michel Serres zu bedenken gibt: Eine (schleichende) Umkehrung, die das Gönnertum (in Form von Mäzen/Sponsor) seit je suspekt macht. Erst recht, wenn es um die Kunstverwertung geht.
Erwähnt sei hierzu die “Karriere” des Rap Stars Shanell Jones – auch “Lady Luck” genannt. Die heute 18jährige New Yorkerin wurde von Def Jam Records entdeckt, nachdem sie in der Sendung “Check the Rhyme” auf KissFM als Lyrikerin aufgetreten war. Man gab ihr eine einmalige Chance. Für ihren Vertrag über 5 Platten bekam sie rund 1 Million Dollar – inklusive Schmuck, ein Auto und ein Apartment. Die wohlerzogene Highschool-Rapperin, aus einem religiösen Mittelschicht-Elternhaus stammend, mußte dafür jedoch fortan – zum Entsetzen ihrer Mutter, die allerdings das Geld auch gut gebrauchen konnte – als kleine verruchte Ghetto-Echse auftreten, die “hard as any man” Schwanz auf Crack und Ficken auf Titten reimen konnte, angetan mit der üblichen Street-Wear: Nike Air Jordan Sneakers, schräg aufgesetztem Baseball Cap und süßem Schmollmund. Mit der Zeit entwickelte Lady Luck ein großes Talent darin. Seit der Zerschlagung der Black Panther Party und der Ermordung ihrer Aktivisten werden die US-Schwarzen unbarmherzig im Entertainment-Business verbraten – oder aber weggesperrt: 1/3 von ihnen befindet sich ständig im Gefängnis, nicht ohne Grund bezeichnen sie sich als “Kriegsgefangene”.
Über die namenlosen weißen Schwestern von Lady Luck hat Doris Lessing (in “The Summer before the Dark”) geschrieben: “Diese Mädchen sind auffallend gekleidet, in anmachenden Farben”. Sie gehören zum Bodenpersonal der kleinen teuren US-Fluggesellschaften – und sollen den Passagieren Auskunft geben, das tun sie auch: “Aber das ist nicht ihre Aufgabe”, d.h. dafür werden sie nicht bezahlt. “Sie sollen vielmehr die Vorstellung von leicht zu habendem und schuldlosem Sex im Umfeld der Fluglinie verbreiten…Dazu hat man die attraktiven, aber nicht sehr erotischen Mädchen angestellt. Sie wurden speziell wegen ihrer freundlichen, appetitlichen Tageslicht-Sexualität ausgesucht. Und nun gehen sie allein, zu zweit, zu dritt auf und ab – und lächeln, lächeln, lächeln. Nach einigen Stunden, wenn z.B. das Flugzeug Verspätung hat, blasen sie sich langsam auf – mit einem warmen expandierenden Gefühl. Sie sind wie benommen – von ihrer eigenen Schönheit und von ihrer öffentlichen Rolle, zurechtgemacht und genau dort situiert, wo sie alle Blicke auf sich ziehen, und geradezu betört von ihrer ständigen Hilfsbereitschaft. Sie lächeln und lächeln und lächeln. Und schon bald sieht es so aus, als ob sich diese Mädchen, eins nach dem anderen, in die Luft erheben und entschweben – emporgetragen allein von ihrem eigenen guten Willen, der ständig durch die immense Aufmerksamkeit angefacht wird”. Wenn diese Mädchen heiraten – und das tun sie früher oder später alle, dann ist es, als hätte man sie von der Bühne und aus dem Scheinwerferlicht weg in ein dunkles Zimmer eingesperrt. Oder als hätte man sie mitten im Flug in der Luft abgeschossen. Und das geht natürlich nicht gut, meint Doris Lessing.
Das hiesige Pendant zu diesem US-Bodenpersonal sind die Kellnerinnen, speziell in den Intellektual-Touristenkneipen des Prenzlauer Bergs liefern sie allnächtlich wunderbare Performances, die von den männlichen Gästen mit Liebesbriefen – gereimt oder gemalt – im Dutzend honoriert werden. Eine, Djamila, die im “Torpedokäfer” arbeitete, machte einmal eine Ausstellung aus all diese Liebesschwüren und -briefen. Die Wirte stellen ihrerseits oft nur noch solche hübschen Mädchen ein, die farblich aufeinander abgstimmt sind – in bezug auf ihre Haare und Häute, außerdem Kulturwissenschaft studiert haben und ganz sicher Gewähr bieten, daß sie gerade an einem neuen “Berlinroman” schreiben. Das Sponsoring besteht in diesem Fall – ähnlich wie bei Lady Luck – aus extrem hohen Vorschüssen, die die Verlage diesen jungen Frauen zahlen.
Was ist mit den älteren? Hierbei hat sich die Praxis bewährt, sie mit Management-Schulungskursen zu “fördern”. Etwa 80% der von McKinsey und anderen Windbeuteln entwickelten Verbesserungssysteme für das Betriebsergebnis (z.B. des Rowohlt-Verlags) werden von geschiedenen bzw. in Trennung lebenden Frauen genutzt – um sich durch Optimierung zu restabilisieren. Bei diesen ganzen Verfahren – “Delta-Kurven” – geht es um Identifikation – statt Kritikfähigkeit. Ein neuer “Teamgeist” soll sich dabei einstellen. Wobei z.B. das Magazin “Unternehmerfrauen” (der Verlagsanstalt Handwerk) so weit geht, ihren Leserinnen sogar Hilfestellung beim “managen” der eigenen Familie – als Nuclear-Team – zu geben. Hier ist man strikt gegen jede Unterstützung durch den Sozialstaat, dafür haben 77% der Leserinnen Internet. Sie sind derart leistungsstark, daß sie sich selbst ihre besten Gönner sind! Deswegen betonen sie auch stets lächelnd , obwohl zunehmend schmallippiger – wenn sie sich z.B. bei der wirklichen (lesbischen) Mäzenin Gil Sander neu und sündhaft teuer einkleiden: “Man gönnt sich ja sonst nichts!”