Es geht hier um „Fakelore“ (zu diesem Begriff fand 2004 auch bereits eine Großveranstaltung der „mobilen Akademie“ von Hannah Hurtzig statt):
Der Tierfänger Carl Hagenbeck – durch seinen Hamburger Zoo berühmt – wollte Ende des 19. Jahrhunderts im Berliner Arbeiterbezirk Wedding einen „Kolonialpark“ mit afrikanischen Tieren und Menschen eröffnen. Sein Projekt zerschlug sich jedoch – wahrscheinlich am Widerstand der Aktionäre des Berliner Zoos, die das Projekt als Konkurrenzunternehmen begriffen. Stattdessen entstand dort zwischen 1896 und 1908 das Afrikanische Viertel – eine moderne Wohnsiedlung, ab 1910 wurden auch die restlichen Freiflächen dort noch bebaut – unter anderem von Mies van der Rohe und Bruno Taut. Die Straßen dazwischen hatte man nach deutschen Kolonien und Kolonisatoren benannt: Uganda-, Tanga-, Otawi-, Lüderitz-, Swakomunder und Windhuker Straße. Daneben gab es dort auch bald eine Kleingarten-Dauerkolonie namens Togo: Sie ist älter als der gleichnamige Staat. 1939 benannte man außerdem noch eine Allee nach Carl Peters – dem fürchterlichen „Reichskommissar für das Kilimandscharogebiet“.
Sie wurde 1986 aufgrund von Bürgerprotesten umbenannt – nach dem CDU-Politiker Hans Peters, was der in Berlin lebende „Afrikanische Diaspora“-Forscher Joshua Kwesi Aikins eine bloße Umwidmung nennt, denn sie heißt nach wie vor Petersallee. In der Kamerunerstraße wohnen heute ironischerweise viele Emigranten aus Kamerun – und es gibt dort eine Bordell mit dem sinnigen Namen „Sonne“ sowie eine Kneipe mit Kameruner Küche: das „Bantou Village“. Deren Besitzerin, Susan Seitz, klagt über ihre deutschen Nachbarn, dass sie ihr bei jeder kleinsten Gelegenheit die Polizei auf den Hals hetzen. Ich traf mich dort gelegentlich mit dem ebenfalls im Wedding lebenden taz-Kolumnisten „Bushdoctor Truthseeker“. Er starb 2006 an Krebs. Sein letzter Wunsch war: „Begrabt mich nicht in weißer Erde!“ Seine Frau ließ seine Leiche daraufhin für 6000 Euro nach Afrika überführen, wo man ihn in seinem Heimatort Enugu beerdigte.
Die Pläne für den Hagenbeckschen „Kolonialpark“ im Wedding – mit Tier- und Völkerschau – arbeitete seinerzeit Heinrich Umlauff aus – ein Neffe von Carl Hagenbeck, der in der Firma seines Vaters „J.F.G. Umlauff“ arbeitete, die ihre Geschäftsräume auf dem Spielbudenplatz an der Reeperbahn hatte. Sie importierten und verkauften Naturalien und Kuriositäten aus Übersee, stellten Muschelprodukte, Tierpräparate und Menschenfiguren her, „die die jeweiligen gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Bedürfnisse bedienten. Für mehr als 100 Jahre sollte das Unternehmen den deutschen Markt für Zoologica, Ethnografica, Anthropologica und plastische Bilder vom Menschen bestimmen,“ schreibt die Kulturwissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Britta Lange in ihrer Doktorarbeit über die Firma Umlauff, die den Titel „Echt. Unecht. Lebensecht.“ hat.
„Echt“ – das waren z.B. Schilder und Speere von Eingeborenen, Häuptlingsschmuck und Lendenschurze aus Antilopenleder. Zu ihrer Beschaffung arbeiteten die Umlauffs mit Elfenbeinimporteuren und Sammelexpeditionen zusammen, ihre Kunden waren Völkerkunde- und Missionsmuseen in Europa und Amerika, aber auch Schausteller. Für die Wissenschaftler brauchte es gesicherte Informationen über die Herkunft der Objekte. Deswegen waren „Erzählungen ein Hauptgegenstand des Umlauffschen Geschäfts,“ schreibt Britta Lange. In den Museen und Völkerschauen, mit denen u.a. Weltausstellungen flankiert wurden, ging es um eine Darstellung der „evolutionistischen Wissenschaftsauffassung“ (nach Charles Darwin), die analog zur Naturgeschichte eine evolutive Kulturgeschichte postulierte: – wenn dort die Entwicklung vom Urfisch zum Menschenaffen fortschritt – dann hier von den Hottentotten zu den Engländern. „Auf politischer Ebene arbeitete das evolutionistische Weltbild der Legitimation kolonialistischer Herrschaft über die außereuropäischen Ethnien in die Hände,“ schreibt Britta Lange.
Seit 1889 bot Heinrich Umlauff zur Illustrierung dieses Weltbildes den Museen lebensgroße „Modellfiguren verschiedener Völker“ an: „Als ‚Völkertypen‘ visualisierten sie in Wachs und später in Papiermaché Vertreter von so genannten ‚Naturvölkern‘.“ Im Gegensatz zu den Ethnografica, die den Museen als Originale – „echt“ – verkauft wurden sowie auch zu den Präparationen, die mindestens Teile des originalen Tieres enthielten, waren die „Völkertypen“ unecht: „Sie stellten Leben vor. Von den Zeitgenossen wurden sie daher als ‚lebensecht‘ bezeichnet. Der Erfolg des Umlauffschen Unternehmens beruhte neben kaufmännischem Geschick auf den Menschenbildern, die es entwarf: Kollektionen von Ethnografica und musealen Inszenierungen von Tieren und ‚fremden‘ Menschen. Die Firma Umlauff reproduzierte und distribuierte gesellschaftliche Klischees ebenso, wie sie an der Produktion von Klischees beteiligt war…Als Kulturgeschichte ist sie damit auch eine Geschichte des ‚Echten‘, des ‚Unechten‘ und des ‚Lebensechten‘.“
Das Verhältnis dieser Begriffe zueinander wurde und wird jedoch immer „unübersichtlicher“: Wurden z.B. die Ethnographica aus dem „alltäglichen oder kultischen Zusammenhang der ‚Naturvölker'“ gerissen, waren es „Originale“. Kopien solcher Objekte, „die für den Handel hergestellt wurden, galten als „Fälschungen“. Während die von Eingeborenen auf Völkerschauen angefertigten Gegenstände, wohlmöglich mit Schnitzmesser aus Solingen, zwar von einigen Museen später erworben wurden, jedoch nur als quasi „halbechte“ (und daher billigere) Exponate. Umgekehrt riet Felix von Luschan, Kurator des Königlichen Völkerkundemuseums in Berlin, Heinrich Umlauff bei einer echten „Benin-Bronze“, sie 24 Stunden in fließendes Wasser zu legen, damit sie noch echter aussehe – und damit teurer verkauft werden konnte. Die „Fälschung“ konnte auch in der „Narration“ bestehen, die die „Echtheit“ der Objekte beteuerte, „statt sie zu beweisen.“ Und die „Echten“ Gegenstände mussten zugleich „zirkulierenden Vorstellungen und Bildern des ‚Echten‘ entsprechen“.
Einer der Umlauff-Söhne kam über das glänzende Geschäft mit „afrikanischen Mumien“ darauf, es auch einmal mit Meerjungfrauen zu versuchen: „Der Körper wurde gebunden, auf den Rumpf ein schlechter Frauenschädel gesteckt und dieser ausmodelliert. Die Hände wurden aus Affenhänden gemacht, hieran ganz lange Nägel und die andere Hälfte – das Hinterteil – war mit einer grossen Fischhaut überzogen. Auf dem Kopf eine blonde Perücke.“ An diesem Objekt waren vor allem russische Schausteller interessiert. Dort hatte sich spätestens mit dem Bau von St.Petersburg, als neuer Hauptstadt an der Ostsee und dem Ausbau seiner Flotten eine ganze Meerestheologie herausgebildet, die von Neptun und Nixen bis zum Vereidigungszeremoniell der Marine reichte – und später in Ozeanologie und Polarforschung überging. Johannes Umlauff schreibt: „Ich verkaufte in einem Jahr 15 Stück, und alle, die sie kauften, sind reiche Leute geworden, natürlich in Russland.“
Nachdem Kamerun und Togo 1884 deutsches „Schutzgebiet“ geworden war, startete der Herzog von Mecklenburg eine Expedition nach dort, die reiche „Beute“, „Ausbeute“ oder „Ernte“ erbrachte, wie Heinrich Umlauff die Beschaffung von Exponaten nannte. Der Ethnologe Hans Fischer hat geschildert, wie das im Falle der 1909 ausgesandten „Hamburger Südsee-Expedition“ aussah: Die Teilnehmer gingen immer dann an Land, wenn die „Eingeborenen“ nicht in ihren Dörfern waren – ungeniert betraten sie deren Hütten und nahmen sich, was ihnen wertvoll erschien. Dafür hinterließen sie die üblichen europäischen „Gegengeschenke“ (Tabak, Glasperlen, Spiegel und ähnliches).
Nach Photos, die der Herzog von Mecklenburg von Pygmäen gemacht hatte, fertigte Heinrich Umlauff später eine „Lebensgruppe, die eine Familiensituation vorführte“. 1912 bot er diese dem Stockholmer Ethnologischen Museum als „Zwergen-Gruppe aus Kamerun.Hinterland“ an – für „900.- ohne Hütte, mit imitierter Hütte genau nach Original 300.- mehr, mit Original-Hütte, jedoch lieferbar erst nach 5 Monaten 500.- mehr.“ Die Preisdifferenz zeige, so Britta Lange, „dass Originale deutlich von originalgetreuen Reproduktionen unterschieden wurden“ – und teurer waren. Nachdem die Exponate in die Museen gelangt waren, erfolgte nicht selten eine neuerliche (Um-)Erzählung – wie man sie z.B. dem „Informationsblatt des Hamburger Museums für Völkerkunde“ aus dem Jahr 1998 noch entnehmen kann, wo der Ankauf eines Ahnenhauses der Maori als Rettungstat seines ersten Direktors dargestellt wird, bevor der Kolonialismus diese „bedrohte Kultur“ (und seine ganzen Ahnenhäuser) endgültig zerstörte: „Die Geschichtsschreibung der Hamburger Institution vereint ‚edle Wilde‘ und den ‚edlen Museumsdirektor in einer Art Heilsgeschichte,“ schreibt Britta Lange.
Auch an der Echtheit der edlen Wilden gab es bald Zweifel. Nachdem eine Hagenbecksche „Indianer“-Schau ein finanzieller Mißerfolg geworden war, weil seine „Bella-Coola“-Truppe nicht dem „europäischen Bild von federgeschmückten Prärie-Indianern“ entsprochen hatte, und er sich schließlich aus dem „Völkerschau“-Geschäft zurückzog, schaffte J.F.G.Umlauff sich mit seinem „Weltmuseum“ eine neue Bühne für Völkerschauen, wo er u.a. Kameruner zeigte. An den bis dahin organisierten „Kamerunschauen“ hatte man kritisiert: Es waren gar keine Kameruner – die Veranstalter wollten damit bloß auf das Publikumsinteresse an dem gerade zur deutschen Kolonie erklärten Land spekulieren. Es handelte sich mithin um „Fälschungen“ (Fakes). Die Wissenschaft sah sich herausgefordert, die „ethnische Echtheit“ zu überprüfen.
Rudolf Virchow klagte: „Es wird immer mehr Scharfsinn dazu erfordert, Aechtes und Unächtes zu unterscheiden.“ Während das Feuilleton bei einer Völkerschau der Samoaner überzeugt war, das Publikum könne auf den ersten Blick erkennen, „daß es natürliche und keine einstudirte Künste“ seien, führte der Bühnenauftritt einer Gruppe kriegerischer „Amazonen“ aus Dahomé zu einer regelrechten „Untersuchung“ – durch die von Virchow gegründete „Berliner Anthropologische Gesellschaft“.
In Umlauffs „Weltmuseum“ wurden die zunächst als „Prachtgruppen“ oder „Schaugruppen“ bezeichneten Exponat-Ensembles fortan „Lebensgruppen“ genannt: „Die Figuren sollten ‚Leben‘ vorstellen…Sie konnten nur ‚originalgetreu‘, ’naturgetreu‘ oder ‚lebensecht‘ sein.“ Erst fertigte man sie aus Wachs und dann aus Pappmaché, manchmal wurden auch Menschen „ausgestopft“. In der Firma Umlauf wurden zwar nur Tiere präpariert, aber sie scheute sich nicht, ihren Kunden auch ausgestopfte Menschen anzubieten (die sie allerdings nicht selbst ausstopfte und nicht selbst ausstellte).
Der holländische Entwicklungshelfer Frank Westermann hat die Geschichte eines solchen Menschenexponats rekonstruiert – in seinem Buch „El Negro“. Dabei handelt es sich um ein 1830 in Südafrika gestorbenes „männliches Individuum des Betjuanavolkes“ , dessen Leiche die Pariser Konkurrenten von Umlauff – die Brüder Verreaux, auf einem Friedhof in Südafrika nachts ausgegraben und dann präpariert hatten. Das Exponat wurde von dem Direktor des Zoos von Barcelona Francisco Darder erworben, der es während der Weltausstellung in Barcelona 1888 in einem Café ausstellte, von wo aus „El Negro“ schließlich in das Darder-Museum für Naturgeschichte von Banyoles (nahe Barcelona) gelangte. Dort blieb er, bis man ihn am 8.9. 2000 – nach Protesten eines dunkelhäutigen Spaniers, die sich schnell international ausweiteten – zurück nach Südafrika expedierte, wo er ordentlich bestattet wurde.
Um seine Identität festzustellen, hatte man ihn 1993 autopsiert und – kurz vor seiner Rückkehr nach Afrika – noch „demontiert“, u.a. blieb seine „von Arsen und Schuhcreme durchtränkte Haut in Spanien“, ebenso sein Speer. Die Bewohner von Banyoles hatten auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung eine Bürgerinitiative gegen den Raub ihres „El Negro“ gegründet. Die dortige Leiterin des Museums begründete dies u.a. mit einer „Museumsethik“, die darin bestände, eine einmal existierende naturhistorische Sammlung vor Abgängen oder Verlusten zu schützen.
Der Autor Frank Westermann erwähnt eine weitere Afrikanerin, die so genannte „Hottentotten-Venus“ – Saartjie Sara Baartmann, die mehrere Sprachen sprach, zuerst lebend auf Völkerschauen in Europa auftrat und dann, nachdem sie in Paris gestorben war, der Wissenschaft diente. Kein geringerer als der Begründer der Rassenanatomie George Cuvier, der eine Skala vom „geistig schwerfälligen Neger“ bis zum „innovativen“ weißen Europäer aufstellte, erwarb ihre Leiche – nicht zuletzt wegen ihres sensationell ausladenden Hinterteils und ihrer an den Beinen herunterhängenden Schamlippen. Letztere präsentierte er während eines Vortrags stolz in Spiritus konserviert: „Ich habe die Ehre,“ so schloß Cuvier seine Rede, „der Akademie der Wissenschaften die Genitalien dieser Frau anzubieten“. 2002 wurden Saras Überreste – Skelett, Geschlechtsteile und Gehirn – ebenfalls in Südafrika beigesetzt.
Ein Jahr vor „El Negro hatte bereits ein deutscher Apotheker Carl Friedrich Drège eine Buschmannfrau ausgestopft. Sie hatte als „Dienstmagd“ bei Weißen in Südafrika gearbeitet und war „an Hunger und Kälte gestorben“, woraufhin man sie beerdigt hatte. Abends grub Drège sie wieder auf und versteckte sie zunächst unter Steinen. Nachts schlachtete er die Magd dann aus, wobei er ihre Haut sowie Schädel, Arm- und Beinknochen in einen Sack steckte und sich mit seinem Ochsen-Wagen davonmachte. 1842 wurde die Teile in Hamburg versteigert, zusammen mit anderen Posten Exotika – „als Nummer 1 in der Rubrik der Säugetiere“. Wer sie ersteigerte und wo sie jetzt ist, weiß man nicht. Erwähnt sei schließlich noch ein „eingepökelter Buschmann“, den der Apotheker Ludwig Krebs „für den König von Preußen“ 1830 in einer Tonne mit Salz nebst fünf Weckgläser mit Schlangen aus Südafrika nach Berlin zu seinem Bruder Georg schickte.
Auch über den Verbleib der Überreste dieses Afrikaners hat Frank Westermann nichts Näheres erfahren. Er kommt sodann auf die in Moskau 1924 präparierte Leiche von Lenin zu sprechen – die bis heute von vielen Touristen besucht wird. Ein südafrikanischer Student meinte jedoch – dem Autor gegenüber: Das könne man nicht mit den präparierten Leichen der Afrikaner in den europäischen Museen vergleichen, Lenin werde verehrt und befinde sich inmitten seines Volkes.
Dennoch gibt es auch in Russland seit Mitte der Achtzigerjahre eine Diskussion, ob man ihn nicht an seinem Geburtsort beerdigen und das Mausoleum abreißen soll. 1999 erschien dazu ein Buch von Ilya Zbarski, dem Sohn des Mausoleum-Gründers Boris Iljitsch Zbarski. Das Mausoleums-Laboratorium ging aus einer Initiative des Ausschusses für die Verewigung des Andenkens an Lenin hervor, der sich erstmalig am 5. März 1924 unter dem Vorsitz des KGB-Chefs Felix Dserschinski zusammensetzte. Nach dem Einmarsch der Deutschen in die Sowjetunion wurde es samt Leiche ins sibirische Tjumen ausgelagert und nach dem Krieg zügig zu einem „Weltzentrum der Einbalsamierung“ ausgebaut. Das heißt: Im Anschluß an die Konservierung der Leiche Stalins präparierten die Mitarbeiter des Laboratoriums auch die Kommunistenführer Georgi Dimitroff (Bulgarien), Tschoibalsan (Mongolei), Ho Chi Minh (Vietnam), Agostinho Neto (Angola), Lindon Forbes Burnham (Guyana) und Kim Il Sung (Nord-Korea) nach Art der ägyptischen Pharaonen: für die Ewigkeit. „Er trägt eine Uniform, und die eine Hand ist leicht zur Faust geballt. Selbst noch im Tode ist er der Diktator“, schreibt der junge Nehru 1929 nach einem Besuch im Lenin-Mausoleum. Heute trägt Lenin einen Anzug und eine gepunktete Krawatte.
Nachdem ihnen 1991 achtzig Prozent ihres Jahresbudgets gekürzt wurden, empfahl der Moskauer Bürgermeister Juri Luschkow dem Laboratorium, sich mit einem „Ritual Service“ halbwegs selbständig zu machen, also auch Einbalsamierungsaufträge von eher antikommunistischen Neureichen anzunehmen: „Angesichts der rasant ansteigenden Kriminalität – 25.000 Morde allein im Jahr 1996 – kam der Vorschlag wie gerufen“, schreibt der Autor. Die optische Wiederherrichtung dieser Privatverbrecher kostet – je nachdem, wie übel sie zugerichtet beziehungsweise zerschossen wurden – zwischen 1.500 und 10.000 Dollar. Im Gegensatz zu Lenin, der bis heute regelmäßig Balsambäder bekommt, werden ihre Leichen jedoch nicht dauerhaft konserviert, sondern nur für die Beerdigung präpariert. Anschließend kommen sie in Luxussärge, die Ritual Service ebenfalls im Angebot hat. Die Preise dafür schwanken zwischen 5.000 Dollar für einen Holzsarg made in USA und 20.000 Dollar für eine russische Kristallglasversion. Zur Verewigung der Gangster dient heute eine neue Grabsteintechnik. Dabei wird ihr überlebensgroßes Foto auf eine bis zu drei Meter hohe Granit- oder Malachitplatte gelegt und mit einem Spezialverfahren eingraviert. Die islamischen Banden (etwa in Jekaterinburg) bevorzugen Doppelporträts – auf beiden Seiten des Steins. Rund 65.000 Dollar zahlen sie dafür.
Das Gravurverfahren geht auf den in San Francisco lebenden Russen Leonid Rader zurück. In der Moskauer Literaturzeitschrift NLO versuchte Olga Matich eine erste kulturhistorische Würdigung dieser russischen Verewigungskunst – vom Bolschewistenführer Lenin bis zur postsowjetischen Mafia. Letztere rekrutiert ihre „Killer“ vor allem unter ehemaligen Profisportlern, Bodybuildern, Soldaten und Ex- KGBlern. Statt mit Orden sind sie mit „Emblemen des schnellen Abgangs“ ausgestattet – auf ihren Grabsteinporträts: Mercedes- Schlüssel, Handys, Markenturnschuhe. Olga Matich nennt das „Fotorealismus“, Ilya Zbarski spricht von einer Verewigung ihrer Alltagssituation: „Sie tragen meist einen Adidas-Trainingsanzug, die obligatorische Arbeitskleidung der russischen Mafiosi.“ Handelte es sich um einen Anführer oder Brigadier, bleibt er es auch als Toter so lange, bis sich in der Bande ein neuer herausgemendelt hat. An seinem Geburtstag und an seinem Todestag werden große Gelage am Grab veranstaltet – mit bis zu „mehreren tausend Personen“, schreibt Zbarski, der anscheinend bei der Begräbnisfeier des Jakaterinburger „Paten“ der Zentralnije-Bande, Oleg Wargin, dabei war.
Dieser ganze kostspielige Auferstehungsaufwand soll bewirken, daß der Betreffende über seinen Tod hinaus „große physische Kraft und ökonomische sowie politische Macht ausstrahlt“ – für seine Gegner ebenso wie für seine Bande beziehungsweise Partei. Den bisher teuersten Verewigungsluxus leistete sich laut Ilya Zbarski der Präsident der größten russischen Erdölgesellschaft, Lukoil, Wagit Alekperow, bereits zu Lebzeiten: Für 250.000 Dollar ließ er sich ein Mausoleum in Form des Tadsch Mahal bauen. Auch sein Grabsteinporträt darin ist bereits fix und fertig. Wenn Lenins Leiche längst zu Staub zerfallen ist, wird es noch wie neu aussehen: die Gravurtechnik soll angeblich 20.000 Jahre halten. Wenn schon nicht das Volk ihn verehrt, dann will er sich wenigstens selbst auf ewig ehren!
Lenin wird derzeit quasi ehrenamtlich balsamisch versorgt: Ein „Mausoleum-Fonds“ ermöglicht es, daß zweimal wöchentlich eine zwölfköpfige Wissenschaftlerbrigade anrückt, um die notwendigen Restaurationsarbeiten an seiner Leiche durchzuführen. Sie tauschen mal hier einen Fuß und mal da eine Hand aus, wird behauptet. Sein schon 1924 entferntes Gehirn soll angeblich ein Wissenschaftler in seiner Aktentasche nach Amerika verschleppt haben, um es dort zu versilbern. Ilya Zbarski äußert sich darüber nicht. Trotz der Privilegien, die er „in all den Jahren im Schatten und im Schutz des Mausoleums genoß“, plädiert er nun dafür, Lenins Überreste, die eigentlich nur noch aus Schädel und Knochen bestehen können, endlich „zu beerdigen“.
Einem weiteren sowjetischen Autor, dem heute in St. Petersburg lebenden Tschukschenschriftsteller Juri Rytcheu verdanken wir die Schilderung einer Völkerschau – auf der Weltausstellung von 1893 in Chicago – aus der Sicht eines der lebenden Exponate dort. Es handelt sich dabei um Rytcheus Großvater Mletkin, einem Schamanen aus der Siedlung Uelen, der mehrere Sprachen konnte und gelegentlich auf amerikanischen Walfangschiffen arbeitete. In Alaska lernt er den Kurator eines Museums für Naturgeschichte kennen – Alex Hrdlichka, der sich auf einer Sammelexpedition für die Weltausstellung befindet. „Der Anthropologe malte vor Mletkin ein zukünftiges Weltdorf aus…und er versprach ihm viel Geld, einfach dafür, dass er vor den n auf einer grünen Wiese saß.“ Mletkin willigte ein, mit zu kommen. In Chicago mußte er dann jedoch eine alte zerschlissene „Schamanenkleidung“ tragen – „und vor allem rohes Fleisch essen“. Einmal begrüßte ihn der US-Präsident. Mletkin erwiderte höflich seinen Gruß. „‚Sie sprechen Englisch?‘ fragte der Präsident verwundert und schaute fragend in die Runde. ‚Wie das? Mir wurde gesagt, Sie sind ein Wilder!'“
Auch die Chicagoer Presse bezweifelte, dass es sich bei dem Schamanen und einen „reinrassigen Tschukschen“ handele – er sei bereits zu sehr „von der Zivilisation verdorben“. Man sprach sogar von „Fälschung“. Mletkin mußte lachen, als er das las, aber langsam machte ihn das alles traurig: Die Journalisten, die ihn interviewten, interessierten sich nur für den „Frauentausch“ der Tschukschen und die warfen ihm „wie einem Tier Münzen zu“. Der Anthropologe versuchte ihn aufzuheitern: „Du hast großen Erfolg…Du bist die Sensation der Ausstellung. Wir sind stolz auf Dich….Das Publikum ist zum größten Teil wild und ungebildet. Du musst ihnen verzeihen.“ Nach einigen „Schamanenvorstellungen“ stieg Mletkins Ruhm noch, aber gleichzeitig konnte er nun manchmal kaum noch seine Wut zurückhalten. „Am schlimmsten waren die Kinder“: Sie bewarfen ihn mit Süßigkeiten und schrien „Nimm! Nimm!“. Mletkin wäre am Liebsten mit seinem Messer, mit dem er das gekochte Fleisch schnitt, auf sie losgegangen. „Er isst nur rohes Fleisch!“ erriet eine Mutter. „Kinder zeigt ihm, dass man auch Bonbons essen kann…Mit Grimassen und ausdrucksstarken Gebärden des Genusses begannen sie zu kauen, während Vater und Mutter immer wieder sagten: ‚Nimm! Nimm!'“ Schließlich sagten die Eltern verärgert: „Zum Teufel mit ihm. Wir gehen lieber zu den Papuas.“ „Au ja, zu den Papuas!“ riefen die Kinder und klatschten in die Hände.
Als die Weltausstellung zu Ende ging, war Mletkin heilfroh, er nahm sein Geld, kaufte sich anständige Kleider und einen Lederkoffer und fuhr nach San Francisco, wo er sich in eine Schwarze, der Schwester seines verstorbenen Freundes, verliebte – und ein paar Jahre blieb. Mit einer anderen anthropologischen Expedition fuhr er dann zurück in seine Heimat. Und wir dürfen heute rätseln, ob diese von seinem Enkel aufgeschriebene Geschichte einigermaßen „authentisch“ ist (klingt).
Die Hamburger Firma Umlauff hatte sich ebenfalls an der Weltausstellung in Chicago beteiligt. Und es gab dort auch „ethnographische Dörfer“, die u.a. Irland, Lappland, Japan, Dahomé, die Türkei und Österreich vorstellten. Umlauff präsentierte dort zwei „Inszenierungen von Lebewesen“ – von präparierten Fischen bis zu ausgestopften Orang Utans und Schimpansen, mit einem Tierpfleger als Wachsfigur daneben, der den Mitteleuropäer repräsentierte. Dazu erklärte Carl Hagenbeck der Chicagoer Presse: „Wer am Studium der Darwinschen Theorie interessiert ist, hat hier die Möglichkeit, den Fortschritt der Evolution bis zur höchsten Vollkommenheit nachzuvollziehen.“ Nach Beginn des Ersten Weltkriegs stellte die Firma Umlauff zunächst keine „Panoramen“ von wilden Völkern in ihrer „natürlichen Umgebung“ mehr aus, denen die Presse eine „qualitativ herausragende Lebenswahrheit“ bescheinigt hatte, sondern von den Feinden der Deutschen. Sie stellte sich damit in den Dienst der Kriegspropaganda, deren „Hauptaufgabe“ es wurde, „Feindbilder zu konstruieren, zu reproduzieren und mit entsprechender diskursiver Begleitung in Umlauf zu bringen.“
Dazu gehörten u.a. „Kriegsausstellungen“, die durch deutsche Städte wanderten und in denen man erbeutete Waffen und Uniformen zeigte. Daneben setzte aber z.B. der Betreiber eines „Schauschützengrabens“ auch Kriegsgefangene als Statisten ein. Britta Lange spricht hierbei von einem „Auftritt ‚echter Feinde, jedoch unter fingierten Bedingungen.“ Anläßlich einer „Beuteausstellung“ sprach die Vossische Zeitung in bezug auf die verschmutzten und zerschossenen Exponate – Rock, Patronentasche usw.. – von „echt – getragen von einem Menschen, der nun nicht mehr ist“. Britta Lange zieht hierbei einen Vergleich mit „Tierhäuten“, denn auch bei „der Kleidung der gegnerischen Soldaten“ war deren „Gefangennahme oder Tod die notwendige Voraussetzung für ihre Ausstellung.“ Für diese stellte die Firma Umlauff dann „Figuren“ her, die zu Kriegs-„Szenen“ arrangiert wurden: „Franzosen im Handgranaten- und Minenkampf“ z.B., aber auch „polnische Flüchtlinge“ (mit Pferd und Wagen). Sie wurden zudem von „Russischen Heeresnachzüglern“ überrascht. In der Russen-Abteilung gab es darüberhinaus „2 Tscherkessen, 3 Kosaken, 3 Sibirischen Schützen“, die ganz unkriegerisch mit Wodka und Balalaika einen „Nationaltanz“ veranstalteten: Sie gehörten zu den „beliebtesten Gruppen in Kriegsausstellungen,“ Heinrich Umlauff gelang es damit, „auch die asiatischen Ethnien in die Szene zu integrieren“. Die englischen Gruppen stattete er mit anschleichenden Indern und dolchbewaffneten Gurkhakriegern aus, die französischen mit „3 Senegalnegern, 2 Marrokanern, 2 Kongoneger“ – an einem „Lagerfeuer“ beim „Abkochen“.
Bei allen Figuren waren lediglich die Köpfe modelliert, die Körper bestanden aus einem hölzernen Gerüst, die Hände aus Hartpappmasse. Der Hohlraum zwischen der echten Kleidung und dem Holzgerüst wurde mit Seegras gefüllt. In den Kriegsausstellungen waren die „Kulturvölker“ und die „Naturvölker“ gleichberechtigt. Nach Kriegsende bot die Firma Umlauff jedoch keine Briten, Franzosen, Belgier und europäische Russen (d.h. „Kulturvölker“) mehr an. Das „Firmenangebot fiel wieder ins Schema der Kaiserzeit zurück“, so Britta Lange.
Sie – die Angehörigen der Kulturvölker – waren im Krieg sozusagen auf eine primitive Stufe zurück gefallen. Später wird man die Greuel mit „streßbedingter Regression“ erklären. Schon auf der Chicagoer Weltausstellung hatte die Firma Umlauff die Verbindung zwischen Mensch und Tier mit einer nahen Verwandtschaft von „Primitiven“ und Primaten veranschaulicht, wobei als „höchster Menschenaffe“ der Gorilla galt. Dieser wurde für Johannes Umlauff bald zu einer Obsession. Um 1900 hatte er von einem im deutsch kolonisierten Kamerun lebenden Jäger namens Hans Paschen die Überreste eines „Riesen-Gorillas“ erworben. Der Kaiser persönlich wünschte diese gefährliche „Bestie“ auf seiner „Jagdausstellung“ in Berlin zu sehen. Zur Authentisierung wurde dem Exponat Paschens Jagdbericht beigegeben: „Das ‚Ich‘ des Jägers steigerte die Glaubwürdigkeit der Geschichte und des ausgestellten Objekts,“ schreibt Britta Lange. Im Bericht heißt es indes wenig glaubwürdig, dass der Gorilla drei einheimische Treiber aus Yaounde erdrückte, bevor die Kugel des weißen Kolonialherren ihn selbst tötete.
In der Zeitschrift „Gorilla Journal“ fand sich 2005 ein weiterer Hinweis auf dieses Objekt, das nun im Britischen Naturkundemuseum steht. Zunächst hieß es „Gorilla gigas Haeckel 1903“, denn der berühmteste deutsche Darwinist damals, Ernst Haeckel, hatte den Gorilla sozusagen wissenschaftlich vereinnahmt. Die Autoren des Artikels im „Gorilla Journal“ berufen sich denn auch auf dessen Publikation, in der ein Photo abgedruckt wurde, das den erlegten Gorilla im Dorf Yaounde zeigt. Die Autoren bezweifeln jedoch, dass es sich dabei überhaupt um Yaounde handelt, zumal es in der Nähe der Siedlung keinen Wald (mehr) gibt. Heute heißt das Tier „Gorilla gorilla matschiei Rothschild“, denn der Bankier hatte ihn 1905 für sein „Tring Museum“ erworben – und dafür sogleich eine neue Unterart kreiert, die alle Gorillas aus Südkamerun umfaßte – und sich von den „Gabun Gorilla“ unterschied. Bei seiner Präparation hatten Johannes und Wilhelm Umlauff eine neue „verbesserte Methode“ angewandt: Sie „stellten eine Dermoplastik des Gorillas her: eine Kombination aus der originalen Haut (Epidermis) und einem aus Ton, Gips oder Pappmaché modellierten Körper (Plastik). Das dermoplastische Verfahren löste die Taxidermie im Deutschen Reich gegen Ende des 19. Jahrhunderts vor allem in den Museen ab.“
Sie ermöglichte es, „‚Leben‘ zu simulieren“. Wilhelm Umlauff bezeichnete sich fortan als „Künstler“ – das Attribut des „Künstlerischen“ steigerte den Marktwert der Exponate. „Der Tierbildhauer hauchte dem Objekt neues Leben“ ein. Die Zoologen kritisierten jedoch gerade den „gestalterischen Freiraum“ an den Dermoplastiken. Auch ein Jäger beschwerte sich bei der Firma Umlauf: der deutsche Botaniker und Gorillajäger Georg Zenker: Der Jäger sah „die Wildheit des Gorillas in der Dermoplastik nicht angemessen umgesetzt“. Auf der kolonialen Jagdausstellung 1903 in Karlsruhe präsentierte Heinrich Umlauff das Objekt neben „eingeborenen Menschen“, darunter einen „Krieger aus dem Hinterland von Kamerun“. Betrachter vermuteten, dass es sich dabei ebenfalls um eine Dermoplastik handele – also dass eine echte Haut mit einem unechten Körper verbunden wurde. „Die angestrebte ‚Lebensechtheit‘ jedoch, die täuschende Ähnlichkeit der Figuren mit lebenden Menschen, machte gleichzeitig auf ihre perfekte Konstruiertheit aufmerksam.“
Der Tierbildhauer Wilhelm Umlauff korrespondierte mit Ernst Haeckel, um nach einem in dessen Besitz befindlichen Ölgemälde, das zwei Vorfahren des Menschen zeigte, modellieren zu dürfen. Für Haeckel stellten sie das „missing link“ zwischen Primitiven und Primaten dar. Er selbst beließ es jedoch nicht bei dieser „Visualisierung von Fiktion“ – der Kopie ohne Original, sondern bemühte sich, Geld auf zu treiben für ein reales Experiment: „Er plante, Affen und Afrikanerinnen zu kreuzen, um den „missing link“ zu produzieren. Bereits Jean-Jacques Rousseau hatte solch ein Experiment vorgeschlagen. Und immer wieder hatten seit dem 17. Jahrhundert Europäer davon berichtet, dass Menschenaffen dunkelhäutige Frauen raubten und vergewaltigten. Nicht wenige Bildhauer hatten diese Greuelmärchen aus dem Busch zu Skulpturen geschlagen. In Präuschers Wiener Panoptikum wurde dann erstmalig gezeigt, dass und wie ein Gorilla eine weiße Frau raubte. Auch die Firma Umlauff blieb dem „populären Motiv Frauenraub treu“, schreibt Britta Lange. Auf einer Ausstellung in Argentinien 1910 ließen sie ihren Gorilla jedoch lieber wieder eine schwarze Frau rauben.
Kurz darauf, im Ersten Weltkrieg, begannen sie, erste Geschäftsverbindungen zum Film aufzubauen. Als Johannes Umlauffs Onkel John Hagenbeck eine Produktionsfirma gründete, wurde er als Ausstatter und wissenschaftlicher Berater für den Film „Darwin, Mensch oder Affe“ hinzugezogen. In dem 1. Teil dieser Trilogie raubt ebenfalls ein Gorilla – „d.h. ein Statist im Gorillakostüm“ – eine schwarze Frau. Das Filmplakat zeigte jedoch den Raub einer weißen Frau – und nahm so 1920 das berühmte King-Kong-Motiv vorweg. „Das Medium des Films ermöglichte, was das Medium der Ausstellung nicht leisten konnte: In dem ‚echten‘ lebendigen Menschen mit einer ‚echten‘ überzogenen Tierhaut fielen zwei Originale zusammen.“
Noch radikaler als der „Darwin“-Film von Hagenbeck trachteten 1928 die Bolschewiki nach der siegreichen Oktoberrevolution das „missing link“-Problem zu lösen, indem sie eine Expedition unter der Leitung von Ilja Iwanow, dem Erfinder der künstlichen Besamung, ausrüsteten, die auf einer französischen Naturforschungsstation in Guinea Schimpansenweibchen mit dem Samen von einem Afrikaner befruchten sollte. Nachdem dieses Experiment fehlgeschlagen war (tatsächlich ist erst seit 1975 erwiesen, dass das nicht geht), sollte es andersherum – d.h. mit dem Samen eines Schimpansen – an russischen Frauen ausprobiert werden. Dazu wurde in Suchumi am Schwarzen Meer eine Affenstation aufgebaut. Es fanden sich zwar mehrere Frauen, die dazu bereit waren, aber die Station besaß nur einen männlichen Affen und der starb plötzlich.
Hinter dem ganzen Experiment stand der kommunistische Wissenschaftsorganisator Otto Julewitsch Schmidt. Er war nacheinander Mathematiker, Polarforscher, Vorsitzender der psychoanalytischen Vereinigung in Moskau und Kosmologe, außerdem die ganze Zeit über Herausgeber der Sowjetischen Enzyklopädie sowie auch noch einer psychoanalytischen Bibliothek, daneben finanzierte er Sigmund Freuds Publikationen und wurde zum Leiter der Hauptverwaltung Nördlicher Seeweg ernennt. Berühmt wurde er, als sein Expeditionsschiff, die „Tscheljuschkin“ im Nordmeer sank und die Mannschaft „mit bolschewistischer Disziplin“ auf einer Eisscholle ausharrte, bis sie von Polarfliegern gerettet werden konnte. Otto Julewitsch Schmidt überstand wundersamerweise alle Säuberungen. In der BRD wurde mit der Studentenbewegung in den Sechzigerjahren vor allem seine Frau Vera bekannt – mit den einst von ihr quasi „erfundenen“ psychoanalytisch-orientierten „Kinderläden“.
Während des ersten georgisch-abchasischen Krieges nach dem Zerfall der Sowjetunion brachte die Schriftstellerin Swetlana Alexijewitsch die Affenforschung von Iwanow und Schmidt noch einmal in Erinnerung, als sie erwähnte: „In Suchumi wurde die Affenstation bombardiert. Nachts haben Georgier jemand verfolgt und geglaubt, es wäre ein Abchase. Sie verwundeten ihn, und er schrie. Dann sind Abchasen auf ihn gestoßen und haben geglaubt: ein Georgier. Sie sind ihm nach, haben geschossen. Gegen Morgen sahen alle, dass es ein verwundeter Affe war. Und stürzten zu ihm, um zu helfen. Einen Menschen hätten sie umgebracht.“
2005 kam überraschend auch die BILD-Zeitung auf die Kreuzungsexperimente in Suchumi zu sprechen, als sie einen „irren Geheimplan“ enthüllte: „Stalin züchtete Affen-Menschen für den Krieg“ – dazu zeigte das Blatt ein halbes Dutzend schwerbewaffnete Affenkrieger aus dem US-Film „Planet der Affen“.
2006 fragten sich zwei Kolleginnen von Britta Lange am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Julia Voss und Margarete Vöhringer in einem Aufsatz über das Moskauer „Darwin-Museum“: „Es scheint, als hätten die Aufklärer in Russland die Engführung des Vergleichs von Affe und Mensch im Sinn [gehabt]. Nur, zu welchem Zweck?“ Während es den reaktionären deutschen „Darwinisten“ um die nahe Verwandtschaft von „Primitiven“ und Primaten gegangen war, die sie z.B. gerne photographisch durch Gegenüberstellungen von „Negerkindern“ und Gorillababys demonstrierten, ging es im revolutionären Russland in den Zwanzigerjahren laut Voss und Vöhringer „um die Schließung des ‚missing link‘ zwischen Mensch und Tier“. Die Direktorin des Darwin-Museums Esperantia Ladygina-Kohts orientierte dabei – wie zuvor auch Darwin selbst – auf das Verhalten. Dazu zog sie ihren Sohn Roody zusammen mit einem jungen Schimpansen namens Jodi groß. Anschließend stand für sie fest, dass der Affe kein hinter dem Menschen zurückgebliebenes Wesen ist, sondern sein evolutionsbiologischer Vorfahre.
Für Voss/Vöhringer stand dieses Moskauer Verhaltensexperiment, wie auch das züchterische in Suchumi mit dem Schimpansen „Tarzan“ im Zusammenhang der bolschewistischen Schaffung des „Neuen Menschen“, der jedoch nicht als „alles übertreffender Übermensch, sondern als ein immer schon da gewesenes Urwesen konzipiert“ war. Davon ausgehend vermuten sie, dass „die neuen Kreuzungen aus Mensch und Affe“ dazu dienten, „Knechte des zukünftigen Geschlechts“ zu schaffen.
Deutschland hatte nach dem Ersten Weltkrieg seine Kolonien verloren. Wenigstens im Film wollte nun das Publikum aber erst recht exotische Länder und Abenteuer „erleben“. Die ehemaligen Kolonien wurden zu den „beliebtesten Schauplätzen“, wobei jedoch zumeist in Deutschland gedreht wurde. Auch dabei fragten sich die Zuschauer jedoch, „ob die Repräsentation eines Themas im Medium Film gerechtfertigt und wie gut oder korrekt sie ausgeführt“ war. „Wie bei den Lebensgruppen stand nicht die Tatsache der Repräsentation selbst in Frage, sondern deren Legitimität und Qualität,“ auch wenn der Spielfilm „nicht zur Sphäre der Wissenschaft, sondern zu der des Schaugewerbes zählte“. Die Firma Umlauff wurde mehr und mehr als Ausstatter tätig, wobei die Filmausstattung „stilecht“ sein sollte, also „echt“ wirken, ohne „echt“ zu sein. Zur Herstellung einer „‚lebensechten‘ Fremde“ griffen die Filmproduktionsfirmen von daher gerne auf jene Orte zurück, die auch schon vorher „zur Präsentation des Fremden gedient hatten: zoologische Gärten und völkerkundliche Museen.“ Inhaltlich ging es in den frühen Weimarer Filmen laut Britta Lange meist darum: „Deutsche oder Europäer reisen in die Fremde, um dort auf die Anderen zu treffen, in der anderen Welt Abenteuer zu erleben und dann geläutert und gestählt nach Hause zurückzukehren. Anstelle eines Erfolgs auf der politischen Ebene demonstrieren sie einen individuellen Erfolg.“
Wenn sein Fundus an Ethnographica für die auszustattenden Szenen nicht ausreichte, bat Heinrich Umlauff die Völkerkundemuseen um Leihgaben. Einen der Direktoren, die eine Beschädigung der Exponate befürchteten, forderte er auf, der neuen Zeit Rechnung zu tragen, da den Deutschen „die Welt wohl doch für einige Jahre verschlossen bleiben“ werde. Britta Lange meint, die „Verwendung originaler Ethnographica im Spielfilm schien eine Möglichkeit, seine seriösen Ansprüche zu demonstrieren. Darüber hinaus stabilisierte sie das Illusionsmedium: Der Film als technisches Medium versuchte sich selbst vergessen zu machen, indem er einen originalen Schauplatz inszenierte.“ Besonders positiv reagierte die Presse, wenn „echte“ Fremde als Statisten eingesetzt wurden. Für den Film „Die Herrin der Welt“ baute man in Berlin-Woltersdorf extra eine Barackensiedlung „für die ausländische Komparserie“ auf, die dann u.a. von einer Gruppe verstreut in Deutschland lebenden Kamerunern aus Duala bezogen wurde. Für die Massenszenen wurden dazu noch deutsche Statisten verpflichtet, die man mit „negerbrauner Farbe“ anmalte: „Ethnische Echtheit und ihre Vortäuschung waren auf der Leinwand nicht zu unterscheiden“. Für den „chinesischen Teil“ des Films holte Johannes Umlauff Komparsen aus dem russischen Gefangenenlager in Wünsdorf, wo er sich „die besten mongolischen Typen“ aussuchte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg schlug dort nebenbeibemerkt die Rote Armee ihr Hauptquartier auf, und nach ihrem Abzug 1990 quartierte man Rußlanddeutsche in das Lager ein – auch sie werden nun gerne als Statisten für Filme – wie „Stalingrad“ (1993) – angeheuert, wobei sie das „Fremde“ sowie „kommunistische Russen“ und „Feinde“ zugleich verkörpern. Für die Besetzung der Statistenrollen in dem Film „Indisches Grabmal“ wurden damals Russen aus dem Lager Wünsdorf genommen, die man dann zu „Indern“ machte – mithin wurden hier zwar „echte“ Ausländer geholt, aber nicht die „richtigen“. Britta Lange folgend, fügte „dies der ethnographischen Beliebigkeit eine neue Variante hinzu“. Dennoch lobte die Presse – z.B. an dem Film „Der goldene See“ von Fritz Lang – „die alten Mayabauten, die Sitten und Kostüme“, die unter Mithilfe „hervorrragender Gelehrter mit einer Echtheit rekonstruiert“ wurden, „wie sie nur mit deutscher Gründlichkeit möglich ist“. Britta Lange meint dagegen: „Der Film nimmt sich wie eine Kombination aus Völkerschau und Photographie aus“.
Heinrich Umlauff wirkte 1923/24 in einem weiteren Film von Fritz Lang als Ausstatter mit: „Die Nibelungen“. Hier stellte sich ihm das Problem der „lost race“, d.h. es gab z.B. für die Hunnen keine Relikte oder Objekte in deutschen Museen. Die Hunnen gehörten für die Drehbuchautorin, Fritz Langs Ehefrau Thea von Harbou, zur „mongolischen Rasse“. Und diese war für sie „minderwertiger“ als etwa die „nordische Rasse“. Als Komparsen wurden auch hier wieder Russen und Kosaken engagiert. Auf den „Film-Kurier“ wirkten diese „Hunnen“ dann – in Fetzen und Fellen gekleidet, mit Beilen bewaffnet und gröhlend – „wie eine Horde alkoholisierter Gorillas“. Als ihr König Etzel eine weiße Frau, Kriemhild – die Witwe Siegfrieds, Königstochter von Burgund – empfängt, schickt er seine barbarischen Untertanen aus der Hunnenhalle und nähert sich ihr mit äußerstem Respekt „gebeugtes Knie vorschiebend, nicht wissend, daß er’s tat“, so Harbou. Als er des schmutzigen, nassen Bodens in seinem schaurigen „Palast“ gewahr wird, nimmt er seinen Königsmantel ab und breitet ihn „wie einen Teppich“ vor ihr aus: „Er legt das Barbarentum buchstäblich und zeichenhaft ab,“ schreibt Britta Lange.
„Dem Medium Film gelingt es, die Entwicklung vom ‚Barbaren‘ zum ‚Zivilisierten‘ zu zeigen“, einen kurzen „Prozeß der Zivilisation“ also, der durch die Liebe Etzels zu Kriemhild ausgelöst wird. Heinrich Umlauff starb kurz nach Fertigstellung des Nibelungenfilms. Er trug wesentlich mit dazu bei, dass auch in diesem neuen Medium die Argumente „echt“, „unecht“ und „lebensecht“ überlebten. Die „Filmwoche“ schrieb 1924 über den bis dahin teuersten Defa-Film „Die Nibelungen“: „Ein geschlagenes Volk dichtet seinen kriegerischen Helden ein Epos in Bildern, wie es die Welt bis heute kaum noch gesehen hat – das ist eine Tat! Fritz Lang schuf sie und ein ganzes Volk steht ihm zur Seite…Dieses Kunstwerk wird in Deutschland nur getragen werden vom Nationalbewußtsein unseres Volkes…Er ist aus unserer Zeit geboren, der Nibelungenfilm, und nie noch haben der Deutsche und die Welt ihn so gebraucht wie heute…Wir brauchen wieder Helden.“ Die Nazis waren später dem Regisseur derart dankbar für diesen Film, dass Goebbels ihn zum „Ehrenarier“ ernennen wollte. Fritz Lang zog es jedoch vor zu emigrieren, seine Frau blieb in Deutschland – und arbeitete dann im Propagandaministerium.
Johannes Umlauff verkaufte in den Dreißigerjahren vor allem Schädel und Skelette an die Institute für Rassenkunde in Berlin-Dahlem und Tübingen. Nach dem Krieg konzentrierte er sich „auf die Belieferung von Schulen und Krankenhäusern“, das Geschäft ging jedoch immer schlechter, als er 1951 starb, führte es niemand weiter. Die letzte Tochter von Heinrich Umlauff verkaufte weiter Ethnografica, aber mit ihrem Tod 1974 „erlosch“ auch das Stammunternehmen „J.F.G. Umlauff“ – nach über 100 Jahren.
Neben und aus den Völkerschauen mit echten „Wilden“ heraus war auch ein Bedarf nach dem (kultivierten) Genuß von exotischen (und zugleich erotischen) Tänzerinnen entstanden. Weltberühmt wurden in diesem Zusammenhang die beiden Tänzerinnen Josephine Baker und Mata Hari. Bei den Auftritten der letzteren handelte es sich ebenfalls um reine Fakelore.
Im „Fryslan“, dem Magazin für Geschichte und Kultur der friesischen Genossenschaft zu Leeuwarden, schreiben die Autoren Wim van Driel und Klaas Zandberg – über die aus Leeuwarden stammende Margaretha Geertruida Zelle: „Die Verbindung von Erotik, Spannung, Drama und Unschuldsvermutung gaben immer wieder aufs Neue Stoff für Bücher und Filme – über Mata Hari, die wohl bekannteste Friesin aller Zeiten“.
Bereits 1975 stellte die Verwaltungshauptstadt der Provinz Fryslan, Leeuwarden, ein kleines Denkmal vor Margreet Zelles Geburtshaus auf, das sie als Nackttänzerin Mata Hari zeigt. Und im Fries Museum Leeuwarden gibt es eine Dauer- Ausstellung über die 1917 als Doppelagentin hingerichtete Huthändler-Tochter. Sie wurde am 7.August 1876 geboren. Ihr Vater scheint sie sehr verwöhnt zu haben: „Großes Aufsehen erregte sie in der Stadt, als sie mit einem eigenen Ziegenwagen durch die Straßen fuhr“. Adam Zelle liebte es, Margreet, Griet genannt, als exotische Prinzessin auszustaffieren. Er war ein angesehener Kaufmann, sogar einmal Fahnenträger der Ehrenwache beim Besuch des Königs 1873. Anschließend ließ er sich vom Leeuwardener Maler A. Martin porträtieren. 1889 mußte er jedoch Konkurs anmelden und seine Familie fiel auseinander. Margreet zog nach Leiden, wo sie eine Kindergärtnerinnenausbildung begann. Dort verliebte sich aber der Direktor in sie. Man zwang daraufhin das „friesische Flittchen“, die Schule zu verlassen.
Margreet zog zu einem Onkel nach Den Haag. Dort las sie in einer Heiratsannonce „Offizier mit Urlaub aus Ostindien sucht Mädchen mit liebem Charakter, um eine Ehe einzugehen“. 1895 lernten sich die beiden kennen – und heirateten sogleich. Zunächst lebte das Ehepaar MacLeod in Amsterdam, wo Margreet ihr erstes Kind, Norman, gebar. Danach zog die Familie nach Indonesien, wo sie ein zweites Kind, Jeanne, genannt „Non“, bekam. Dennoch paßte Margreet „nicht in die Zwangsjacke der Frau eines Offiziers in Ostindien, und er betrachtete ihr unabhängiges Benehmen als Ehebruch“. 1899 starb ihr Sohn. 1902 kehrte die Familie in die Niederlande zurück, wo Margreet die Scheidung beantragte. Zwar wurde ihr die Tochter zugesprochen und ihr Mann mußte für den Unterhalt aufkommen, aber erst zahlte er nicht und dann weigerte er sich, „Non“ herauszurücken. Sie sah danach ihre Tochter nur noch einmal kurz im Jahr 1905 auf dem Bahnhof von Arnheim.
Nach der Scheidung war Margreet 26 Jahre alt – und mußte „wieder von vorne beginnen“, wie das Fries Museum Leeuwarden schreibt. Sie ging nach Paris! Einem Interviewer erklärte sie später: „Ich dachte damals, daß alle Frauen, die ihren Ehemann verließen, nach Paris gingen“. Beim ersten Mal scheiterte sie – und kehrte mittellos in die Niederlande zurück. Beim zweiten Mal, 1904, nahm sie dort Tanzunterricht. Bereits ihr Debüt – als orientalische Tänzerin „Lady MacLeod“ im Salon der Baronin Kirejewsky war ein Erfolg: Es folgten weitere Auftritte in Privatsalons. Schließlich wurde sie vom Besitzer eines privaten Museums für asiatische Kunst, Guimet, eingeladen. Dort sollte am 13. März 1905 ihr erster öffentlicher Auftritt stattfinden, vorher dachten sich Guimet und Margreet einen neuen Künstlernamen für sie aus: „Mata Hari“ – „aufgehende Sonne“ auf Malayisch. Das Fries Museum merkt dazu an: „Es ist der Anfang einer faszinierenden Karriere. In der Presse erscheinen lobende Kritiken…Einige Journalisten sind ein wenig kritisch über ihre Tanzkunst, aber die Tatsache, daß sie völlig nackt tanzt, macht viel Eindruck. Die Welt liegt ihr zu Füßen“.
In den Interviews mit der „indischen Tänzerin“ erfindet Margreet immer neue Geschichten über ihre Herkunft und ihre Initiation als Tempeltänzerin. Bereits ein Jahr später,1906, nach einem Auftritt in der Oper Monte Carlos im Ballett „Le Roi de Lahore“ von Jules Massenett, ist sie die am besten bezahlteste Tänzerin Europas, über die zudem am meisten gesprochen und geschrieben wird. Margreet nimmt sich einen Agenten. Dennoch „ist das hohe Tempo nicht durchzuhalten,“ so die friesischen Museologen: „Sie beschließt, sich etwas mehr Ruhe zu gönnen, sowohl in bezug auf Auftritte als auch in bezug auf die Männer. Jeweils nur ein Geliebter und für längere Zeit“. Im Sommer 1906 ist das der Berliner Großgrundbesitzer und Leutnant Kiepert. Er mietet für sie ein Apartment in Kurfürstendamm-Nähe. Zwei mal tritt sie in dieser Zeit mit ihrer „indischen Nummer“ in Wien auf. Eine Zigaretten- und eine Teesorte werden nach ihr benannt. Daheim in Leeuwarden versucht auch ihr Vater, an ihrem Ruhm zu partizipieren: Er veröffentlicht ein Buch „voller Erdichtungen und Phantasien“ über seine Tochter.
Margreet unternimmt weite Reisen – u.a. nach Ägypten. Anschließend tritt sie in Paris mit neuen Tänzen auf – hauptsächlich auf Wohltätigkeitsveranstaltungen. 1910 tanzt sie in Monte Carlo den „Danse du Feu“ in der Oper „Antar“ nach der Musik von Rimsky-Korsakov. Der Bankier Rousseau mietet das Chateau de la Dorée bei Tours für sie an und begleicht alle Rechnungen. In der Saison 1911/12 tritt sie in zwei Balletten der Mailänder Scala auf. Den darauffolgenden Herbst wohnt sie in einer Villa bei Paris, wo sie einige Male im Garten auftritt, begleitet von einem Orchester unter der Leitung von Inayat Khan, dem Begründer der Sufibewegung. Ihr Gönner, der Bankier Rousseau, muß Konkurs anmelden, Margreet ist gezwungen, wieder für Geld zu tanzen, nebenbei arbeitet sie in mehreren Bordellen gleichzeitig.
Als „spanische Tänzerin“ tritt sie in einer Revue des Folies-Bergere auf. Anfang 1914 ist sie wieder bei ihrem Geliebten Kiepert in Berlin. Bevor sie im Metropoltheater tanzen kann, bricht der Krieg aus. Margreet läßt sich in Den Haag nieder. Der Baron und Kavallerieoffizier Van der Capellen hält sie aus. Sie reist von Hauptstadt zu Hauptstadt. „Im Frühjahr 1916 muß sie mit dem deutschen Geheimdienst in Kontakt gestanden haben,“ heißt es vorsichtig im Fries Museum. Die Deutschen geben ihr den Codenamen „H-21“ – und 20.000 Francs Vorschuß. Im Juli 1916 ist sie wieder in Paris, wo sie sich in den jungen, aber wenig begüterten Vadime de Masloff verliebt, einen Hauptmann des ersten Russischen Kaiserlichen Regiments. Daneben aber auch noch in nicht weniger als 11 Offiziere – aus sieben Ländern: „Ich liebe Offiziere. Mein größtes Vergnügen ist es, mit ihnen zu schlafen, ohne an Geld zu denken“, wird sie sich später verteidigen, um den Spionagevorwurf zu entkräften.
Dann lernt sie auch noch den Leiter des französischen Geheimdienstes, Hauptmann Ladoux kennen. Er macht ihr den Vorschlag, für Frankreich zu spionieren – in Brüssel. Auf dem Schiffsweg – über Spanien – wird sie in England von Bord geholt, weil man sie für die deutsche Spionin Clara Bendix hält. Margreet erzählt Scotland Yard von ihrem französischen Auftraggeber Ladoux. Dieser rät den Engländern daraufhin, sie nach Spanien zurückzuschicken – was auch geschieht. In Madrid trifft sich Mata Hari mit dem Militärattaché der deutschen Botschaft, von Kalle. Am 2.Januar 1917 fährt sie nach Paris, wo sie Ladoux besucht, der bestreitet jedoch, mit ihr ein Arrangement getroffen zu haben. Fünf Wochen später verhaftet man sie in ihrem Hotel Elysées Palace.
Ein Militärgericht klagt sie „prodeutscher Spionageaktivitäten“ an – und befindet sie schließlich für schuldig. Ein Gnadengesuch des niederländischen Außenministeriums wird abgewiesen. Am 15.Oktober 1917 tritt sie vor ein zwölfköpfiges Erschießungskommando. Ihre Haltung – „bis zuletzt“ – nötigt den Zeugen Respekt ab.
Kürzlich legten die Mata Hari Foundation und ihre Geburtsstadt Lieuwarden neue Beweise für ihre Unschuld vor – und verklagten den französischen Staat. Ihre Recherchen basieren auf ein zweibändiges Werk über Mata Hari, das der 92jährige Résistance-Held Léon Schirmann zuvor veröffentlicht hatte: „L’Affaire Mata Hari: autopsie d’une machination“
Über die „Nackttänzerin“ Josephine Baker zeigte „arte“ gerade einen Film über ihr Leben. Die „Venus Noire“ war die uneheliche Tochter eines schwarzen US-Jazzmusikers und einer Wiener Waschfrau. Sie arbeitete zunächst als „schwarze Perle“ – d.h. als Dienstmädchen. Ihre ersten Auftritte hatte sie in den USA – in der „Revue Nègre“, in Paris eröffnete sie sodann ihren ersten Nachtclub. Berühmt wurde sie dort aber vor allem durch ihren Auftritt in den Folies-Bergère – nur mit einem Röckchen aus 16 Bananen bekleidet. Daneben spielte sie bald auch in einem „exotischen Kinofilm“ mit: „La Sirene des Tropique“. In Wien werden während ihrer halbnackten Auftritte Buß-Sondergottesdienste abgehalten, in München bekommt sie 1928 Auftrittsverbot. Zurück in den USA stößt sie auch hier auf Ablehnung: die New York Times bezeichnet sie als „Negerschlampe“. Josephine Baker kehrt nach Paris zurück und heiratet den jüdischen Großindustriellen Jean Lion, woraufhin sie die französische Staatsbürgerschaft erhält.
In der Düsseldorfer Naziausstellung „Entartete Kunst“ wird neben der Jassmusik auch Josephine Baker diffamiert. Nach dem Einmarsch der Deutschen in Frankreich schließt sie sich dem Widerstand an. Angeblich betrieb sie auch Spionage, sicher ist, das sie der Résistance 4,5 Millionen Francs aus ihrem Vermögen spendete. Nach dem Krieg bekam sie mehrere Orden von der Regierung De Gaulles verliehen: den „Croix de Guerre“ und die „Medaille de la Résistance“. Bei ihrer Amerika-Tournee 1951 weigert sich Baker vor nach Rasse getrenntem Publikum aufzutreten oder in nach Rasse aufgeteilten Hotels zu schlafen. Sie erreicht die Öffnung einiger Einrichtungen für Afro-Amerikaner. Dafür wird sie von der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) zur herausragendsten Frau des Jahres ernannt. In den Sechzigerjahren engagiert sie sich – auch finanziell – in der Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen in den USA.
1963 tritt sie zusammen mit Martin Luther King auf einer großen Protestversammlung in Washington vor das Mikrophon. In Paris nimmt sie fortan bei ihren Auftritten vor allem französische Chansons in ihr Repertoire auf, ihren letzten Bühnenauftritt hat sie am 11.April 1975 – in der darauffolgenden Nacht stirbt sie.
Zurück zu den „Völkerschauen“: 1967 war es zu der „anthropologischen Sensation des Jahrhunderts“ gekommen, die das Problem von „echt“, „unecht“ und „lebensecht“ noch einmal anreicherte: Im philipinischen Urwald entdeckte man lebende Steinzeitmenschen – die Tasaday. Schon bald wurden eine ganze Reihe Bestseller über sie veröffentlicht – von zumeist amerikanischen Anthopologen und Journalisten. 200 US-Fernsehgesellschaften, die Redaktionen von Geo und National Geographic und tausend andere setzten sich in Marsch. Sie mußten viel Geld zahlen: das meiste allein dafür, dass der philipinische Minister für kulturelle Minoritäten – Manuel Elizade – ihnen einen Besuch bei den „Höhlenmenschen“ auf Mindanao erlaubte. Er wählte aus, wer wie lange per Hubschrauber ins Reservat durfte, Prominente wurden bevorzugt: Gina Lollobrigida und Charles Lindbergh z.B., aber auch Deutschlands führender Humanethologe Irenäus Eibl-Eibesfeldt.
Erst kürzlich kam heraus, dass es sich bei den Tasadays um 26 „gedungene Statisten“ handelte. Sie stammten aus Ubo- Dörfern in der Nähe, wurden von einem US-Paläolithiker namens Robert Fox ausstaffiert und dann vom Minister Elizade in die Berghöhle gesteckt, die er fortan von seinen „Bodyguards“ bewachen ließ. Fox und Elizade veröffentlichten auch den ersten umfassenden Report über die „Tasadays“. Zwei von ihren Bewachern brachte Elizade einmal – als Tasaday verkleidet – nach Manila, wo sie US-Präsident Carter vorgeführt wurden. Die „richtigen Steinzeitmenschen“ hatten zu viel Angst vor der Reise gehabt. Da diese jedoch schon ein Fake waren, stellten ihre Bewacher gegenüber dem US-Präsidenten den Fake eines Fakes dar. Der Journalist Christian Adler, der darüber von 2004 bis 2006 fortlaufend in der von einer Biologin – Hannelore Gilsenbach – redigierten Zeitschrift für „Naturvölker heute – Bumerang“ berichtete, hat die Tasadays wie seinerzeit der Kurator Luschan die „Benin-Bronze“ der Firma Umlauff von allen Seiten auf ihre „Echtheit“ hin geprüft.
So arbeiteten die „Höhlenbewohner“ z.B. mit echten Steinwerkzeugen, die angeblich von ihren Vorfahren stammten (in Wahrheit aber wohl von Dr. Fox), diese unterschieden sich jedoch „enorm von den völlig unbrauchbaren Stücken, deren Herstellung sie verschiedenen Journalisten vorführten.“ Um alte und neue Porträtphotos von den Ubo/Tasadays zu identifizieren, wurde sogar das Bundeskriminalamt um ein Gutachten ersucht. Auch die Entlarvung der Sensation – „lebende Steinzeitmenschen entdeckt“ – sollte eine Sensation werden: Der Journalist wollte sie ursprünglich im „stern“ veröffentlichen.
Inzwischen passieren jedoch laufend solche Volks-Fakes: So entlarvte der „Spiegel“ kürzlich einen ewenkischen Original-Schamanen, der auf Ausstellungen in Paris und Genf auftrat, als einen simplen Ex-Matrosen aus dem Fernen Osten. Ausstaffiert und finanziert hatte ihn der russische Ölkonzern Yukos, der inzwischen „80% des Budgets in der ewenkischen Republik bestreitet, Schneemobile an die Eingeborenen verteilt“ und überhaupt alles tut, als sei dieses kleine sibirische Volk in seinem Ölfördergebiet bestens aufgehoben. Ihr Chef, Chodorkowski, sitzt inzwischen in einem sibirischen Arbeitslager, jedoch nicht wegen des Schamanenfakes, sondern weil er den Konzern ins Ausland verschieben wollte, im Westen spricht man von einem „unfairen Prozeß“.
Die o.e. Wissenschaftshistorikerin Julia Voss veröffentlichte im Januar 2006 in der FAZ einen Artikel, in dem es um touristische Abenteuerreisen zu Fake-Völkern geht – konkret zu „Kannibalen“ auf Papua-Neuguinea. Die Reisen werden von der Agentur „Papua Adventures“ angeboten. Der Fälscher ist hier wieder ein Amerikaner: Kelly Woolford. Er „verspricht Erstkontakt mit angeblich noch unentdeckten Stämmen. Teilnehmer zahlen bis zu 12.000 Dollar. In der Neuen Zürcher Zeitung erschien bereits ein erster Reisebericht: „Ferien bei den Kannibalen“. Der Autor berichtete: „Nach ein paar Tagen Fußmarsch, während derer Woolford die Reisenden mit Schaugeschichten füttert, werden sie angegriffen. Wenig bekleidete Menschen schießen Pfeile ab und verschwinden. Das war’s. Niemand verletzt, kein Wortwechsel, kein Besuch von Siedlungen, keine zweite Begegnung. Woolford behauptet nun, die Reise sei zu gefährlich geworden, bricht ab – und da fliegen sie wieder alle zurück.
Am Ende hat der Autor also viel erzählt bekommen, aber nicht viel gesehen…Trotzdem glaubt er, Wilde gesehen zu haben.“ Julia Voss fragte sich anschließend: „Warum kommt ihm nicht die naheliegende Idee, das Ganze könnte inszeniert sein? Könnte es sein, daß der Reporter hereingelegt wurde? Daß die sogenannten Wilden nur die Wilden spielen? Und daß andererseits die wirklich Unzivilisierten in diesem Spiel die Touristen sind?“ Einige auf Papua-Neuguinea spezialisierte deutsche Ethnologen bestätigten ihr quasi, dass es sich dabei garantiert um einen „Fake – eine Art „Kostümfest für spendierfreudiges Touristenpublikum“ – handelte (das übrigens bereits bis 2007 ausgebucht ist).
Einen Vorgeschmack auf solche Reise gab bereits der Hollywoodfilm „Abenteuer in Neu-Guinea“ (1970) mit Burt Reynolds in der Hauptrolle. Es geht darin um die Suche nach dem „missing link“, das schließlich in einer „Danger Zone“ gefunden wird: die neuentdeckte Gruppe von Lebewesen heißt „Tropies“ – und es entbrennt ein Streit darum, ob sie Menschen oder Affen sind. Zwar wäre laut Julia Voss Woolford „nicht der erste Karl May der Tourismusbranche“, aber ein „Skandal“ ist es doch: „Er besteht in den gewählten Mitteln: der Verleumdung von anderen Kulturen als Kannibalen oder Steinzeitmenschen.“ Da jedoch die Menschenfresser eine bloße Erfindung von Kolonialisatoren sind, könnte man umgekehrt auch sagen: „Eine Reiseveranstalter, der Kannibalenabenteuer verspricht, ist mit Sicherheit unseriös.“ Es zeige sich daran nur „die alte hässliche Fratze des Kolonialismus im Zeitalter des Tourismus“.
Die Attribute des „Echten“, „Unechten“ und „Lebensechten“ existieren also auch hierbei fast unangefochten weiter – allerdings werden dazu immer neue – noch unverschämtere – Varianten produziert, die auf ihre „Entlarvung“ durch seriöse Wissenschaftler warten. Und dabei muß man froh sein, dass eine solche Aufklärung überhaupt noch möglich ist, denn – wenn man dem Kulturphilosophen Slavoj Zizek folgt, dann ist die „Illusion“ schon längst „auf der Seite der Realität selbst, auf der Seite dessen, was Menschen tun“. In diesem Fall wäre z.B. der echte „Kannibale von Rothenburg“ (an der Wümme), über den besonders in den afrikanischen Medien ausführlich berichtet wurde, bloß noch ein Witz. Im „Bantou Village“ in der Weddinger Kamerunstraße wurde tatsächlich nur noch so darüber geredet – gewitzelt.
Aber schon bahnt sich die nächste Fakelore an: Im Mai 2006 traf sich der Leichenpräparator Gunther von Hagens in Moskau mit einem hochrangigen Regierungsbeamten, um über die Leiche Lenins zu verhandeln, die von Hagens laut Spiegel „erkennbar als den großen Kommunistenführer in seinen Ausstellungen präsentieren“ möchte. Neuerdings hat er laut BILG-Zeitung auch noch Interesse an der Präparierung des in Bayern erschossenen Bären „Bruno“ bekundet. Von Hagens wurde mit einem neuen Präparationsverfahren berühmt, dass er an der Universität Heidelberg entwickelte – und patentieren ließ: die „Plastination“. Inzwischen ist er damit auch reich geworden – und besitzt Firmen in China, Kirgisien, Heidelberg, Guben und Gibraltar, die jährlich hunderte von menschlichen Leichen ganz oder teilweise präparieren – und zu (medizinischen) Schulungszwecken, vornehmlich nach Arabien, verkaufen. Daneben organisiert der „umstrittene Plastinator“, der stets mit einem Beuys-Hut auftritt, Wanderausstellungen mit immer gewagteren Mensch- und Tierpräparationen, die er „Körperwelten“ nennt. Dabei laviert er – ähnlich wie die Firma Umlauff seinerzeit – geschäftstüchtig zwischen Wissenschaft und Schaustellerei.
2003, als seine „Körperwelten“ in Hamburg auf der Reeperbahn im ehemaligen „Erotic-Art-Museum“ gezeigt werden sollten, versuchte die Stadt seine „grenzüberschreitende“ und „skandalöse Show“ sogar zu verbieten. Der Direktor des Lübecker Instituts für Anatomie urteilte über die Ausstellung, die von Hagens als „Faszination des Echten“ bewirbt: „Das ist Grusel statt Aufklärung.“ Aber trotz oder gerade deswegen kamen allein zu seiner Hamburger Präsentation dann über 700.000 Besucher. In der Presse warf man von Hagens vor, für seine „Plastinate“ Leichen aus russischen und chinesischen Arbeitslagern bezogen zu haben, bei letzteren soll es sich nicht selten um „frisch Hingerichtete“ handeln. Der „Plastinator“ bedauert das – die gewissermaßen unsaubere Herkunft bereite ihm „ethische Bauchschmerzen“, aber er bekomme die Leichen „streng anonymisiert“ – das bleiben sie auch und wenn ihre Teile in alle Welt gehen, dann ist ihre „Identität“ sowieso „irreversibel zerstört“. Im übrigen werden in allen Universitäten „herrenlose Leichen“ verwendet. Bei Lenin würde er aber wohl am Liebsten eine Ausnahme machen. Seine Frau, Dr. Whalley, hatte daneben auch schon der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis angeboten, ihren kurz zuvor verstorbenen Mann, zu plastinieren. Die Fürstin lehnte jedoch ab.
Die Plastination wird von den beiden Präparatoren als ein „wertschöpfendes Kunsthandwerk“ begriffen. Im Gegensatz zu den „Lebensgruppen“ der Firma Umlauff geht es von Hagens dabei jedoch nicht um „Menschentypen“, sondern um zumeist anatomisch aufbereitete Körper bzw. Teile und (deformierte) Organe. Heinrich Umlauff hatte nur aus Tieren Dermoplastiken angefertigt, von Hagens arbeitet dagegen vor allem mit „echten“ Menschen, wobei er eine neue Verbindung von natürlichem und künstlichem Material erfand.
Sein „Plastinationsverfahren“ besteht darin, dem toten Körper bei minus 20 Grad das Wasser zu entziehen und mit Aceton zu füllen. Anschließend wird die Leiche in eine Vakuumkammer gelegt, aus der langsam das verdampfende Lösungsmittel entfernt wird, dadurch entsteht ein Unterdruck im Präparat, in das nun flüssiger Silikatkautschuk gegeben wird. Zuletzt erfolgt die „Positionierung“ des Körpers, der nunmehr ein Gemisch aus Kunststoff und Naturresten ist. Bei ganz „frischen Leichen“ laßt sich auch ein so genanntes „Korrosions-„Verfahren anwenden – bei dem das Kunststoff direkt in die Blutgefäße und Zelle gespritzt wird. Anschließend muß das Präparat manchmal monatelang in ein „Bakterienbad“ gelegt werden, bis die Einzeller die Bioreste um das Silikatkautschuk verdaut haben. Dabei können einem anscheinend viele Fehler unterlaufen: Gerade die „Ganzkörper-Plastination“, schreibt von Hagens in seinem Ausstellungskatalog, ist „eine intellektuelle und bildnerische Leistung, bei der man das Ergebnis schon zu Beginn vor dem inneren Auge haben sollte, wie der Künstler die Statue.“
Als eher „solides Handwerk“ bezeichnet der Spiegel dagegen seine „Scheibenpräparate“ von Organen z.B.. Dabei wird statt des flexibel bleibenden Siliconkautschuks aushärtendes Expoxidharz in das Präparat gepumpt. Daneben werde – in von Hagens Hagens chinesischer Fabrik – auch noch viel „gebastelt“ – wobei nur „Qualitätsmaterial“ Verwendung findet, d.h. die Präparatoren dort machen aus Teilen von mehreren minderwertigen Leichen ein hochwertiges Plastinat. Das hört sich schon fast wie ein Fälschungsvorwurf an. Der Spiegel moniert darüberhinaus aber auch noch, dass von Hagens, indem er „mit Kunststoff und Kleber modelliert, so etwas wie Gott spielt“ (darüberhinaus werden die Objekte hand-„koloriert“). Mit dieser Versuchung haben aber auch schon die Renaissancekünstler gerungen, als es darum ging fest zu stellen, wer von ihnen am „Lebensechtesten“ malen konnte. Den Philosophen Vilèm Flusser brachten ihre „Legenden“ auf die Idee, dass die „wahre Kunst“ erst jetzt beginne – mit der Gentechnik: Erst mit ihr „sind selbstreproduktionsfähige Werke möglich“.
Literatur:
Britta Lange: „Echt. Unecht. Lebensecht. – Menschenbilder im Umlauf“, Kulturverlag Kadmos, Berlin 2006; und „Einen Krieg ausstellen, Verbrecher Verlag, Berlin 2003
Frank Westermann: „El negro – Eine verstörende Begegnung“, Chr. Links Verlag Berlin 2005
Berggorilla und Regenwald Direkthilfe: „Gorilla Journal“ Nr. 30, Mühlheim, Juni 2005
Swetlana Alexijewitsch: „Im Banne des Todes“, S.Fischer Verlag Frankfurt/Main 1994
Ilya Zbarski: „Lenin und andere Leichen“, Klett-Cotta Verlag Stuttgart 1999
Bund für Naturvölker e.V.: „Bumerang – Zeitschrift für gefährdete Kulturen“, 2/04, 1 und 2/05, 1/06, Brodowin (Brandenburg)
Juri Rytcheu: „Der letzte Schamane“, Unionsverlag Zürich 2004
Julia Voss/Margarete Vöhringer: „Museum Darwiania: Taxidermie und Psychologie von Schimpansen im postrevolutionären Russland“, Beitrag im Reader „Anti-Darwin“, Kulturverlag Kadmos 2007
Julia Voss: „Märchenreise zu den Kannibalen“, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 1.1. 2006
Alexander Etkind: „Eros des Unmöglichen – Die Geschichte der Psychoanalyse in Russland“, Verlag Kiepenheuer & Witsch Leipzig 1996
Dietrich Beyrau (Hg.): „Im Dschungel der Macht“, Verlag Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen 2000
Vilém Flusser: „Leben und Kunst“, Spuren, Hamburg 1987/88
Erwähnt seien außerdem noch zwei weitere Publikationen, die sich mit „Völkerschauen“ befassen:
Anne Dreesbach: „Gezähmte Wilde – Die Zurschaustellung ‚exotischer‘ Menschen in Deutschland 1870-1940“, Frankfurt/New York 2005
„I like America – Fiktionen des Wilden Westens“, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung in der Frankfurter Schirn, München 2006
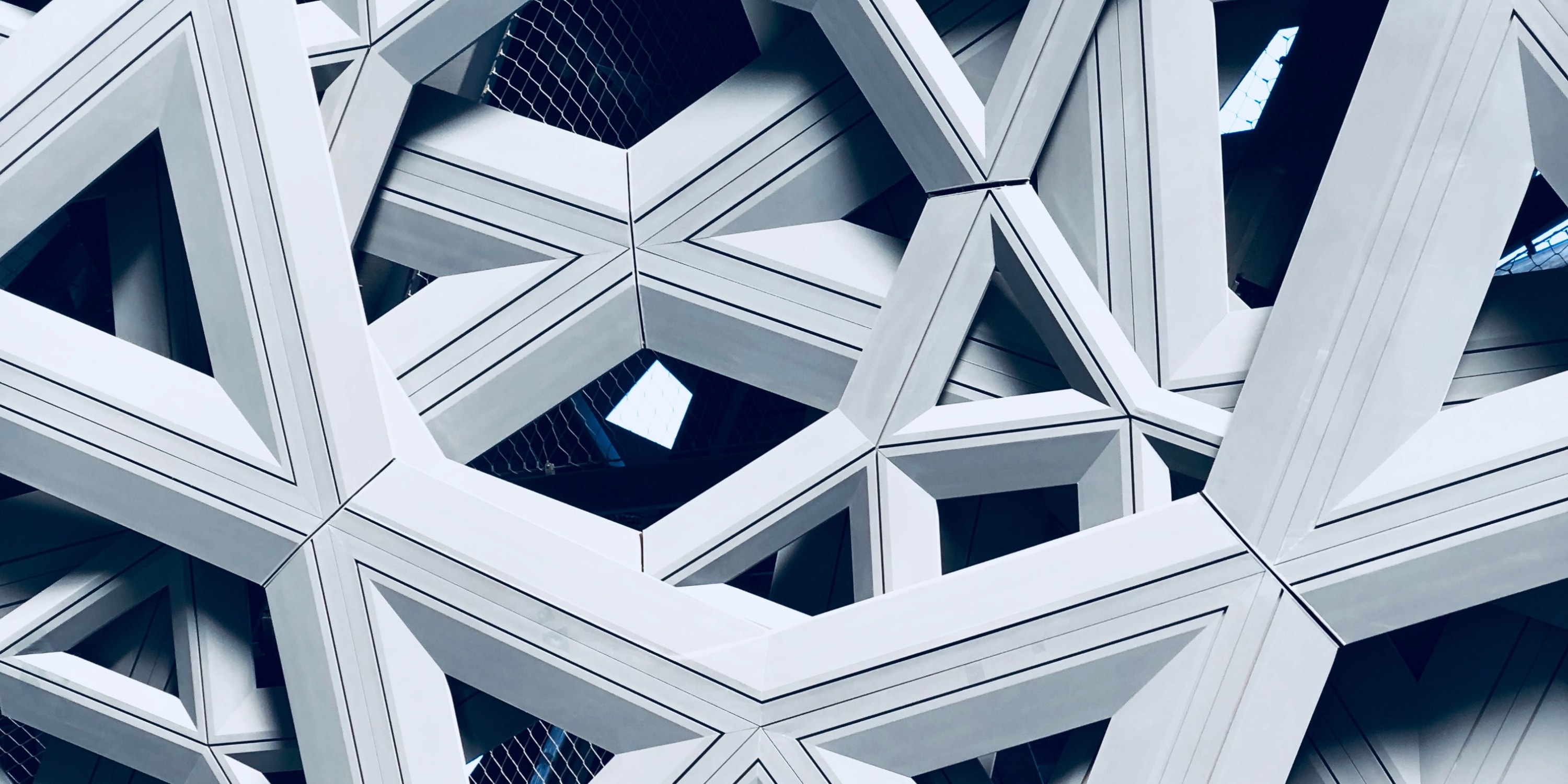



hallo ich bin ein großes fan von meerjungfrauen aber ich glaube immer noch auch wenn es ne legende ist ob es wohl meerjungfrauen gibts bitte bitte ich möchte es bescheid wissen
in vielen güßen rosa