Der Bundestag beschäftigt Putzfrauen, die von ihrer Reinigungsfirma noch 2,50 Euro weniger bezahlt bekommen als der tarifliche Mindestlohn für Gebäudereiniger vorsieht: 7,78 Euro pro Stunde. Die Firma meinte dazu, dass die Putzfrauen zu langsam arbeiten würden, um ordentlich entlohnt zu werden. Als das ruchbar wurde, beschloss der Bundestag, erst die IG BAU als Anzeiger zu rügen und dann den Vorfall zu prüfen, gegebenenfalls der Reinigungsfirma zu kündigen. Auch die taz beschäftigt eine solche Firma. Man müßte deren Putzfrauen mal fragen, was sie verdienen. Sie sind aber schwer zu interviewen, denn sie kommen um vier Uhr nachts und gehen wieder, noch bevor morgens die ersten taz-mitarbeiter das Rudi-Dutschke-Haus in der Rudi-Dutschke-Straße betreten – „Dutschkes später Sieg“ laut Berliner Kurier. Und ob sdie Putzfrauen überhaupt bereit sind, Journalisten ihre Stundenlohn zu verraten?
Kurz vor der Fußball-WM wurde den Putzbrigaden in sechs Fünf-Sterne-Hotels der Lohn pro Zimmer von 3,58 Euro auf 2,90 Euro gekürzt. Sie kamen damit auf einen Stundenlohn von 5,80 Euro. Die zumeist ausländischen Zimmermädchen schrieben einen Protestbrief, in dem sie eine Belegschaftsversammlung forderten. Fünf von ihnen schmiss die Geschäftsführung daraufhin raus, die Übrigen gaben klein bei – und schwiegen.
Man wusste aus diesen und ähnlichen Gründen lange Zeit nur sehr wenig von Putzfrauen. Höchstens dass ihre Arbeitgeber in Privathaushalten mehr oder weniger lustige Geschichten über sie erzählten. Zuletzt, 2007, zum Beispiel der Münchner Paul Sahner im Magazin Dummy – unter dem anzüglichen Titel: „Särr hiebsch, särr sieß“.
Seit Auflösung der Sowjetunion und der weltweiten Privatisierungen spricht man von einer „Dienstleistungsgesellschaft“, in der die Arbeitslosen auf vielfältige Weise neue Beschäftigung finden werden. Als einziges konkretes Beschäftigungsfeld, das neue Arbeitsplätze schaffe, nannte die Kohl-Regierung dann jedoch nur die „Privathaushalte“. Und prompt entstanden 100 Agenturen, die als Arbeitgeberin von Hausarbeiterinnen diese in die entsprechenden Haushalte entsendeten. Im Rahmen der Hartz-Gesetze unternahm die rot-grüne Regierung dann den Versuch einer Regulierung dieses wachsenden Frauen-Arbeitsmarktes – mit der Kreierung von „Mini-Jobs“ und einer „Mini-Job-Zentrale“. Gleichzeitig wurden Hartz-4-Empfängerinnen gezwungen, „Mini-Jobs“ als Hausarbeiterinnen anzunehmen.
Diese wundersame Wiederauferstehung der „Mägde“ und „Mädchen für alles“ aus der Vorkriegszeit (siehe dazu Uta Ottmüller „Die Dienstbotenfrage“ und Elisabeth Kottmeier „Ostpreußischer Mägdesommer“), die diesmal jedoch zumeist aus dem ehemals sozialistischen Osten kommen und dort hochqualifiziert wurden, lässt neben der Politik auch immer mehr Künstler und Wissenschaftler keine Ruhe. So drehte zum Beispiel die Hamburger Regisseurin Silke Fischer 1998 den Film „Paris Poussière – Putzen in Paris“, in dem es um die riesigen Bürokomplexe dort geht und um die Menschen, die sie nachts putzen. In einem „Kunstprojekt“ geht derzeit die Berliner Architektin Bettina Vismann der Frage nach: Warum werden die Häuser noch immer von Männern außen geplant und gebaut – während ihre Innenarchitektur meistens von Frauen geplant und geputzt wird?
Die Berliner Dokumentarfilmerinnen Judith Keil und Antje Kruska porträtierten dazu bereits 2001 drei Putzfrauen: die Argentinierin Delia, die eigentlich Malerin ist; ferner Gisela, die nachts die neuen Edelboutiquen in der Friedrichstadtpassage putzt, sowie Ingeborg, die sich – „attraktiv, einsam und arbeitslos“ – auf die Suche nach einer neuen Putzstelle macht.
Eine ähnliche Konstellation – nur mit Schauspielern – findet sich schon in Ken Loachs Film „Bread and Roses“, der von mexikanischen Putzfrauen in Kalifornien handelt – denen ihr Reinigungsunternehmen das Leben so schwer macht, dass sie anfangen, sich mit einem Gewerkschafter dagegen zur Wehr zu setzen. In einer Art Selbstversuch hat die US-Journalistin Barbara Ehrenreich 2002 Ähnliches unternommen, indem sie sich als Putzfrau in Kalifornien verdingte, um anschließend darüber das Buch „Working Poor“ zu schreiben. Der US-Markt wird von großen Reinigungsfirmen dominiert. Die Putzfrauen bekommen ihre Kunden fast nie zu sehen – nur durch die Einrichtungsgegenstände, die sie sauber halten müssen, können sie sich ein Bild von ihnen machen. Der eine hat eine große Bibliothek über Zen-Buddhismus, der andere sein Badezimmer zu einem Nassorgiencenter ausgebaut … Die Putzfrauen tragen grelle grün-gelbe Arbeitskleidung und ihre Arbeitsgänge sind von der Reinigungsfirma mit der Stoppuhr ausgetüftelt. Sie dürfen nicht fluchen und nicht einmal ein Glas Wasser trinken – der Kunde könnte sie mit Aufnahmegeräten überwachen. Die Autorin kommt mit all dem noch zurecht, aber als sie sich für eine Kollegin einsetzen will, die sich nach einem Arbeitsunfall nicht getraut hatte, zur Ambulanz zu gehen, scheitert sie: „Dies war der absolute Tiefpunkt in meinem Putzfrauenleben, und wahrscheinlich nicht nur in dem.“
Barbara Ehrenreichs Kolleginnen in Kalifornien kamen überwiegend aus Osteuropa. Über die von dort nach Berlin eingewanderten Putzfrauen gibt es eine wissenschaftliche Untersuchung – von der in Oxford lehrenden Soziologin Malgorzata Irek. Sie hatte zunächst versucht, sich bei einer Gruppe polnischer Putzfrauen einzuschleichen, war dabei jedoch an ihrer mangelnden Kenntnis deutscher Putzmittelnamen gescheitert. Stattdessen interviewte sie dann zehn Jahre lang die nach Berlin reisenden polnischen Putzfrauen im „Schmugglerzug Warschau-Berlin-Warschau“, so hieß dann auch ihr Buch. Derzeit arbeitet Malgorzata Irek an einer Biografie über eine „sehr erfolgreiche polnische Putzfrau“. Bei den in Berlin arbeitenden unterscheidet sie zwischen den „Putzfrauen der ersten Generation“, die bis etwa 1990 aus einem staatlich „ausgewählten Personenkreis“ bestanden, und den „Putzfrauen der jüngeren Generation“, die danach kamen und auch „einen Hauch vom Kapitalismus spüren“ wollten. In Berlin wurden und werden sie in einem „Netz“ tätig, das die Älteren vor ihnen aufgebaut haben – und wofür sie auch Abgaben verlangen. Ihre Meinungen über die Kunden, bei denen sie putzen, sind mitunter deftig. Als Danuta von der Arbeit Ekzeme an ihren Händen bekommt, sagt sie: „Das kommt vom Essig. Diese Kühe wollen alles ökologisch haben.“ Geschätzt werden dagegen die deutschen Professoren: „Sie sind nicht pingelig und eigentlich braucht man überhaupt nicht gründlich sauber zu machen“. Die meisten Putzfrauen halten so lange durch, bis sie sich eine eigene „respektable“ Existenz in Polen aufgebaut haben, einige heiraten auch Deutsche, nicht zuletzt, um aus der Illegalität rauszukommen. Während die polnischen Putzfrauen hier einen Status als Unternehmerinnen anstreben, kämpfen sie in den USA um minimalste Gewerkschaftsforderungen.
Nun gibt es gleich zwei umfangreiche neue Untersuchungen über Putzfrauen – weltweit. Zum einen die vom Hamburger Institut für Sozialforschung veröffentlichte Studie der ungarischen Soziologin Maria S. Rerrich: „Die ganze Welt zu Hause. Cosmobile Putzfrauen in privaten Haushalten“. Und zum anderen im Verlag Association A eine engagierte Übersetzung des Buches „Doing the Dirty Work. Migrantinnen in der bezahlten Hausarbeit in Europa“ der englischen Soziologin Bridget Anderson, die in der für die Rechte dieser Frauen kämpfenden Gruppe Kalayaan mitarbeitet. Während Maria S. Rerrich ihr Wissen zum Teil noch bei gebildeten Frauen aus ihrer eigenen „Klasse“ abschöpfte, die selbst Putzfrauen beschäftigen, nimmt Bridget Anderson ebenso konsequent wie radikal den Standpunkt der „Migrantinnen in der bezahlten Hausarbeit“ ein – und zwar gegen die sie beschäftigenden wohlhabenden Frauen und deren Männer. Eine äthiopische Hausangestellte in Athen erzählte ihr: „Männer übernehmen keine Aufgaben im Haushalt. Äthiopische und griechische Männer sind sich da gleich. Wenn die Griechen es sich leisten können, stellen sie jemand ein, sonst muss es die Frau machen.“ Die Hausfrau, die dann hofft, dass sie sich bald eine Putzfrau leisten kann, der sie nur noch sagt, was zu tun ist, wobei sie auf die gleiche oder womöglich noch strengere Sauberkeit und Ordnung (als Lifestyle- und Statuserhalt) pocht als ihr Mann, der dafür bezahlen muss. Und der deswegen nicht selten der Putzfrau auch noch „sexuelle Dienstleistungen“ abverlangt, wie beide Untersuchungen betonen. „Die Hausarbeiterinnen bewiesen durch Körperlichkeit und Schmutz ihre Minderwertigkeit; während die Arbeitgeberinnen ihre Überlegenheit durch Weiblichkeit, Anmut und Führungsqualitäten demonstrierten. Und Arbeitgeber bewiesen ihre Überlegenheit dadurch, dass sie sich keinen Moment lang Gedanken über die Plackerei im Hause zu machen brauchten, derweil sie das Heim als Ort der Zuflucht, als wohl verdienten Ruhepunkt nach dem Stress und den Belastungen der produktiven Arbeit zu schätzen wussten“, so Bridget Anderson.
Dies gilt weltweit, in Bezug auf Berlin fand die Autorin es aber „besonders bemerkenswert, dass Hausarbeiterinnen, die in Zeitungen inserieren, hier klarstellen ,No Sex‘, womit sie deutlich machen, dass sie ein Angebot von ,Hausarbeit‘ für missverständlich halten“. Besonders unangenehm ist es für jene Frauen, oft auch „Au-pair-Girls“, die bei ihren Arbeitgebern nicht nur putzen, sondern auch wohnen. Nona, eine Philippinin in Athen, meint: „Selbst wenn du schläfst, wenn du endlich schläfst, hast du noch das Gefühl, dass du im Dienst bist.“
Gegen all diese und andere Zumutungen haben die Putzfrauen, besonders die illegalen, mit Touristenvisum eingereisten, die nicht selten noch eine Schlepperbande abzahlen müssen, sich eigene „Netzwerke“ aufgebaut, in die auch manchmal Arbeitgeber einbezogen sind. Sie treffen sich regelmäßig – in Berlin zum Beispiel die polnischen und philippinischen Putzfrauen jeden Sonntag in einer katholischen Kirche, anderswo in Parkanlagen oder Räumen der Caritas. Und untereinander vermitteln sie sich dort Putzstellen, Wohnungen und Notkredite.
Die IG BAU will nun aber etwas gegen ihr „schlechtes Image“ tun – mit einer bundesweiten Kampagne: „Ich putze Deutschland“. Während das ehemalige Zimmermädchen aus dem Hotel Apollo, Susanne Frömel, nur meint: „Dein erstes Zimmer vergisst du nie.“ Und da sind wir nun. Dabei fing alles so aufklärerisch, geradezu hoffnungsvoll an -1968: Da veröffentlichte Christian Enzensberger bereits einen „Größeren Versuch über den Schmutz“. Man könnte noch weiter zurückgehen – auf die Zwanzigerjahre: Da versuchte der Siemens-Konzern mittels Aufklärung und Werbung die Putzfrauen durch Haushaltsgeräte zu ersetzen: die moderne Frau, so hieß es, hat heute statt eines „Mädchens für Alles“ z.B. einen Staubsauger (siehe Photo unten).
Kleiner Exkurs über das Fegen:
Vor Jahr und Tag wurde in der Kreuzberger Oranienstraße ein „Zentrum des Seon-Buddhismus“ eingeweiht, wo seitdem u.a. zehntägige Jong Maeng Cheong Chin – Intensivmeditationen – stattfinden, bei der die Teilnehmer sich rund um die Uhr im Zentrum versammeln. Morgens gehen sie dann als erstes raus in den Görlitzer Park, um dort – laut Auskunft von Frau Shu „etwas Gutes zu tun“, d.h. die Wege zu fegen – und damit gleichzeitig der eigenen Erleuchtung näher zu kommen. Denn wenn man diese nicht erreicht dann wird einem – wieder laut Frau Shu – „jeder Grashalm zur Falle“.
Nanu: fegen?! dachte ich – und begann sofort in Gedanken loszurattern: Mao – „Für alles Reaktionäre gilt, daß es nicht fällt, wenn man es nicht niederschlägt. Es ist die gleiche Regel wie beim Fegen: Wo der Besen nicht hinkommt, wird der Schmutz nicht von selbst verschwinden!“ Die chinesische Kulturrevolution – Wie viele Intellektuelle und Kader hat es damals gegeben, die man zwecks Umerziehung zum Fegen, als Pförtner oder Hausmeister abkommandiert hatte? Die so genannte „Narben-Literatur“ über die bei einigen Schriftstellern 22 Jahre andauernde Verbannungszeit ist voll von Klagen über diese entehrende Tätigkeit, mit der die Betreffenden ihr falsches – reaktionäres – Bewußtsein ändern sollten.
Außerhalb Chinas und der von oben gesteuerten Kulturrevolution wurde jedoch ebenfalls gefegt wie verrückt – im Westen allerdings eher auf freiwilliger Basis, aber mit dem selben Ziel: um von unten nach oben alles umzudrehen – die Kacke des Seins umzugraben! Ich erinnere mich noch, z.B. das Georg-von-Rauchhaus tagelang gefegt zu haben, ebenso den Republikanischen Club, die Alte TU-Mensa bis zum Erbrechen, das Audimax der TU einmal (nach dem Tunixkongreß) sowie mehrmals die Diskothek „Dschungel“ und mindestens zwei Mal einen Teil des zugefrorenen Wannsees, um eine schneefreie Fläche zum Eishockey-Spielen zu schaffen. Auf dem Höhepunkt dieser ganzen Fegerei gab es nicht nur mehrere französische Filme, in denen Straßenfeger eine tragende Rolle spielten („Themroc“ z.B.), sondern auch Joseph Beuys Fegeaktion in Neukölln, wo er hinter der Revolutionären 1.-Mai-Demonstration die Karl-Marx-Allee wieder besenrein machte. Sein damals dort zusammengefegter Dreck ist heute längst unbezahlbar.
Ich baute auf dem Höhepunkt meiner Fegeleidenschaft bei einem Bauern einmal einen ausrangierten Heuwender mittels 12 Piasawa-Besen zu einer Kehrmaschine um – und konnte fortan jeden Samstag seinen Hof mit dem Trecker fegen. Dem Bauer gefiel die Konstruktion, er nahm noch mehrere Verbesserungen daran vor. Genau das Gegenteil passierte mir dann während der umgedrehten Kulturrevolution – Wende genannt – in der DDR, auf einer LPG: Dort fegte ich einmal einen Stallgang auf der Rindermast sehr langsam und gründlich, aber eigentlich nur, um mich weiter mit einem Kollegen zu unterhalten, der noch mit Füttern beschäftigt war. Irgendwann stand er hinter mir und schaute mir zu, dann sagte er – mit einem Ton als würde ein Arbeiterverräter zurechtgewiesen: „Laß gut sein, wenn du es zu sauber machst, dann stecken sich das die da oben bloß wieder an den Hut!“
Seitdem habe ich eigentlich nie mehr so richtig gefegt – oder kann mich jedenfalls an keine größere Fegeaktion mehr erinnern. Höchstens Staubsaugen. So wird es auch in China jetzt sein, dass man die Leute gegebenenfalls zum Staubsaugen verdonnert. Das Fegen war während der Kulturrevolution eine derart harte Umerziehungsmaßnahme, dass die Betreffenden meistens nachts aufstanden, um damit fertig zu sein, bevor die ersten Nachbarn aufstanden und sie auf der Gasse sahen – so sehr schämten sie sich! Daran sieht man, wie wichtig gerade das Fegen ist! Bei mir ist es noch immer so, dass ich – umgekehrt mit niemandem zusammen leben möchte, der seine Wohnung fegen (oder staubsaugen) läßt: So etwas gehört sich einfach nicht! Das macht man selber oder läßt den Dreck liegen!
In der Wende versprach Gregor Gysi, als er zum PDS-Vorsitzenden gewählt wurde, die Partei mit „hartem Besen auszukehren“ – und einen solchen hielt er dann auch in die ARD-Kamera. Da war das Fegen aber längst zu einer Metapher geworden. So wie bei der Bürgerinitiative, die jetzt am 1. Mai hinter einer Neonazi-Demo die Straße „medienwirksam“ sauber fegte. Wenig später, am Tag der Kapitulation, fand in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg eine Diskussion über eben diesen Bezirk statt, in dem immer mehr Leute ihre Lofts und Flats fegen lassen. U.a. sprachen Papenfuß, Kuttner und Schappi (Wawerzinek) darüber, wie es dort früher war. Interessanterweise hatten alle drei auch mal als Hausmeister gearbeitet – und als solche regelmäßig, z.B. eine Kita, ausfegen müssen. In Erinnerung war ihnen jedoch vor allem das allmorgendliche Anheizen des Zentralofens geblieben. Neben mir stand während dieser Diskussion ein Erzieher, der mehrere Jahre als Heizer in einem Kinderheim bei Pankow gearbeitet hatte, davor war er wegen Renitenz im Knast gewesen. Der Job im Heim hätte ihm zunächst gefallen, erzählte er mir: „Ich hatte nicht viel zu tun. Aber dann wurde von der Regierung das Energiesparen verfügt und sie machten mich im Heim zum Energiebeauftragten: Von oben kam nun, ich sollte die Temperatur von 23 auf 18 runterfahren, aber die Kollegen bestanden darauf, dass ich bloß das Thermometer tiefer hänge. Ab da hatte ich ständig Stress, so daß ich mir schließlich eine andere Arbeit suchte“. Heizer müssen zwischendurch auch immer fegen. So viel dazu.
SPD-Vorständler kümmern sich dagegen gerne im Sommerloch um Großbetriebe – und gehen besuchsweise an die Basis. Nachdem so einer, aus Hessen, einmal bei der Berliner Stadreinigung gearbeitet hatte, fragte er einen Ostkollegen, ob sich seine jetzige Tätigkeit bei der BSR im Vergleich zu früher wesentlich unterscheide. Dieser antwortete: „Eijentlich hat sich nüscht jeändert – außer det Gesellschaftssystem“. Neuerdings taucht der Straßenfeger auch wieder in Buch und Film auf. In Volker Koeps Dokumentation „Kuhrische Nehrung“ z.B. ist es eine geringfügig als Straßenfegerin beschäftigte Frührentnerin, die am meisten zu erzählen hatte. Und ich selbst hatte einer ukrainischen Raumpflegerin das Ja-Wort gegeben. Woraufhin meine Freundin mich verließ. Und ich bald nur noch – wahrscheinlich weil es gerade Frühling wurde – überall so genannte heiße Feger herumlaufen sah, während ich vakant durch die Stadt lief – und mich von allen Werbeschriftzügen beleidigen ließ. Aus lauter Verzweiflung stürzte ich mich gedanklich in die chinesische Kulturrevolution – und las alles, was ich darüber fand. Aber irgendwie schien sich die ganze Sache im Kreis zu drehen. Will sagen: ich war hinterher so klug wie zuvor – oder sogar noch ratloser. Vielleicht sollte ich einfach mal nach China fahren für einige Zeit, überlegte ich – mir dafür von irgendwoher Geld leihen – und weg?! Prompt fielen mir erst einmal etliche China-Reiseberichte in die Hände, die jedoch allesamt unlauter waren oder jedenfalls gab es an allen etwas auszusetzen, obwohl oder weil die meisten Autoren inzwischen pensionierte Sinologen oder mindestens passionierte Chinawatcher waren – und ich kein einziges chinesisches Zeichen kenne – außer das für den Tigersprung in die Geschichte.
Aber dann traf ich eines Abends in einem Moabiter Ballsaal eine quasi allein tanzende Chinesin – mit Blumen im Haar. Wie sich herausstellte, war sie während der Kulturrevolution für drei Jahre aufs Land geschickt worden, wo sie in einer Gemüsebrigade gearbeitet hatte. Während der ganzen Zeit hatte sie auf eine Rehabilitation durch ihre Grundeinheit gewartet, die ihr die Rückkehr an die Universität ermöglicht hätte. Die sie jedoch ablehnen wollte, um sich weiter durch die Landarbeit zu „reformieren“. Ich sah ein Photo aus jener Zeit, auf dem sie wie eine stolze Rotgardistin aussieht, die ihren Blick über Rübenfelder bis an den Horizont schweifen läßt. Ihre Rehabilitation kam jedoch nicht – und das stürzte sie fast in Verzweiflung: Sie wollte endlich einmal „Nein!“ sagen – aber man gab ihr keine Chance. Als sie dann doch die Produktionskommune verließ, die wenig später schon wie alle anderen aufgelöst wurde, war es mehr ein leises Verschwinden – zurück in die Stadt, nach Shanghai. Und ähnlich ging es dann auch weiter, bis nach Berlin: über einen Schwager, der in Amsterdam lebte.
Ich fragte sie daraufhin, wo sie so gut Tanzen gelernt hätte. Ich meinte sogar gesehen zu haben, dass sie die Männer vor allem nach ihrem Tanzvermögen taxiert hatte. „Während der Kulturrevolution und auch schon davor wurde in China immer viel getanzt und gesungen“, bekam ich zur Antwort, und heutzutage laufe dort nichts ohne Karaoke. Da ich nicht besonders gut tanzen und schon gar nicht singen kann, nahm ich an, dass es meine augenblickliche China-Begeisterung gewesen war, die sie dazu bewegt hatte, sich mit mir am Rande der Tanzfläche noch weiter zu unterhalten und schließlich an der Theke. Später verabredeten wir uns für den nächsten Tag in einem China-Restaurant am Landwehrkanal. Dort winkte sie allen vorbeifahrenden Touristen auf den Ausflugsschiffen der Weißen Flotte zu – während sie gleichzeitig weiter aß – mit Stäbchen. Ich fragte sie nach dem Essen, warum es im Chinesischen so viele Nautikmetaphern gäbe: vom Großen Steuermann angefangen – über den Schiffbruch im Sozialen bis zum individuellen Glück, das mit geblähten Segeln umschrieben wird und der neuen Politik der Geschäftemacherei, die „Ins Meer tauchen“ heißt. Sogar in der Literatur über die Verbannung der Intellektuellen aufs Land und zum Fegen heißt es – z.B. von einem solchen, den Gu Hua schilderte, er habe morgens auf der Straße „seinen Besen geschwungen, als rudere er auf einer Bühne im Boot“…
Das sei ihr noch gar nicht aufgefallen, wahrscheinlich weil in Shanghai als Hafenstadt immer schon alles intime zugleich auch maritim gewesen sei, überdies wäre ihr Vater bei der Marine gewesen. Und selbst während ihrer Landverschickung, fügte sie hinzu, habe sie ständig mit Wasser zu tun gehabt: Entweder bekamen die Gemüsepflanzen nicht genug, dann mußte sie Brunnen graben oder zu viel, dann mußten Entwässerungsgräben angelegt werden. Ich erzählte ihr daraufhin, dass in der Endphase der Kulturrevolution ein Neuköllner Maoist namens Thomas Kapielski einmal erfolgreich eine Landverschickung von Künstlern aus Westberlin organisiert hatte – in die Lüneburger Heide. Viele würden noch heute von diesem Wochenende auf dem Dorf reden, die Bauern dort umgekehrt auch. Ich selbst hätte einmal einen freiwilligen Arbeitseinsatz von 100 Linken bei einer Landkommune in Ostfriesland organisiert. Und später bei einem Bauern nahezu allein ein 10 Hektar großes Rübenfeld gehackt.
Ob ich etwa der Meinung wäre, dass die Worte des Großen Vorsitzenden bis hierher wirksam geworden seien, fragte sie mich daraufhin ironisch. „Ja, aber noch wirksamer waren wohl die dadurch in Bewegung geratenen Massen, zu denen u.a. Du gehörtest“, versuchte ich Zeit für eine Antwort zu gewinnen. Im übrigen habe es auch in Berlin nicht an Mao-Bibeln gemangelt. 1969 hätte z.B. allein die so genannte Kommune I tausende von Exemplare aus der Ostberliner chinesischen Botschaft nach Westen geschmuggelt, wo sie dann während einer Vietnam-Demonstration an der Gedächtniskirche umsonst verteilt wurden. Und in Ostberlin ließ eine ebenfalls maoistisch inspirierte Kommune ihren individuellen Solibeitrag für Vietnam nicht mehr vom Stipendienkonto abbuchen, sondern ging als Kollektiv in die Fabrik, um anschließend vom Gehalt ein Fahrrad zu kaufen, das sie der Vietkong-Botschaft übergaben. Auch wäre dort genauso antirevisionistisch die Überwindung bürgerlicher Verhaltensweisen sowie die Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit diskutiert worden – wie im Reich der Mitte. Es gab sogar einen Abwaschplan. Das sei ja gerade das Merkwürdige, fügte ich hinzu, dass wir vielleicht seit der Kulturrevolution von Peking ferngesteuert werden – bis hin zu Deng und seiner Modernisierungs-Parole „Bereichert Euch!“
„Mit dem kleinen Unterschied, dass uns die Mao-tse-tung-Ideen eingehämmert wurden, während ihr sie heimlich unter der Bettdecke studiert habt“, sagte sie und gab zu bedenken: „Was ist an dieser Freiwilligkeit noch ferngesteuert?“ Mir fiel dazu erst einmal nur die Theorie vom hundertsten Affen ein: Auf einer kleinen Insel im Pazifik fing ein Affe eines Tages an, sein vom Baum gefallenes Obst zu waschen, bevor er es verzehrte. Bald taten es ihm alle Affen auf der Insel nach. Als eine „kritische Masse“ erreicht war, fing der erste Affe auf einer Nachbarinsel damit an. Hierbei handele es sich um ein Medienphänomen, das man morphische Resonanz nenne. Auch die weltweite Ausstrahlung der chinesischen Kulturrevolution sei vielleicht solch ein Medienphänomen – über Millionen Bilder und Texte verbreitet, über rote Fahnen, Pekingoper, Filme, Plakate, Maobibel – und nicht zu vergessen die ganzen Mao-Sticker, die mir z.B. jedesmal beim Grenzübergang am Bahnhof Friedrichstraße vom Grenzsoldaten abgenommen wurden. Anschließend belehrte mich noch ein Offizier über die damaligen Differenzen zwischen China und der UDSSR. „Hier wie in China schien es antiautoritär gegen die Etablierten zu gehen,“ fügte ich noch hinzu. „Die Lehrer und Kader wurden bei euch angegriffen – kritisiert und aufs Land geschickt. In Westberlin drehten einige Schüler, zu denen u.a. der spätere Künstler Kapielski gehörte, einen Super-8-Film über ihren maoistischen Schulkampf, der mit der Verbrennung des Klassenlehrers auf dem Pausenhof endete. Er wurde sogar auf der Berlinale gezeigt“.
Dazu meinte die Chinesin nur knapp: „Wahrscheinlich, weil man die Lehrer hier immer nur metaphorisch getötet hat – damals jedenfalls!“ Sie wollte damit wahrscheinlich andeuten, dass die Kulturrevolution vielen Menschen das Leben gekostet hat – und dass sich jetzt im Westen die Schüler immer öfter gegenseitig umbringen. Aber hatte sie persönlich wenigstens von der zehnjährigen Kampf-Kritik-Umgestaltungs-Kampagne etwas gehabt? wollte ich wissen. Daraufhin zeigte sie mir ihre kräftigen Hände, mit Sichelnarben, und deutete auf die muskulösen Oberarme. „Auch sonst hat es mir nicht geschadet“, sagte sie, „außer dass sich mein Hochschulabschluß dadurch zerschlagen hat…Dafür kann ich jetzt Lügen besser von Nicht-Lügen unterscheiden“. Was sie denn damit meine, hakte ich nach. „Na, wie wenig ernst manche Sprüche, auf die wir damals immer wieder geschworen haben, wirklich gemeint waren, auch die ganzen schriftlichen Selbstkritiken und Angriffe, Denunziationen. Vielleicht war die reine Wahrheit nur in der Pekingoper zu haben. Also schon damals ein Medienphänomen – das sicher nicht zufällig mit Wandzeitungen in großen Buchstaben begann“.
„Würdest du noch einmal eine Wandzeitung aufhängen?“ fragte ich sie – schon fast verschwörerisch. „Nein,“ sagte sie, ich bin doch eine moderne Frau, heute würde ich meine Angriffe ins Netz stellen. Und das tu ich auch“. Ich war enttäuscht: Wie konnte man sich nur so leicht von den großen Schriftzeichen verabschieden, von Pinsel und Tusche? Vielleicht um mich zu versöhnen, holte sie ein Schminketui aus ihrer Tasche, klappte es auf und nahm einen kleinen Kamelhaarpinsel heraus, den sie mit Spucke befeuchtete. Dann schrieb sie mir damit die Adresse ihrer „Firma“ auf. – In Frohnau, wie ich bald herausfand. Als ich dort jedoch einmal aufkreuzte, war es das buddhistische Kloster. Und die drei ceylonesischen Mönche, die ich im Haus antraf, kannten keine Chinesin. Ich müsse sie mit einer Thailänderin verwechselt haben, meinten sie, in ihrem Kloster würden viele Thailänderinnen beten. „Wofür“ wollte ich unwillkürlich fragen, konnte mich aber gerade noch zurückhalten. Später erfuhr ich – über Umwege, dass die Mönche „meine“ Chinesin verwechselt bzw. sie für eine Thailänderin gehalten hatten – sie besuchte nämlich tatsächlich das Kloster gelegentlich, setzte sich dort in die Bibliothek oder ging im Park spazieren. Außerdem bekam ich noch heraus, dass sie wochentags in einem Biogemüseladen arbeitete – an der Kasse. Das ermutigte mich seltsamerweise, weiter zu machen – ich meine damit die chinesische Kulturrevolution, das Fegen ganz Allgemein.

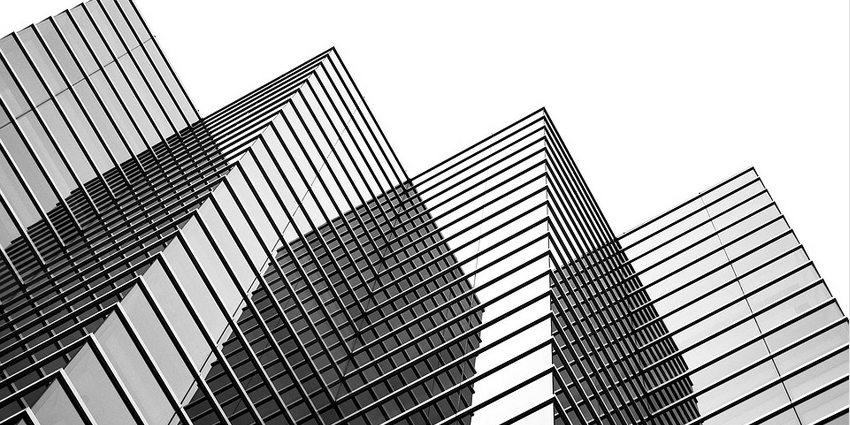



In der Zeitschrift für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit „express“ (Nr. 8/2010) hat Christian Frings über die Situation bei den Putzarbeitern einen längeren Text veröffentlicht – sie sollen noch weniger Lohn bekommen:
Als die Gewerkschaft IG BAU im Oktober letzten Jahres zum ersten flächendeckenden Streik im Reinigungsgewerbe
aufrief, stand sie vor einem erheblichen Problem. In der Branche arbeiten zwar
mittlerweile 860000 Menschen, und angesichts der miesen Löhne war die Forderung von 8,7 Prozent
Lohnerhöhung nicht übermäßig hoch. Aber von den PutzarbeiterInnen sind höchstens zehn Prozent
organisiert, und an vielen Einsatzorten können sie kaum schnell Druck ausüben – wen interessiert
es schon, wenn eine Schule oder Behörde mal ein paar Tage nicht geputzt wird… Die Gewerkschaft
war daher auf Belegschaften wie die FlugzeugreinigerInnen von Klüh angewiesen – denn ein Langstreckenflieger
kann ohne gründliche Reinigung nicht wieder in die Luft gehen, und eine Verzögerung
verursacht enorme Folgekosten. Bei Klüh haben die Beschäftigten in jahrelangen zähen Auseinandersetzungen
mit der Firma bessere Bedingungen erstritten und dabei zugleich auch den Zusammenhalt
in ihrer multinational zusammengesetzten Belegschaft gefestigt. Für sie war es ganz
selbstverständlich, sich am Streik der IG BAU zu beteiligen, bei dem am Schluss etwa fünf Prozent
rauskamen. Nun soll diese Belegschaft auf kaltem Weg zerschlagen werden. Aber sie wehrt sich.
Die Organisationsform der Reinigungsbranche: Hochkonzentrierte Zersplitterung
Die Putzarbeit in Behörden, Schulen, Krankenhäusern usw. wird mittlerweile von einigen großen Firmen organisiert,
die teilweise schon als Multis auftreten. Die Firma Klüh Service Management GmbH ist eine von
ihnen. In Deutschland beschäftigt sie etwa 14000, weltweit über 40000 Menschen – mit besonders starker
Expansion in China und Indien. Auf europäischer Ebene ist sie mit der britischen Firma Mitie Group und der
französischen Sin & Stes zur Firma Service Management International (SMI) zusammengeschlossen, die
weltweit Aufträge an Land zieht. Aber für die zum größten Teil in Teilzeit und auf 400-Euro-Basis Beschäftigten
ist dieser Konzentrationsprozess nicht greifbar. Sie arbeiten in kleinen Betrieben oder Kolonnen, haben
nur über Vorarbeiter oder Abteilungschefs Kontakt zur Firma und keinerlei Kontakt zu den KollegInnen an
anderen Einsatzorten derselben Firma. Betriebsräte sind in dieser Branche ohnehin die Ausnahme, und von
den wenigen, die es gibt, verhalten sich die meisten als verlängerter Arm der Personalabteilung. Insofern ist
die Klüh-Flugzeugreinigung in Düsseldorf schon ein Sonderfall. Die 110 festangestellten Putzkräfte arbeiten
in Vollzeit, und auch die befristet oder als Leiharbeiter Beschäftigten haben garantierte monatliche Stundenzahlen.
Aber auch ihr Betriebsrat hat trotz vielfältiger Bemühungen bisher keine Kontakte zu anderen Klüh-
Belegschaften herstellen können.
Putzen – der tägliche Kleinkrieg gegen Chefs und anderen Dreck
Wie in der gesamten Branche sind auch bei der Firma Klüh extreme Formen der Ausbeutung und Schikanierung
an der Tagesordnung. In die Schlagzeilen geriet Klüh Ende letzten Jahres, weil Betriebsräte im Untertürkheimer
Daimler-Werk zusammen mit dort eingesetzten Beschäftigten der Firma Klüh diese Verhältnisse
öffentlich gemacht hatten: Mehrarbeit wurde nicht bezahlt, es wurden unzumutbare Leistungsvorgaben
gemacht und dann Qualitätsmängel gerügt, KollegInnen auf sexistische und rassistische Weise beschimpft
usw. Durch diese Veröffentlichungen sah sich schließlich das Management von Daimler so unter
Druck gesetzt, dass es den Vertrag mit der Firma Klüh nicht verlängerte.1 Was die Methoden angeht, ist
Klüh sicher kein Einzelfall in dieser Branche – nur dass diese Methoden hier endlich einmal zum Politikum
und Skandal gemacht wurden. Über ein jüngstes Beispiel, wie Klüh mit Beschäftigten umgeht, berichtete
auch nur die Lokalpresse: In Baden-Baden wurde eine Putzfrau von Klüh gekündigt, weil sie während ihrer
Arbeit beim DRK-Blutspendedienst einen Schluck aus einer herumstehenden Orangensaft-Flasche genommen
haben soll. Wohl unter dem Eindruck der allgemeinen Skandalisierung von »Verdachtskündigungen«,
die vor allem mit dem Namen »Emmely« und ihrer erfolgreichen Klage bis zum Bundesarbeitsgericht verbunden
sind, kündigte das DRK daraufhin den Vertrag mit Klüh. Nun »bemüht« sich die Putzfirma Klüh angeblich
doch um eine Weiterbeschäftigung, nachdem sie zunächst beim Gütetermin noch zu keinem Einlenken
bereit war.2 Den FlugzeugreinigerInnen in Düsseldorf sind diese Methoden bekannt; dort wurde auch
schon – erfolglos – versucht, Beschäftigte zu entlassen, weil sie sich ein altes Brötchen im Flugzeug eingesteckt
haben sollen.
Flughafen Düsseldorf – Putzen im Minutentakt
Flughäfen sind im Grunde moderne Fabriken, und sie sind moderne Formen von Arbeiterkonzentrationen,
die den dort Arbeitenden ein enormes Störpotenzial in die Hand geben. Damit die Maschinen im Minutentakt
landen und starten können, muss eine Vielzahl von Arbeitergruppen taktgenau zusammenarbeiten. In den
letzten Jahren fällt auf, wie der anhaltende Boom der Fliegerei auch zu einer zunehmenden Konfliktualität
an den Flughäfen führt. Aber noch wird das Ausspielen der möglichen Arbeitermacht durch die rasanten
Umstrukturierungen, Auslagerungen und Firmenzersplitterungen ausgebremst. Denn der Boom des Fliegens
ist vor allem einer der Billigflieger, die nur mit weiteren Kostensenkungen und Druck auf die ArbeiterInnen
profitabel sein können.
Ein wesentlicher Faktor der Profite ist die Umschlagzeit des fixen Kapitals, in diesem Fall der ununterbrochene
Einsatz der Flugzeuge. Um die Standzeiten auf ein Minimum zu drücken, müssen die Flieger in wenigen
Minuten gereinigt, betankt, mit Catering versorgt, gewartet werden usw. Da kommt es zu einem ziemlichen
Gerangel in den ohnehin schon eng gebauten Maschinen – und im Nacken ständig die Crew, die ihren
Flugplan einhalten will. Dabei sind Verspätungen im Flugverkehr an der Tagesordnung, so dass sich die
Reinigungsarbeit nicht perfekt planen lässt. Dann stehen auf einmal sechs Flugzeuge gleichzeitig auf dem
Rollfeld, die innerhalb von zehn Minuten geputzt werden sollen, obwohl nur zwei eingeplant waren. Der ganze
Druck wird letztlich auf die Beschäftigten abgewälzt, die sehen sollen, wie sie damit zurechtkommen.
Um die extremen saisonalen Schwankungen im Flugverkehr besser abzufangen, arbeiten die Putz- und
Cateringfirmen, aber auch Gepäckabfertigung und Security – ein Geschäft, in das Firmen wie Klüh zunehmend
mit einsteigen – mit Arbeitszeitkonten, Arbeit auf Abruf und LeiharbeiterInnen ohne garantierte monatliche
Stundenzahlen. Für die Beschäftigten bedeutet das die völlige Unplanbarkeit der eigenen Zeit, ständig
herumkommandiert zu werden, Schichtplanänderungen von heute auf morgen – und das alles ohne einen
garantierten Monatslohn. Das Besondere bei der Flugzeugreinigung Klüh in Düsseldorf besteht unter anderem
darin, dass sich die ArbeiterInnen solche Bedingungen – die selbst von der Gewerkschaft schon als
»branchenüblich« hingenommen werden – nicht bieten lassen. Darin besteht in den Augen der Firma ihre
»Unbotmäßigkeit«, für die sie jetzt mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes bzw. dem Verzicht auf ihre bisher
verteidigten Bedingungen bestraft werden sollen.
Jahrelange Konflikte – beachtliche Erfolge
2004 wollte Klüh am Düsseldorfer Flughafen Jahresarbeitszeitkonten mit einem Spielraum von 120 Plusoder
Minus-Stunden einführen. Zunächst ging die Mehrheit des Betriebsrats auf den Vorschlag der Firma
ein, und auch die zuständige Gewerkschaft IG BAU hatte keine Einwände, da dies schließlich überall »so
üblich« sei. Aber zwei Betriebsräte widersprachen und forderten, die ArbeiterInnen auf Betriebsversammlungen
selbst darüber abstimmen zu lassen – auch dies eine bei Klüh öfter praktizierte Form der betrieblichen
Demokratie, die keineswegs selbstverständlich ist. Nachdem sich eine klare Mehrheit gegen die Arbeitszeitkonten
ausgesprochen hatte, lehnte auch der Betriebsrat ab. Bis heute wurde diese Flexibilisierung
verhindert. Überstunden werden monatlich ausbezahlt, und wem seine freie Zeit wichtiger als das zusätzliche
Geld ist, der kann auch nicht unter Druck gesetzt werden wie in anderen Betrieben.
Besonders stolz sind die KollegInnen auf ihr 4-2-4-1-Modell der jährlichen Arbeitszeitverteilung. Wurde früher
acht Tage oder mehr am Stück gearbeitet – je nach betrieblicher Anordnung und mit kurzfristiger Ankündigung,
so setzten sie einen festen Rhythmus von vier Arbeitstagen, zwei Freitagen, vier Arbeitstagen
und wieder einem freien Tag durch, der ihr persönliches Leben planbar macht und die Willkür der Chefs
einschränkt. Beliebtes Bestrafungs- oder Belohnungsmittel war z.B. die Vergabe der mit 75 Prozent Zuschlag
bezahlten Sonntagsschichten. Das konnte sogar gegen den Betriebsrat ausgespielt werden, denn
wenn der eine gerechtere Verteilung anmahnte, konnten die Chefs diejenigen, die dadurch weniger Sonntagsschichten
bekamen, gegen den Betriebsrat aufstacheln. Mit dem festen und auf ein Jahr festgelegten
Schichtrhythmus können solche Konflikte gar nicht erst aufkommen. Um aber die Möglichkeiten einer
selbstbestimmten Flexibilität nicht einzuschränken, wurde per Betriebsvereinbarung festgeschrieben, dass
die Beschäftigten auch kurzfristig ein oder zwei Tage Urlaub nehmen können.
Um zu verhindern, dass damit der gesamte Flexibilisierungsdruck auf Teilzeitbeschäftigte und Leiharbeiter
abgewälzt wird, wurden auch für sie feste Stundenzahlen (120 Monatsstunden für Leiharbeiter) und Ankündigungszeiträume
vereinbart. 2008 gelang es dann auch, die maximale Zahl der LeiharbeiterInnen auf 50 zu
begrenzen, wodurch die Firma gezwungen werden konnte, einige LeiharbeiterInnen zu übernehmen.
Vor dem Hintergrund all dieser Beispiele wundert einen auch die für hiesige Verhältnisse fast unglaubliche
Geschichte nicht mehr, dass die Frauen zum 8. März diesen Jahres, dem internationalen Frauentag, bezahlte
Freistellungen für ihre Aktionen während der Arbeitszeit durchsetzten.
Eine rebellische Belegschaft, ein unbestechlicher Betriebsrat
Immer wieder hat die Geschäftsleitung in den letzten Jahren versucht, den Betriebsrat auf ihre Seite zu ziehen.
Dem Betriebsratsvorsitzenden, der aus der Türkei stammt, wurden Angebote gemacht wie eine Freistellung,
auf die kein rechtlicher Anspruch besteht. »Nein Danke«, sagte der, und verlangte seinen Schichtplan. Als die wiederholten Angebote, die prägend für die deutsche Betriebsratskultur sind, nicht fruchteten,
hat man es mit Druck versucht: Es hagelte Abmahnungen und sogar Kündigungen gegen Betriebsratsmitglieder
– die in schöner Regelmäßigkeit in endlosen Arbeitsgerichtsprozessen wieder fallengelassen werden
mussten. Statt den Betriebsrat gefügig zu machen, wurde dieser in den letzten Jahren noch stärker und
geschlossener. Nach den Betriebsratswahlen von 2002 befand sich die Fraktion der konsequenten Interessensvertreter
mit vier von neun Sitzen noch in der Minderheit. Bei den Wahlen von 2006 kam sie auf fünf
von sieben Sitzen und 2010 schließlich auf sieben von sieben Sitzen (122 von 140 abgegebenen Stimmen).
Versuche der rassistischen Spaltung – vor allem zwischen den ArbeiterInnen aus der Türkei (etwa die Hälfte)
und den aus afrikanischen Ländern stammenden (etwa ein Drittel) – gingen nicht auf. Von den sieben
Betriebsratsmitgliedern kommen vier aus der Türkei und drei aus Afrika, und sie wehren sich gemeinsam
gegen den Druck der Unternehmensleitung. Unterrepräsentiert sind allerdings die Frauen, die drei Viertel
der Belegschaft ausmachen, aber mit nur zwei Sitzen im Betriebsratsgremium vertreten sind.
Gemeinsames Spiel von Air Berlin und Klüh
Wer diesen ganzen Hintergrund kennt, durchschaut leicht das abgekartete Spiel von Klüh und Air Berlin, die
mit ca. 70 Prozent der zu putzenden Flugzeuge Hauptkunde der Klüh Flugzeugreinigung in Düsseldorf ist.
Da die Air Berlin, mittlerweile zweitgrößte Airline in Deutschland, selber mit allen Mitteln versucht, Gewerkschaften
aus dem Betrieb zu halten und Betriebsräte erst gar nicht entstehen zu lassen, dürfte sie Verständnis
für die Sorgen von Klüh gehabt haben. Ende 2009 kündigte sie an, die Kosten für diesen Auftrag müssten
um 20 Prozent gesenkt werden. Klüh reagierte darauf, indem sie sich nicht mehr an der Ausschreibung
beteiligte. Auch Vorschläge des Betriebsrats zu möglichen Kosteneinsparungen änderten nichts an dieser
Haltung. Es ist klar, dass Klüh nicht generell seine Geschäftsbeziehungen zur Air Berlin einstellen will – am
Frankfurter Flughafen putzt sie, mit einer wesentlich gefügigeren Belegschaft, nach wie vor deren Maschinen.
Dass es sich um eine gezielt eingefädelte Strategie handelt, deutet noch ein anderes Detail an: Für die Verhandlungen
mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft hat Klüh den Düsseldorfer Rechtsanwalt Helmut
Naujoks eingeschaltet. Naujoks ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern gilt als einer der aggressivsten und
rüdesten Anwälte, wenn es darum geht, Betriebsräte loszuwerden. In seinem Buch »Kündigung von ›Unkündbaren‹
« und auf »Fachseminaren« erklärt er Unternehmern, mit welchen Schikanen sie missliebige
Betriebsräte loswerden können – Methoden, die von Günter Wallraff in seinem Buch »Aus der schönen
neuen Welt« angeprangert wurden. Aber Naujoks mit seiner repräsentativen Kanzlei an der Düsseldorfer
Nobeladresse Cecilienallee ist nicht billig; wer ihn beauftragt, lässt es sich was kosten, ein besonderes
Problem zu lösen, z.B. einen unliebsamen und unbestechlichen Betriebsrat loszuwerden.
Kämpferische Belegschaft, zögerliche Gewerkschaft
Mit einer Reihe von Aktionen haben die Putzkräfte versucht, öffentliche Aufmerksamkeit und Solidarität zu
bekommen. Aber bisher teilen sie das Schicksal vieler kleiner Konflikte im Kontext von Krise und weiterer
Prekarisierung. Presse und Fernsehen zeigen sich desinteressiert und wollen lieber über den kommenden
Aufschwung berichten, die Linke ist mit sich selbst beschäftigt und diskutiert über die große Parteifrage oder
lamentiert darüber, dass die Krise zu keinen Kämpfen führt, und die Gewerkschaften versuchen solche Konflikte
möglichst schnell und reibungslos über die Bühne zu bringen, machen den ArbeiterInnen fragwürdige
Sozialpläne schmackhaft – und für die Restwut, die bleibt, gibt’s mal ab und zu einen Protesttag mit der
großmäuligen Behauptung, man werde nicht für ihre Krise bezahlen. Vor Ort geht es aber nur um die geräuschlose
Ausgestaltung dieses Bezahlens, das als unabänderliches Naturgesetz schon längst verinnerlicht
ist.
Trotz Protestversammlungen am Flughafentor, trotz so pfiffiger Aktionen wie 24-stündigen Betriebsversammlungen,
gelang es den KollegInnen nicht einmal, in die Lokalpresse zu kommen. Vielleicht bremst hier
auch das lokale Image des Firmeninhabers Josef Klüh, der den Düsseldorfern besser als langjähriger Präsident
ihres geliebten Eishockey-Clubs DEG bekannt ist, denn als erfolgreicher Ausbeuter im Putzsektor. Innerhalb
der türkischstämmigen oder migrantischen Arbeiterszene der Region kursieren Informationen über
Konflikte wie bei Klüh, aber sie bleiben in dieser proletarischen »Parallelgesellschaft« gefangen. Zu dieser
hat auch die deutsche Linke kaum Kontakte, oder allenfalls über die institutionalisierten gewerkschaftlichen
Vertreter dieser Schicht, die es im völlig unreflektierten Interesse ihres eigenen störungsfreien Betriebsablaufs
vermeiden, etwas hochzuspielen, was für sie ganz normaler Kapitalismus ist – Tagesgeschäft, das
wegen der schwindenden eigenen Ressourcen mit möglichst geringem Aufwand zu erledigen ist. Selbst
wenn der Kampf dieser Belegschaft um ihren Zusammenhalt und ihre Bedingungen vielleicht letzten Endes
nicht gewonnen wird, gehört er doch zu den vielen Geschichten aus dem heutigen Klassenkampf in der
Krise, die hartnäckig ignoriert werden. Dabei könnten sie anderen Mut zum Kämpfen machen und ein anderes
Bild der bundesdeutschen Klassenrealität zeigen.
Anmerkungen:
1 Siehe dazu die Berichte auf labournet: http://www.labournet.de/branchen/dienstleistung/rg/index.html
2 Siehe: http://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/vm/art19068,1910798
Christian Frings lebt und arbeitet in Köln
Unter http://www.labournet.de/branchen/dienstleistung/rg/klueh_soli.pdf findet man ein Flugblatt des Betriebsrates
mit den Adressen für Solidaritätserklärungen und Proteste.