Jetzt nimmt auch Europa am Weltraumabenteuer teil: das EU-Modul ist so weit fertig, um an die amerikanisch-russische Weltraumstation angedockt zu werden. Man muß es bloß noch hochschießen. Die Wissenschaftler haben sich eine Reihe von Versuchen ausgedacht, damit die drei Astro-Kosmonauten, die in dem Modul Platz haben, bei ihrem Studium Universale nicht auf dumme Gedanken kommen, sondern konkrete Aufgaben erfüllen. Das hilft auch gegen ihre Schwermut – infolge der Schwerelosigkeit da oben. Einer wird ein Deutscher sein.
Die BRD-Raketen- und Weltraumforscher, die nach WK Zwo zunächst am Sänger-Lehrstuhl der TU Westberlin ausgebildet worden waren, hatte man nach der „Wende“ (Egon Krentz) mit den Kosmosforschern der DDR in zuvor von der Stasi geräumten Adlershof-Liegenschaften wiedervereinigt. Beide Teams/Brigaden repräsentieren eine Tradition, die auf die Wunderwaffen-Forschung und -.Entwicklung der Nazis in Peenemünde zurückgeht. Nachdem die Amis und die Russen sich 1945 viele der dortigen Experten geschnappt hatten, war aus dem Raketenversuchsgelände ein Marinestandort der NVA geworden. Es waren dann auch zwei in Peenemünde stationierte NVAler, die aus dem „geschichtsträchtigen Ort“ nach der „Wende“ (Egon Krentz) sofort ein V1-V2-Museum kreiierten, das sie zusätzlich noch mit sowjetischen MIGs und DDR-Minensuchbooten garnierten. Der Regisseur Robert Bramkamp hat die Volten dieser Museumskonzeption dokumentarisch in seine Verfilmung des Peenemünderomans „Die Enden der Parabel“ von Thomas Pynchon eingebaut, der Spielfilm heißt „Prüfstand 7“. Im Vorfeld sprach ich mit einer der Sekretärinnen, „Rechenmädchen“, die einst in Peenemünde unter Wernher von Braun, General Dornberger, Helmut Gröttrup u.a. gearbeitet hatten.
Seit der Wende ist der nationalsozialistische Waffen-Erprobungsstandort und spaetere NVA-Marine-Stuetzpunkt Peenemuende ein Luft- und Freilichtmuseum.
Hier kann man jetzt quasi in situ deutsche Maenner und ihre Faszination fuer Raketentechnik beobachten.
Die Erotik eines fuer den einmaligen Abschuss in den Himmel vorgesehenen Stahlkoerpers macht Ost- wie Westdeutsche nach wie vor gleich kirre. Zuletzt hat der Dichter und Sänger Jewgeni Jewtuschenko (in: „Stirb nicht vor deiner Zeit“) noch einmal auf dieses merkwuerdige Objekt maennlich-militaerischer Begierden hingewiesen – und einen am Putsch gegen Gorbatschow beteiligten Afghanistan-Veteran, der zugleich ein bekannter sowjetischer Schriftsteller geworden war, zitiert: „Ich spuerte in der Finsternis an meiner Handflaeche den schneeweissen Frauenkoerper der Kampfrakete.
Anfangs war sie noch kuehl, aber je mehr ich sie streichelte, desto waermer und waermer wurde sie, ihre Hueften schienen schwer atmend vor unausgesprochener Leidenschaft zu vergehen, und es schien mir, als wuerde ich auf dem Koerper der Rakete unter meinen Fingerkuppen gleich die Woelbungen der in Erwartung meiner Beruehrung aufgerichteten Brustwarzen spueren.“ Der internationalistische Schürzenjäger Jetuschenko zitiert diese Stelle, um mit Heiner Müller sagen zu wollen: Diesen Männern – Militärs – war das Mißgeschick passiert, dass sie zwar nicht ficken – aber töten können.
Dem US-Schriftsteller Thomas Pynchon kommt das Verdienst zu, als erster den Zusammenhang von Maennersexualitaet und Raketentechnologie herausgearbeitet zu haben: Sein Romanheld, Slothrop, wird noch waehrend der Kaempfe um Berlin auf die Spur der Nazi-Superwaffe (und eines neuen erektionsfaehigen Plastematerials) in Richtung Peenemuende gesetzt, nachdem Geheimdienste der Alliierten herausgefunden haben, dass ueberall dort, wo Slothrop in London mit einer Frau Geschlechtsverkehr hatte, wenig spaeter eine deutsche V2-Rakete einschlug.Was sich wie ein durchgeknallter amerikanischer Roman liest, ist in Wahrheit detailgenaueste Rekonstruktion: Dem ehemaligen Flugzeug-Ingenieur Pynchon stand dafuer Archivmaterial zur Verfuegung, das erst zwoelf Jahre nach Veroeffentlichung seines Romans „Gravity’s Rainbow“ freigegeben wurde (ihre dokumentarische Bearbeitung durch eine Frau, Linda Hunt, fuehrte dann uebrigens 1985 dazu, dass einige nach dem Krieg fuer das US-Militaer taetig gewesene Peenemuender Raketenforscher entehrt nach Deutschland zurueckkehrten).Selbst Pynchons kritisch-paranoisches Einstiegs-Konstrukt einer Deckungsgleichheit zwischen Slothrops privater Sex-Topographie von London und den dortigen V2-Einschlaegen hat einen quasirealen Hintergrund: das drei Jahre vor seinem Roman veroeffentlichte „Selbstportraet“ des oesterreichischen Juden Jakov Lind (1983 im Wagenbach-Verlag erschienen).
Lind „fluechtete“ 1943 mit einem hollaendischen Pass, in dem er „Overbeek“ hiess, auf einem Duisburger Binnenschiff in das Deutsche Reich.
Dabei machte er die Entdeckung, dass es ueberall, wo er hinkam, und wo er meist auch Geschlechtsverkehr hatte, Bomben regnete: „Mein blosses Erscheinen setzte Luftmarschall Harris‘ Geschwader in Bewegung.
Ich war der Superagent, im Hirn einen Hochleistungssender mit Richtstrahlen zum alliierten Oberkommando.
Diese Wahnvorstellung bestimmte meine Existenz.“Lind-Overbeek muss einen Tripper in Boppard kurieren: prompt wird Boppard bombardiert, das gleiche geschieht dann in Koblenz und schliesslich in Giessen, wo saemtliche Schutzraeume des Krankenhauses getroffen wurden: „In dieser Nacht wurde Giessen ausradiert, und auf meinen Kopf fiel ein Stueck Zement von der Groesse eines Fingernagels.“Ende 1944 wird Jakov Lind aus dem Marburger Krankenhaus als gesund entlassen, zusammen mit einem gewissen Kolberg, der Leiter einer metallurgischen Firma ist, die im Auftrag des Luftfahrtministeriums Werkstoffe fuer die Raketenherstellung prueft.
Kolberg stellt Lind zunaechst in seiner Dillenburger „Baracke Mittelfeld“ ein und nimmt ihn anschliessend mit nach Berlin ins Reichsluftfahrtministerium, zuletzt nach Hamburg, von wo aus Lind dann nach London emigrierte.Im Sommer 1994 erwarb ich anlaesslich eines Besuchs im Freilichtmuseum Peenemuende an der dortigen Kasse das Buch „Insel ohne Leuchtfeuer“ von Ruth Kraft.
Die Autorin hatte als technische Rechnerin im Windkanal des aerodynamischen Instituts der Heeresversuchsanstalt gearbeitet und diese Erfahrung dann nach dem Krieg zu einem Roman verarbeitet, der 1959 im Verlag der Nation erschien.
Das Buch wurde bis zum Ende der DDR 23mal wiederaufgelegt und insgesamt ueber 500 000mal verkauft. 1991 gab es der ehemalige kaufmaennische Geschaeftsfuehrer des Verlags in seinem eigenen Verlag, Vision, neu heraus.Zwar haben viele „Peenemuender“ ueber ihre damalige Pionierarbeit Buch gefuehrt: erwaehnt seien Walter Dornberger (von der Autorin „der General“ genannt), und sein Direktor, Wernher von Braun („der Doktor“) – aber Ruth Kraft ist die einzige Frau, die dabei auch noch im Gegensatz zu den maennlichen Autoren, bewusst Fakten und Fiktion vermischte.
Ihr autobiographischer Roman wurde dann in der DDR auch, wenigstens anfaenglich, vor allem von Frauen gelesen.“Das Buch war sofort ein Knueller, weil zuvor noch niemand ueber das Thema geschrieben hatte.“
Gleich bei ihrer ersten Lesung in Wolgast wurde Ruth Kraft von einer Mathematiklehrerin angesprochen: „Das war die in dem Roman gewesen, die den spitzen Schrei unter der Dusche ausgestossen hatte.
Sie war mir aber nicht boese. ,Aber was du mit dem Buch hier angerichtet hast . . .‘, meinte sie.“Die Autorin, Jahrgang 1920, hatte in Torgau das Lyzeum besucht und war dann einer Klassenkameradin nach Peenemuende gefolgt.
Damals wurden gerade in den Arbeitsdienstlagern Maedchen mit Abitur fuer die Heeresversuchsanstalt rekrutiert.
Obwohl ohne Abitur stellte die dortige Personalstelle Ruth Kraft aufgrund ihrer guten Mathematiknoten am 1.
Maerz 1940 ein.Sie blieb drei Jahre und lernte dabei einige hundert Leute kennen: „beruflich und auf geselliger Ebene.
Aspekte, die mir spaeter die ganze Chose am deutlichsten darzustellen schienen, habe ich mir jeweils aus verschiedenen Personen rausgesucht.
Wir lebten dort sehr freizuegig und in herrlicher Landschaft.
Es bildeten sich Freundeskreise.
Viele Maenner, Ingenieure und Wissenschaftler, waren ja Junggesellen und meist vier bis sechs Jahre aelter als die Maedchen.
Die Spitzen der Unverheirateten wohnten „Am Platz“ – Wernher v.
Braun z.B. und sein Stellvertreter Eberhard Rees, ebenso die Erprobungsflieger, zu denen gelegentlich auch Hanna Reitsch gehoerte.
Am Platz befand sich auch das Kasino, das war unser Treffpunkt.Ein Grossteil ihres Buches befasst sich mit den Liebesabenteuern der freiwilligen und dienstverpflichteten Maedchen – auf Partys, Segeltoerns in den Greifswalder Bodden, Ausfluege zum Festland und Rendezvous am Strand.
Dabei gibt es mitunter erstaunliche Parallelen zu Thomas Pynchons Darstellung.
Wenn Ruth Kraft („Eva“) z.B. eine nachlassende Verliebtheit mit Begriffen aus der Raketenforschung beschreibt: „Es war wie in einem Leitstrahl, aber jetzt kam die Umlenkung.
Was sie noch vor einem halben Jahr in die Mitte getroffen haette, beruehrte sie gerade so, wie auf ihrem Millimeterpapier die Tangente die Parabel streift.“In dem von Ruth Krafts Roman („ein fetziger Stoff“) profitierenden DEFA-Film „Die gefrorenen Blitze“ (1967) heisst es an einer Stelle: „Die Vernichtung des Gegners wird zur mathematischen Gleichung.“
Realisiert wurde dieser Nazi-High-Tech-Traum freilich erst mit den „intelligenten Bomben“ der Amerikaner.In Peenemuende, wo zwei NVA-Luftwaffenoffiziere zusammen mit einem Usedomer Geschichtsverein angefangen hatten, ein „Informationszentrum ,Geburtsort der Raumfahrt'“ aufzubauen, tauchten die zu „Amerikanern“ gewordenen Alten Kameraden schon gleich nach der Wende wieder auf, um dort ihr „Know-how“ einzubringen.Anlaesslich des 50.
Jahrestags der Bombardierung Peenemuendes fand in der Kirche von Karlshagen eine Trauerfeier statt.
In der Naehe befindet sich eine Gedenkstaette fuer die bei der Bombardierung 1943 umgekommenen Zwangsarbeiter, Kriegsgefangenen und freiwillig- bzw. dienstverpflichteten Deutschen.
Mangels genauer Namenslisten hatte die DDR sie anonym aber nach Nationalitaeten getrennt, aufgefuehrt: Hier ruhen 65 Polen, 20 Tschechen, 30 Franzosen usw.Daran hat man bis heute nichts geaendert, der deutschen Toten wird dort jedoch neuerdings mit Namensnennung auf Grabsteinen gedacht.
Initiiert hatte dies eine Gruppe ehemaliger Kriegshilfsdienst-Maiden, die Peenemuender geheiratet hatten und mit diesen dann in die USA gegangen waren.Beim ersten Insel-Treffen des in der BRD gegruendeten Vereins ehemaliger Peenemuender 1991 waren diese „Amerikaner“ besonders empoert ueber die mangelnde Pflege der Graeber durch die ehemalige DDR-Regierung gewesen.
In der Bombennacht waren auch viele ihrer Freundinnen dort umgekommen.
Der Karlshagener Pfarrer versprach daraufhin, sich um die Graeber zu kuemmern.Im Maerz 1943, „kurz nach Stalingrad“, steckte Ruth Kraft „in derart wirklich persoenlichen Konflikten“, dass sie unbedingt von Peenemuende weg wollte.
Ihr letzter Verehrer dort war ein oesterreichischer Testpilot gewesen, den man nach Dresden zu den Junkerswerken abkommandiert hatte.Das „Kraftchen“, wie Ruth Kraft in Peenemuende hiess, wurde am 1.
April 1943 in der Wehrkreisverwaltung Stettin angestellt.
Sie war fuer die weiblichen Jugendlichen in den Lazaretten, beim Heeres-Sanitaetspersonal und in den Frauenarbeitslagern zustaendig.
Als sie die Nachricht von der Bombardierung Peenemuendes, am 18.
August 1943, erreichte, fuhr sie – mit einem Dienstreisebefehl – sofort dorthin: „Ab Swinemuende herrschte bereits Chaos.
Aber ich kam durch, und nahm an der Generalsbesprechung teil.
Ich habe dann die Belange der Frauen da vertreten.
Meine fruehere Abteilung wurde nach Kochel in Oberbayern verlegt.
Ich ging zurueck nach Stettin und unternahm in der Folgezeit viele Dienstreisen.
Meine Hauptperson, Eva, arbeitet in einer Ruestungsfabrik, ich selbst war jedoch nur als Inspekteurin in solchen Fabriken.
Als die Stadt Ende Maerz von der oestlichen Oder-Seite beschossen wurde, verlegte man unsere Dienststelle nach Schwerin, das weibliche Personal kam in die Moltke-Kaserne.“Schon bald wurden sie auch von dort vor den anrueckenden Russen in Sicherheit gebracht – mit Lkw in Richtung Norden, nach Daenemark: Ein Stabsintendant war unser Reiseleiter.
Kiel stand in Flammen, in Luebeck stuermten die Fremdarbeiter gerade das Verpflegungsdepot.
In Rendsburg machten wir uns schliesslich selbstaendig, uebernachteten auf Heuboeden.“Sie fanden Arbeit im Krankenhaus.
Dann kamen die Englaender.
Ruth Kraft gelang es schliesslich, sich bis in ihre Heimatstadt Schildau durchzuschlagen.
In ihrem Haus hatte sich jedoch der sowjetische Stadtkommandant einquartiert: „Verwandte von uns besassen einen Bauernhof, dort haben wir in der Landwirtschaft gearbeitet.
Abends sassen wir beisammen und beschaeftigten uns mit Literatur.
Mein Vater wurde dann enteignet, meinen Verwandten die Hoefe weggenommen, ich wusste nicht, was werden sollte.
Es war eine Flucht in die Literatur.
Man riet mir, nach Leipzig zu gehen, wo sich jetzt in Auerbachs Keller die Intellektuellen aus den KZs und der Emigration treffen wuerden. Im Winter 1945 kam Ruth Kraft bereits mit einigen „aus dieser Truppe“ in Kontakt: Erich Loest und Georg Maurer z.
B., in Dresden dann Ralph Giordano, Rudolf Leonhardt und Ludwig Renn.
Auch ihren spaeteren Ehemann, Hans Bussenius, lernte sie in Leipzig kennen.
Er arbeitete als Regisseur beim Mitteldeutschen Rundfunk.
Ab 1947 schrieb auch Ruth Kraft fuer das Radio – als Freie Mitarbeiterin beim Kinderfunk: „Der junge Goethe“ hiess eine ihrer ersten Sendungen.Dennoch wurden in der DDR viele positive Besprechungen nie gedruckt und einen Preis hat sie fuer ihren Erfolgsroman auch nie bekommen, das Buch passte nicht in den realen Sozialismus.
Die Antifas waren dagegen.
„Ein beruehmter Schriftstellerkollege hat mir einmal gesagt, ich haette damit den Nationalsozialismus verharmlost, auch das juedische Problem.
Meine Heldin, Eva, ist naemlich eine, wie es damals hiess, Halbjuedin, die ein HJ-Fuehrer kurzerhand zur Vierteljuedin erklaert hatte, und damit durfte sie in den Arbeitsdienst.
Das gab es.
Ich bin aber keine Halbjuedin, eine sehr nahe Freundin unserer Familie war jedoch eine, die auch, wie die Eva in meinem Roman, ueberlebt hat.
Meine Nachbarin in Babelsberg, Hilde, die Frau von Hans Marchwitza, sagte einmal zu mir: ,Ruth, Sie sind eine grosse Erzaehlerin, aber Ihre Heldin haette untergehen muessen.'“Ihr Roman wurde auch in Amerika gelesen, bei den dortigen „Peenemuendern“ vor allem, z.
B. in Huntsville, wo Wernher von Braun es „wohlwollend“ aufgenommen haben soll.Das erste Nachwende-Treffen der Alten Kameraden fand im Mai 1990 an der Normandiekueste statt, von wo aus die V2 gen England abgeschossen worden waren.
Im September 1991 lud man aber bereits erstmalig nach Peenemuende ein.
Ruth Kraft traf dort die letzte Sekretaerin des „Raketenbarons“, Dorette Kersten, wieder (sie hatte in Peenemuende einen Leutnant geheiratet und war mit ihm zusammen dem „Von-Braun-Team“ nach Amerika gefolgt).Frau Kersten versicherte der Autorin, dass das Buch immer einen „sehr guten Platz“ in ihrem Haus haben werde.
„Der Doktor“, von Braun, kommt bei Ruth Kraft in der Tat sehr gut weg.
In der DDR hat man ihr denn auch gerade „die positive Darstellung Wernher von Brauns uebelgenommen: Ich haette ihn zum halben Widerstandskaempfer gemacht“, hiess es.Im DEFA-Film „Die gefrorenen Blitze“ machte man spaeter statt dessen einen eigensinnigen Triebwerks-Ingenieur zum halben Peenemuender Widerstandskaempfer.
Dem Drehbuch-Autor und MfS-Offizier Harry Thuerk stand dafuer wahrscheinlich der seinerzeit fuer den englischen Geheimdienst zusammengestellte „Oslo-Bericht“ ueber die V2 zur Verfuegung, an dem der Peenemuender Ingenieur Kummerow mitgearbeitet hatte.
Er wurde dafuer am 4.
Februar 1944 hingerichtet.Sowohl im DEFA-Film als auch bereits in Ruth Krafts Buch wird die Verbindung von Raketentechnik und Atomkraft thematisiert.
Im Roman freundet sich Eva mit dem Atomphysiker Tiefenbach an, der „als Kernforscher bei den Raketenbauern nicht am richtigen Platz war“.
Und dann gibt es da noch einen Physiker Leupold, der in Wirklichkeit Max Steenbeck hiess.
Er wurde spaeter von den Sowjets zur Mitarbeit an der Atombombe verpflichtet und war dann der einzige deutsche Wissenschaftler, der bei der anschliessenden Konstruktion einer Neutronenbombe seine Mitarbeit verweigerte (mit einer Art Streik), weswegen er auch zu den allerletzten gehoerte, die 1956 in die DDR repatriiert wurden, wo 1978 seine „Schritte auf meinem Lebensweg“ erschienen.
In Peenemuende hatte Ruth Kraft vor allem den Quantenmechaniker Pascual Jordan kennengelernt.
Er interessierte sich fuer ihre Gedichte, die sie damals angefangen hatte zu schreiben.
Spaeter traf sie ihn noch einmal in Hamburg wieder.Mit Beginn der sechziger Jahre machte sie sich an eine weniger biographisch orientierte Fortsetzung ihres Romans, in dem es ihr vor allem um die Frage der „Verantwortung von Wissenschaftlern“ ging.
Dazu besuchte sie „als erste deutsche Frau“ sogar das sowjetische Atomforschungszentrum Dubna.
Ihr Buch erschien 1965 in der DDR unter dem Titel „Menschen im Gegenwind“.Die Handlung war in der BRD angesiedelt und statt „Eva“ spielte der Kernforscher „Tiefenbach“ darin die Hauptrolle.
Er war aus Amerika zurueckgekehrt und suchte eine Anstellung in der sich gerade zusammenfindenden europaeischen Atom-Industrie.Auch dieses Buch, das in der DDR zehn- mal wiederaufgelegt wurde, erschien nach der Wende im Vision-Verlag.
In einem Nachwort schreibt die Autorin 1993, dass sie ihr Buch vor der Neuauflage „gruendlich ueberarbeitet“ habe, d. h. alles „Indoktrinierte“ entfernt – es hatte sowieso „dem Buch nur geschadet, dass ich auf alle Fragen eine Antwort zu wissen meinte“.Beim ersten Nachwende-Treffen der Raketenbauer in Peenemuende, 1991, kannten viele nur ihren ersten Peenemuende-Roman, den sie „zu erotisch“ fanden.
Auf einer gemeinsamen Bootsfahrt zur Greifswalder Oie, dem frueheren V1- und V2-Probeabschuss-Ort, wo im uebrigen auch 400 der etwa 2000 beim Luftangriff ums Leben gekommenen Zwangsarbeiter verscharrt worden waren, interviewte eine Wendtlaendische Filmgruppe Ruth Kraft: „Das stiess einigen Peenemuendern sehr sauer auf: ,Mein Buch muesste man in die Ostsee schmeissen‘, schimpften sie.“1992 wollte der Bundesverband der Luftfahrtindustrie den ersten erfolgreichen Abschuss einer deutschen Mittelstreckenrakete (V2), am 3.
Oktober 1942, spektakulaer in Peenemuende feiern.
Ein Staatssekretaer aus dem Wirtschaftsministerium, Riedl, sollte eine Rede halten.
Nach Protesten aus dem In- und Ausland musste er jedoch davon Abstand nehmen.Dafuer sprach im Festzelt neben dem Pynchonforscher Friedrich A.
Kittler der V1-Mitarbeiter und Testpilot Max Mayer, den Stoltenberg als Raketenexperte ins Verteidigungsministerium geholt hatte: „Er spielt ueberhaupt bei den Peenemuendern eine grosse Rolle. 1992 hatte ich aber zum Tag der Deutschen Einheit noch andere Einladungen, deswegen tauchte ich nur kurz im Hotel Baltic in Zinnowitz auf, wo die Crew wohnte, die Journalisten waren in Karlshagen untergebracht.
Weil ich das Goldene Kalb, das A4, wie wir die V2 nannten, nie angebetet habe, konnte ich auch immer offen darueber reden.
Bei den alten Peenemuendern gibt es zudem immer noch eine Menge Antisemiten.
Das war auch ein Grund fuer die Aversionen gegen mein Buch: dass ich das juedische Problem mit der Raketengeschichte verflochten hatte.
Hinzu kommt: Ich bin keine Expertin, ich bin eine Frau und ich war in der DDR zu Hause.“ Dem 3. ebenso wie den darauffolgenden Inseltreffen der Peenemuender blieb Ruth Kraft fern.
Dort trat jedoch der ehemalige technische Direktor von Peenemuende, Arthur Rudolph, der mittlerweile als Rentner in Hamburg lebte, erstmalig wieder auf.
Durch die Veroeffentlichung von Akten ueber die Kriegsverbrechen der Peenemuender (vor allem in den Harzer „Mittelwerken“, wo die V2 serienmaessig von KZ-Haeftlingen hergestellt wurde) war Arthur Rudolph, der spaetere hochdekorierte Pershing-Konstrukteur, 1985 aus den Vereinigten Staaten vertrieben worden.Im Sommer 1993 hatte zudem noch ein Osnabruecker Historiker, Rainer Eisfeld, im Koblenzer Bundesarchiv, wo auch noch einige Peenemuender Rechenarbeiten von Ruth Kraft liegen, Unterlagen darueber gefunden, dass Arthur Rudolph schon im Juni 1943 fuer Peenemuende 1400 KZ-Haeftlinge von der SS angefordert hatte.
Durch die Bombardierung war es dazu dann nicht mehr gekommen.
In Peenemuende ging nur noch das Vorserienwerk in Betrieb – bis zum Januar 1945, als die gesamte Heeresversuchsanstalt wegen der heranrueckenden Front geraeumt werden musste.Die Sowjets uebernahmen nach Kriegsende im wesentlichen die unterirdischen Harzer „Mittelwerke“, um die herum sie unter der Leitung des Diplomingenieurs Helmut Groettrup und ca. 600 deutschen Mitarbeitern sofort eine neue V2-Fertigung aufbauten: Die sogenannten „Zentralwerke“.
Nachdem die Raketenproduktion in diesem Betrieb erfolgreich angelaufen war und ein Fuenfjahresplan des Obersten Sowjets die Raketen- und Atombombenentwicklung gleichberechtigt nebeneinander zu forcieren vorsah, wurden die „Zentralwerke“ am 22.
Oktober 1946 mit Mann und Maus nach Russland verlegt.
Dabei konzentrierte man die zweite Garde der deutschen Raketentechniker (die erste hatten die Amerikaner in einer „Operation Paperclip“ sowie die Englaender eingesammelt) in ihrer Mehrzahl an einem Standort auf der Insel Gorodomlia im Seeliger See.Es gibt darueber mittlerweile einen systematischen Bericht der Historiker Albrecht, Heinemann-Grueder und Wellmann, 1992 unter dem Titel „Die Spezialisten“ im Dietz-Verlag veroeffentlicht.Aehnlich gruendliche Recherchen gibt es weder ueber die nach Amerika und England abgewanderten deutschen Wissenschaftler noch fuer die nach 1945 in franzoesische Dienste getretenen, schon gar nicht ueber jene Gruppe deutscher Ingenieure, die im Auftrag von Staatspraesident Nasser an einer aegyptischen Rakete gegen Israel arbeitete.
Sie wurde teilweise vom israelischen Geheimdienst Mossad mit Paketbomben dezimiert.Einige Mitarbeiter sollen in den siebziger Jahren in der Abschreibungsfirma von Lutz Kayser, OTRAG (Orbit-Transport-Aktiengesellschaft) eine neue Anstellung gefunden haben.
Aufsichtsratsvorsitzender dieses Konsortiums fuer den Bau von „Billigraketen“ war der Peenemuender Kurt Debus, sein alter Raketentechniker Richard F.
Gomperts wurde Konstruktionschef.
Als Versuchsfeld hatte die OTRAG ein Gelaende in Zaire von der Groesse Oesterreichs erworben, fuer das sie mit dem Staatspraesidenten Mobutu ausserdem eine „freie Uranausbeutung“, „gesperrten Luftraum“ und die „Durchfuehrung beliebiger Arbeiten“ aushandelte.Gestuetzt auf Geheimdiensterkenntnisse outete 1976 ein Mitarbeiter der New York Times, Szule, die Firma von Lutz Kayser als „ein Unternehmen der Ruestungskonzerne Messerschmitt, Boelkow, Blohm“ (die heute zusammen mit der Dornier GmbH als Deutsche Aerospace AG, DASA, firmieren und zur Daimler-Benz AG gehoeren).
Die OTRAG-Experimente beendete spaeter der Buergerkrieg in Zaire.Die DASA gruendete 1990 eine „Deutsche Agentur fuer Raumfahrtangelegenheiten“, DARA GmbH, in deren „Sonderauftrag“ der Dornier-Wissenschaftler Dr.
Dieter Genthe 1991 eine Studie „Zur Realisierbarkeit eines Raumfahrtparks/Space Park in der BRD“ erstellte.
Diese Studie wurde dann Grundlage fuer eine „Betriebsgesellschaft Raumfahrtpark Peenemuende“, die der Landkreis Ostvorpommern, die Kommune Peenemuende und die Kreissparkasse Wolgast 1994 gruendeten.Zum Geschaeftsfuehrer ernannten sie den amerikanischen Pensionaer Veit Hanssen.
Auch die zwei NVA-Offiziere vor Ort, Profe und Saathoff, waren mit von der Partie.
Hanssen trennte sich jedoch schon bald von ihnen, weil sie ihm nicht „unbelastet“ genug waren („Ich moechte im Park keine MiGs und DDR-Kriegsschiffe sehen!“).
Dafuer wollte er ein „Astronauten-Trainingscenter“ in Peenemuende bauen.Zuvor hatte das Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern noch eine Herrenrunde mit der Begutachtung der DARA-Studie beauftragt: ein knappes Dutzend namhafter Museumsberater und -leiter des In- und Auslands, darunter auch einige Offiziere der Bundeswehrmuseen, sowie den Leiter der KZ-Gedenkstaette „Mittelbau-Dora“ im Harz, die das „Space Park“-Konzept einhellig ablehnten: Weder bestehe dafuer eine „bildungspolitische Notwendigkeit“, noch sei Peenemuende ueberhaupt die „Wiege der Raumfahrt“ gewesen.
Sie bezeichneten es als „Verdraengung von Geschichte“.In einem Gegenkonzept, verfasst vom Direktor des Berliner Museums fuer Verkehr und Technik, Prof.
Guenther Gottmann, sprachen sich die Berater statt dessen fuer einen kleinen „Museums-Park Peenemuende“ aus, der an das Otto-Lilienthal-Museum im nahen Anklam angebunden werden solle.Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern aeusserte sich zu diesem Konzeptionsstreit erst einmal nicht, ebensowenig die Bundesregierung, die bei einer Stellungnahme zum Thema Peenemuende in jedem Fall Proteste aus dem Ausland befuerchtete.
Die kamen im Oktober 1994 dennoch, und zwar initiiert von einer Frau: der Ost-Berliner Historikerin Regina Scheer, die im Auftrag der Bundeszentrale fuer politische Bildung saemtliche Gedenkstaetten Mecklenburg-Vorpommern katalogisiert und dabei auch Peenemuende besucht hatte, wo sie zu ihrem Entsetzen erfuhr, dass dort inmitten der „Waffenverherrlichung“ eine neue – allgemeine – Gedenkstelle „fuer die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“ geplant sei, wobei man an erster Stelle auch noch der „Opfer der Vertriebenen aus Pommern“ zu gedenken beabsichtigte.Regina Scheer wandte sich daraufhin an die juedische Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern und diese informierte das Simon-Wiesenthal-Center in Los Angeles, wo ein Rabbiner, Abraham Cooper, sogleich eine Presseerklaerung herausgab, in der er die Bundes- und die Landesregierung sowie deutsche Firmen aufforderte, „kein Geld fuer ein Museum zu spenden, das eine Terrorwaffe in den Mittelpunkt stellt, die einst mehr als 2000 Briten und zehnmal mehr Zwangsarbeiter in Deutschland toetete“.Der Zeitpunkt des Protestes war gut gewaehlt, denn kurz zuvor war gerade eine grosse neue Studie ueber Peenemuende und die Operation Paperclip in den USA veroeffentlicht worden.
Der Verfasser, Dr. Michael Neufeld, Kurator im National Air and Space Museum, Washington, ist zugleich Mitglied in der Beraterkommission des Kultusministeriums von Mecklenburg-Vorpommern. Seine Studie ist inzwischen auch auf deutsch erschienen. Das Dara-Konzept wurde mittlerweile in Bremen realisiert – ging aber nach kurzer Zeit pleite, und das Freiluftmuseum Peenemünde gilt seit einiger Zeit als die beliebteste deutsche Freizeit- und Urlaubs-Ausflugsstätte, ihr Direktor ist ein westdeutscher Wehrdienstverweigerer, der den Besuchern ebenso multimediale wie anspruchsvolle „Aufklärung“ bieten will – und dafür keine Kosten und Mühen scheut, wie man so sagt.
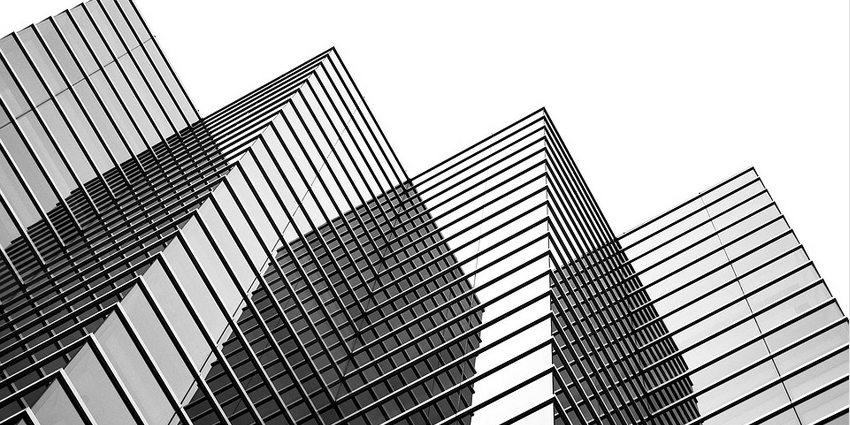



Noch mal zur Kosmonautik:
„Ab gehts!“ (Juri Gagarin beim Start)
„Mein Mann wollte gleich munter zum Mond,“ erzählte Inge Gröttrup dem Spiegel, nachdem das Ehepaar glücklich aus der Sowjetunion zurückgekehrt war. Den Steuerungsexperten Helmut Gröttrup hatte der KGB zusammen mit einer Reihe weiterer Raketenbauer aus Peenemünde gleich nach dem Krieg zur Mitarbeit an der Entwicklung einer sowjetischen Fernlenkwaffe verdonnert gehabt. Als äußerst privilegierte Zwangsarbeiter. So konnte Inge Gröttrup z.B. ihren BMW mitnehmen, mit dem sie regelmäßig zu ihrem Freund nach Moskau fuhr – einem hohen sowjetischen Militär. Wieder zurück in Deutschland wollte die CIA Helmut Gröttrup sofort für das US-Raketenprogramm „Apollo“ anheuern, aber seine Frau entschied: „Wir bleiben hier!“ Ihr Mann wurde daraufhin Leiter einer Computerentwicklungsabteilung bei Siemens, wo er wiederum einige sowjetische Experten einstellte. Als einer wegen Industriespionage angeklagt wurde, verlor er seinen Job und machte sich selbständig. In einem Vortrag vor Hamburger Geschäftsleuten führte er aus: Die unternehmerische Freiheit sei ein bloßer Irrtum, der auf Informationsmangel beruhe. Um diesen zu beheben, ließ Helmut Gröttrup zusammen mit seinem Mitarbeiter Jürgen Dethloff einen „Identifikanden mit integrierter Schaltung“ patentieren, aus der dann erst die Chipkarte und schließlich die Mikroprozessorkarte wurde, mit der wir alle heute an den Bankautomaten zu unserem Geld kommen. Sein Name ist unterdes selbst aus dem Siemens-Mitarbeiterarchiv getilgt.
Während seinem deutschen Gegenspieler im Kalten Krieg, Wernher von Braun, den sich nach dem Krieg die Amerikaner geschnappt hatten, wieder einmal eine ganze Seite in der Süddeutschen Zeitung gewidmet wurde. Auch er wollte, vom US-Präsidenten J.F. Kennedy ermuntert, rasch zum Mond. Und das „Projekt“ gelang ihm auch. Den Sowjets auf der anderen Seite war jedoch zuvor bereits der erste bemannte Weltraumflug gelungen, was in den USA erneut einen „Sputnik-Schock“ ausgelöst hatte. In Berlin wurde vor einiger Zeit nicht nur des ersten DDR-Kosmonauten Sigmund Jähn gedacht, sondern auch – im Haus der russischen Kultur, das von der ersten Kosmonautin im All geleitet wird – Juri Gagarin, mit dessen Weltraumflug für den jüdischen Philisophen Emmanuel Lévinas „das Privileg der Verwurzelung und des Exils endgültig beseitigt wurde“. In seiner Autobiographie, die einst von der DDR herausgegeben und nun wieder neu aufgelegt wurde, schreibt Juri Gagarin: „Die Familie, in der ich zur Welt gekommen bin, unterscheidet sich in keiner Weise von Millionen anderer werktätiger Familien unseres sozialistischen Heimatlandes. Meine Eltern sind schlichte russische Menschen, denen die Große Sozialistische Oktoberrevolution ebenso wie unserem ganzen Volk einen breiten und geraden Lebensweg erschlossen hat“. („Der Weg in den Kosmos“)
Der Gedanke eines geradewegs in das Universum führenden „Lebensweges“ scheint überhaupt russisch zu sein. So unterscheidet sich der sowjetische „Kosmos“-Begriff vom amerikanischen „outer space“ schon dadurch, dass ersterer mit der irdischen Lebenswelt „harmonisch“ verbunden ist, während der US-Weltraum so etwas wie eine „new frontier“ darstellt. Dies behauptet jedenfalls die in den USA lebende russische Kulturwissenschaftlerin Swetlana Boym in einem Essay zum beeindruckenden Bildband „Kosmos“ von Adam Bartos, das noch einmal das sowjetische Weltraum-Programm nostalgisch und en détail feiert. In Berlin wurde eine Ausstellung „Flug zum Himmel“ mit Bildern des russischen Malers Andrej Rudjev eröffnet. Natalia Handke hielt zu Ehren von Juri Gagarin am „Tag der Kosmonautik“ einen Festvortrag in der Treptower Archenhold-Sternwarte – über die deutschen Gagarin-Büsten und ihren Verbleib. Wladimir Kaminer veröffentlichte einen Bericht über russische Gagarin-Souvenirs im Wandel der Zeiten und Sitten. Auch in Kneipen taucht Gagarins berühmtes Lächeln plötzlich auf Postern auf. Derweil wurde die sowjetische Weltraumstation MIR verschrottet. Sigmund Jähn erklärte jedoch kürzlich, dass die internationale Station ISS eine gute Nachfolgerin sei, weil solche „Objekte des Stolzes“ den einzelnen Nationen zu teuer kämen. Die ehemaligen MIR-Kosmonauten trauern dennoch den alten Zeiten nach. Einer meinte: Als Gagarin aus dem All zurückkehrte, kam Schwung in die Sache. Aber heute sind das nur noch die letzten Zuckungen. Man will Ergebnisse sehen. „Und wir haben unser Hauptproblem dort oben nicht gelöst. Wir können seit Gagarin in den Weltraum fliegen, dort arbeiten und wieder zurückkehren, aber wir haben keine natürliche menschliche Betätigung im Weltraum – im Zustand der Schwerelosigkeit – gefunden. Bis jetzt haben wir keine produktive Tätigkeit dort oben entwickeln können. Ich empfinde das als persönliches Versagen.“