„Nach Tschewengur ging Alexej Alexejewitsch, um die Genossenschaft zu suchen – die Rettung der Menschen vor Armut und vor gegenseitiger Grausamkeit.“ (Andrej Platonow, „Tschewengur“)
Das Kernland der Genossenschaftsbewegung ist natürlich Russland.
Dort bildete sich aus dem Kreis der berühmten „Männer und Frauen der Sechzigerjahre“ die „ins Volk“ gegangen waren, um vor allem auf dem Land die Bauern zu agitieren, die Redaktionsgruppe der illegalen Zeitung „Zemlja i Volja“ (Land und Freiheit), in der zunächst noch die unterschiedlichsten revolutionären Ideen koexistierten. Auf einem Treffen in Woronesh kam es 1879 jedoch zu einer Spaltung: Während die einen, um Nikolai Alexandrowitsch Morosow, für den politischen Mord votierten, lehnten die anderen, um Georgi Plechanow und Vera Sassulitsch, Attentate strikt ab. #
Obgleich letztere 1878 selbst ein kühnes Attentat verübt hatte, indem sie den Stadtkommandanten von St. Petersburg niederschoß, weil der einen ihrer Genossen im Untersuchungsgefängnis wegen mangelnder Ehrerbietigkeit ihm gegenüber auspeitschen ließ – ungeachtet der Gerichtsreform von 1863, mit der Körperstrafen weitgehend verboten worden waren. In einem aufsehenerregenden Gerichtsprozeß (dessen Plädoyers Dostojewski später in seinen Roman „Die Brüder Karamasow“ einarbeitete) wurde Vera Sassulitsch freigesprochen. Das Urteil hob man zwar wenig später wieder auf, aber ihr gelang rechtzeitig die Flucht ins Ausland. Die Tat und der Freispruch machten sie in ganz Europa berühmt, man nannte Vera Sassulitsch „die Mutter des Terrors“, während sie selbst sich im Exil mehr und mehr von jeglichem „Attentismus“ abwandte. Ab 1900 gab sie mit Lenin zusammen die Zeitschrift „Iskra“ (Der Funken) heraus.
Die Militanten von Woronesh hatte ihren Zusammenschluß „Narodnaja Volja“ (Volkswille) genannt, die Gemäßigten für sich den Namen „Cernyi Peredel“ gewählt – schwarze Umverteilung, womit eine gerechte Verteilung des schwarzen, d.h. bewirtschaftbaren Bodens an die Bauern gemeint war. Dabei wollten sie an der altherbebrachten Form der bäuerlichen Selbstbestimmung, der Dorfgemeinschaft oder Dorfgenossenschaft bzw. Landkommune (Obschtschina), anknüpfen, die den Gemeinschaftsbesitz an Boden verwaltete. Zunächst studierte diese Gruppe um Plechanow in ihrem Exil jedoch vor allem die Schriften von Marx und Engels, die sie teilweise ins Russische übersetzten. 1881 schrieb Vera Sassulitsch einen Brief an Karl Marx: „Verehrter Bürger!
Sie wissen, daß sich Ihr Werk ‚Das Kapital‘ in Rußland großer Beliebtheit erfreut. Trotz der Konfiszierung der Ausgabe werden die wenigen verbliebenen Exemplare von einer Masse mehr oder weniger gebildeter Leute in unserem Land wieder und wieder gelesen; bedeutende Menschen befassen sich damit. Aber was sie vielleicht nicht wissen, ist, welche Rolle ‚Das Kapital‘ in unseren Diskussionen über die Agrarreform in Rußland und über die ländliche Kommune spielt. Sie wissen besser als jeder andere, wie dringlich diese Frage in Rußland ist. Sie wissen, was Tscherynschewski darüber dachte. Unsere fortschrittliche Literatur wie die [einst von Nekrassow redigierte Zeitschrift] ‚Vaterländische Notizen‘ zum Beispiel, entwickelt seine Ideen weiter fort. Aber diese Frage ist meiner Ansicht nach eine Frage von Leben und Tod…Eines von beidem: Entweder ist diese Landbevölkerung, einmal von den unmäßigen Forderungen des Fiskus, den Zahlungen an die Großgrundbesitzer und von der willkürlichen Verwaltung befreit, fähig, sich in sozialistischer Richtung weiterzuentwickeln, d.h. ihre Produktion und die Verteilung der Güter auf kollektivistischer Basis zu organisieren. In diesem Fall muß der sozialistische Revolutionär all seine Kräfte der Befreiung der Landbevölkerung und ihrer Entwicklung zur Verfügung stellen. Wenn hingegen die ländliche Kommune zum Untergang bestimmt ist, bleibt den Sozialisten nur noch übrig, sich mehr oder weniger gut begründeten Rechnungen hinzugeben, um herauszufinden, in wie vielen Jahrzehnten das Land des russischen Bauern aus seinen Händen in die der Bourgeoisie übergeht…Sie werden dann einzig unter den Arbeitern in den Städten Propaganda machen müssen, die ständig von der Menge der Bauern überschwemmt sein werden…“
Marx gab sich große Mühe bei der Beantwortung des Briefes von Vera Sassulitsch – er lernte sogar Russisch, um dabei einige Originalquellen heranziehen zu können. Schließlich schrieb er ihr – auf Französisch:
In Westeuropa sei die „Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln“, die „Expropriation der Ackerbauern“ ausgehend von England mit „historischer Unvermeidlichkeit“ vollzogen worden, aber in Russland könnte „die Dorfgemeinde der Stützpunkt der sozialen Wiedergeburt Russlands“ sein. Nur „müsste man zuerst die zerstörenden Einflüsse, die von allen Seiten auf sie einstürmen, beseitigen“. Der Ackerbaugemeinde wohnt laut Marx ein Dualismus inne, der „sie mit großer Lebenskraft erfüllen kann, denn einerseits festigen das Gemeineigentum und alle sich daraus ergebenden sozialen Beziehungen ihre Grundlage, während gleichzeitig das private Haus, die parzellenweise Bewirtschaftung des Ackerlandes und die private Aneignung der Früchte eine Entwicklung der Persönlichkeit gestatten, die mit den Bedingungen der Urgemeinschaft unvereinbar ist. Aber es ist nicht weniger offensichtlich, dass der gleiche Dualismus mit der Zeit zu einer Quelle der Zersetzung werden kann.“ Neben dem Privateigentum „in Gestalt eines Hauses mit seinem Hof“ könnte sich insbesondere „die parzellierte Arbeit als Quelle der privaten Aneignung“ zersetzend auswirken: „Sie läßt der Akkumulation beweglicher Güter Raum“ und „dieses bewegliche, von der Gemeinde unkontrollierbare Eigentum, Gegenstand individuellen Tausches, wobei List und Zufall leichtes Spiel haben, wird auf die ganze ländliche Ökonomie einen immer größeren Druck ausüben. Das ist das zersetzende Element der ursprünglichen ökonomischen und sozialen Gleichheit. Es führt heterogene Elemente ein, die im Schoße der Gemeinde Interessenkonflikte und Leidenschaften schüren, die geeignet sind, zunächst das Gemeineigentum an Ackerland, dann das an Wäldern, Weiden, Brachland etc. anzugreifen, die, einmal in Gemeindeanhängsel des Privateigentums umgewandelt, ihm schließlich zufallen werden.“
Noch vor Vera Sassulitsch hatte auch die Terroristenfraktion der Narodniki, die ebenfalls gemäß ihrer Statuts für den Erhalt der Obschtschina war, Marx, der sie einmal als „Alchimisten der Revolution“ bezeichnet hatte, einen Brief geschrieben. Darin wurde jedoch nur der baldige Besuch eines ihrer Genossen, Lew N. Hartmann, bei ihm in London angekündigt. Juri Trifonow erwähnt dies in seinem Roman über die Gruppe um Morosow: „Die Zeit der Ungeduld“. Der Gutsbesitzersohn Morosow bekam im übrigen nach der Revolution als verdienter Genosse von den Bolschewiki den Gutshof seiner Väter – in Borok – zurück, um daraus eine limnologische Forschungsstation zu machen, die später zur weltweit größten dieser Art wurde – und noch heute existiert. Ihr wissenschaftlicher Leiter war lange Zeit Boris Kusin, der u.a. Ossip Mandelstam zum Lamarckismus „bekehrte“. Man spricht in diesem Zusammenhang manchmal auch vom „Lamarxismus“
Die noch quasi urkommunistisch organisierte Obschtschina auf Basis einer weitgehenden Subsistenzwirtschaft zersetzte sich nicht nur langsam von innen, sondern man versuchte auch – und das bis in die jüngste Zeit – sie immer wieder von oben zu zerschlagen, d.h. von der Zentralmacht aus, weil ihr dieser der Prozeß der inneren Auflösung der Dorfgemeinschaften nicht schnell genug voranschritt. Das geschah einmal mit der Landreform von 1861, nach der die von der Leibeigenschaft „befreiten“ Bauern sich zugleich bei den Gutsbesitzern verschulden und damit verdingen mußten.
Dann unter dem Druck der Revolution von 1905/07 mit den Stolypinschen Agrarreformen, die den sozialen Differenzierungsprozeß beschleunigen sollten und es jedem Gemeindemitglied ermöglichten, seinen Landanteil zu verkaufen und wegzuziehen. Schließlich ab 1928 mit der Verstaatlichung des gesamten Landes und der Kollektivierung der armen und Mittelbauern bei gleichzeitiger Liquidierung der als ausbeuterisch klassifizierten Kulaken. Aus der Obschtschina wurden dabei Kolchosen und Sowchosen und aus freien Bauern befehlsempfangende Landarbeiter, denen man ab 1932 sogar den Paß abnahm, ohne den sie ihr Dorf nicht verlassen durften.
Unter Chruschtschow faßte man 1956 die Dörfer und Produktionskollektive zu „territorialen Wirtschaftseinheiten“ zusammen. 1970 erfolgte unter Breschnew ihre „Reorganisation“. Und 1986 wurde aus dem alten Wort für „Dorfplatz“ – MIR – eine Weltraumstation. Zur selben Zeit bedauerte nebenbeibemerkt der bayrische Filmemacher Herbert Achternbusch: „Da wo früher Pasing und Starnberg waren, ist nun Welt! – die Welt hat uns vernichtet, das kann man sagen.“
Zuletzt nach 1990 wurden in Russland insbesondere die wenig produktiven Kolchosen und Sowchosen aufgelöst oder sie zerfielen langsam, andere wurden von ihren Leitungskadern aber auch von reichen Städtern privatisiert, d.h. in GmbHs, Aktiengesellschaften oder ähnliches umgewandelt bzw. zerschlagen. Gleichzeitig entstanden jedoch an vielen Orten auf dem postsowjetischen Territorium auch wieder neue, selbstorganisierte Obschtschinas, nicht selten in Form von Sippenverbänden und Gemeinschaften der einst nach Osten verbannten Kulaken; daneben gab es auch wieder Genossenschaften, Artel, Kommunen. Der Geist der alten Dorfgemeinschaft erfaßte sogar Datschensiedlungen. Die kollektive Wirtschaftsweise und die Obschtschina-Idee sind also auch heute noch nicht tot. Sie hatte, wie bereits Trotzki bemerkte, u.a. in den städtischen Fabriken überlebt, wo einzelne Kollektive sich aus ehemaligen Dorfgemeinschaften zusammensetzten, ähnliches galt sogar für die Arbeitslager, Gefängnisse und die neugebauten Hochhäuser am Stadtrand, in denen man bisweilen „Dorfälteste“ wählte. Überhaupt hat noch jede russische Revolte und Revolution die Obschtschina gestärkt.
Im Jahre 1905 befanden sich 9,5 Millionen Bauernhaushalte in Dorfgemeinschaften, daneben gab es 2,8 Mio Einzelhöfe. Deren Zahl verdoppelte sich in der Folgezeit – bis 1917 sämtliche „Reformbemühungen“ von oben „nahezu zunichte gemacht wurden“, wie der antikommunistische US-Historiker Robert Conquest in seinem Buch über die Kollektivierung „Ernte des Todes“ schreibt. Denn Millionen von Kleinbauern nahmen unter der bolschewistischen Parole „Das Land denen, die es bearbeiten“ den Großgrundbesitzern das Land weg „und schlossen sich verstärkt in Dorfgemeinschaften zusammen“, daneben entstanden eine Unzahl von Kommunen, Artel (Genossenschafen) und „befreite Gebiete“. 1927 bewirtschafteten die Dorfgemeinschaften 95 Prozent des Gutsbesitzes, nur 3,5 Prozent waren noch „eigenständige Höfe vom Stolypin-Typus“.
Auf die in Vera Sassulitschs Brief aus dem Jahr 1881 enthaltene Frage, warum ein revolutionärer Kampf für den Erhalt der russischen Dorfgemeinschaft sinnvoll sein könnte, schrieb Marx: „Ich antworte: Weil in Russland, dank eines einzigartigen Zusammentreffens von Umständen, die noch in nationalem Maßstab vorhandene Dorfgemeinde sich nach und nach von ihren primitiven Wesenszügen befreien und sich unmittelbar als Element der kollektiven Produktion in nationalem Maßstab entwickeln kann.“
Unter Alphabetisierung, Aufklärung und politische Agitation auf dem Land verstand man auch und vor allem die Vermittlung agrarwissenschaftlicher Kenntnisse und Techniken. Dabei bildete das Studium der Schriften von Lamarck und Darwin sozusagen die Grundlage. Letzterer hatte sich nach 1859 immer mehr an die teleologische Evolutionstheorie von Lamarck angenähert, wobei dieser Aspekt in der russischen Rezeption von vorneherein betont worden war. So griff Darwin z.B. bei seiner „Erklärung der Evolution des Menschen und seines Verhaltens“ auf die lamarckistische „Hypothese der Vererbung erworbener Eigenschaften“ zurück, erst recht dann in seiner 1871 erschienenen Schrift „Die Abstammung des Menschen durch natürliche Zuchtwahl“, in der es heißt: „Das höchste Element der menschlichen Natur“ wurde und wird „entweder direkt oder indirekt durch die Folgen von Gewohnheit, Geisteskräften, Belehrung, Religion etc. vorangetrieben, viel mehr als durch die natürliche Auslese“. Dieser „Lamarckismus“ half ihm, wie der Biologiehistoriker Torsten Rüting sagt, „sicher zu stellen, dass der Fortschritt unweigerlich, kontinuierlich und auf einen Zweck gerichtet voranschreitet“ – am Ende also die Tugend triumphiert!
Das mußte auch und gerade der Arbeiterbewegung gefallen: Wenn nicht einmal in der Natur die Dinge mehr ewig und unveränderlich waren, dann erst recht nicht in der Gesellschaft – sie stellten Darwin gewissermaßen vom Kopf auf die Füße. So bestand etwa Moses Hess darauf, „daß auch die selbständige Entwicklung der menschlichen Gesellschaft den Naturgesetzen der Entwicklung unterworfen ist“. Die Theoretiker der Arbeiterbewegung „trafen sich in diesem Punkt mit jenen bürgerlichen Autoren, die den bestehenden feudalen Strukturen kritisch gegenüberstanden und in der Evolutionstheorie eine weltanschauliche Waffe für ihren Kampf um die Modernisierung und Demokratisierung sahen,“ schreiben Kurt Bayertz und Wolfgang Krohn in einem Aufsatz über Friedrich Engels Schrift „Dialektik der Natur“, weiter heißt es bei ihnen: „…wenngleich jedoch auch für Engels kein Zweifel daran besteht, daß die menschliche Geschichte nur die Fortsetzung der Naturgeschichte ist, so wendet er sich doch energisch gegen die von zahlreichen Theoretikern unternommenenen Versuche, die Mechanismen der organischen Evolution (‚Kampf ums Dasein‘) unmittelbar auf die Gesellschaft zu übertragen, da diese der Spezifik menschlichen Handelns nicht gerecht wird. Die menschliche Gesellschaft unterscheidet sich von der Naturgeschichte dadurch, daß die Menschen ihre Geschichte selbst, mit Bewußtsein, machen…“
Dennoch ist der Unterschied zwischen (Darwinscher) Naturgeschichte und menschlicher Kulturgeschichte für Engels kein absoluter, weil „die unkontrollierten Kräfte“ auch in der menschlichen Geschichte noch immer „weit mächtiger sind als die planmäßig in Bewegung gesetzten…Darwin wußte nicht, welch bittere Satire er auf die Menschen und besonders auf seine Landsleute schrieb, als er nachwies, daß die freie Konkurrenz, der Kampf ums Dasein, den die Ökonomen als höchste geschichtliche Errungenschaft feiern, der Normalzustand des Tierreichs ist.“ Für Engels, ebenso wie auch für August Bebel, hebt deswegen nur eine bewußte, planmäßige Produktion den Menschen aus der Tierwelt heraus: Erst der Sozialismus wird diesem „Kampf“ ein Ende bereiten – und die Menschheit in eine neue Phase eintreten, in der kein Ressourcenmangel mehr herrscht – und ein „neuer Mensch“ auf den Plan getreten ist. – Dessen Anfänge sich natürlich gemäß der 3. Marxschen Feuerbachthese noch selbst „umerziehen“ müssen.
Dazu wußte z.B. die Terroristin Vera Figner, die bis zu ihrer Verhaftung im Vorstand der „Narodnaja Wolja“ aktiv war, aus eigener 20jähriger Gefängnis-Erfahrung mitzuteilen: „Ich glaube, es ist unmöglich, in langjähriger absoluter Einzelhaft psychisch intakt zu bleiben, nicht wahnsinnig zu werden. Doch daß man nach einem langjährigen Aufenthalt in einer Gemeinschafts-Zelle seine Seele noch intakt bewahrt, scheint mir einzig und allein mit Hilfe einer großen Selbstdisziplin und Umerziehung möglich…“ Es Vera Figner gleich tuend, nahmen derart viele Russinnen im ausgehenden 19. Jahrhundert ein solches „Projekt“ in Angriff, „dass die Frau in Rußland überhaupt zur Seele der Revolution“ wurde, wie eine ihrer Historikerinnen, Fannina Halle, schrieb. Dem lebenslänglich verbannten Dichter Tschernyschewski kommt dabei der Verdienst zu, mit seinem Roman „Was tun?“, den er 1863 in der Peter-Pauls-Festung verfaßte, eine Antwort darauf gegeben zu haben, wie sich die Frauenfrage aus der Theorie in die Praxis umsetzen ließe. „Wir lasen sein Buch mit gebeugten Knien“, erinnerte sich ein ebenfalls nach Sibirien Verbannter, der sich davon mit etlichen anderen zum Terrorismus hatte inspirieren lassen. In Tschernyschewskis Werk „Was tun?“, geht es darum, dass eine Frau aus dem Familienleben ausbricht, um wirtschaftlich unabhängig zu sein und einen sozialen Wirkungskreis zu haben. Dazu gründet sie einen „auf kaufmännischer Grundlage aufgebauten kommunistischen Artel – als erste Zelle eines zukünftigen sozialistischen Staatsorganismus“. Nach Erscheinen des Buches, das einen „Sturm“ auslöste, befürchteten Eltern und Ehemänner, dass ihnen die Töchter bzw. Ehefrauen weglaufen würden – was tatsächlich hier und da auch geschah, so entstanden an vielen Orten „Arbeitsgenossenschaften“. In der Hauptstadt lebten die Frauen in sogenannten Petersburger Kommunen – zusammen mit Studenten. Hier begannen sie mit der Agitation unter Fabrikarbeitern, wobei einige der Frauen bald, „mit falschen Bauernpässen“ versehen, anfingen, in Textilfabriken zu arbeiten.
Über die damalige Rezeption der Darwinschen Theorie in Russland schreibt der Biologiehistoriker Torsten Rütting: „Während Darwins ‚Origin of Species‘ in der schwerfälligen Übersetzung des Botanikprofessors Sergej Raschinskij mit ihren detaillierten wissenschaftlichen Beschreibungen nur eine kleine Schicht von Gelehrten ansprach“, wurde vor allem eine umfangreiche Interpretation seiner Schriften von Dimitrij Pissarew berühmt, die „unverkennbar den Stempel der radikalen Bewegung“ trug. Der junge Publizist und Narodnikisympathisant schrieb sie während einer mehrmonatigen Festungshaft, wo er in einer Einzelzelle direkt neben Tschernischewski saß, wie Wladimir Nabokov in seiner Biographie über diesen hervorhob. Pissarew veröffentlichte seine Darwin-Interpretation 1864 in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Russkoje Slovo“ (Das russische Wort). Laut Torsten Rüters machte er darin jedoch erst recht einen „lamarckistischen Darwinismus in Russland populär“, denn er verfehlte das „essentiell Neue an Darwins Idee – das Ineinandergreifen von Variabilität und Selektion“, indem er die „Zweckmäßigkeit in der Organismenwelt als durch bewußte Zielstrebigkeit und Willensanstrengung erwirkte Umweltanpassung der Organismen“ erklärte. „Seine Ausführungen waren konzipiert als ideologische Waffe in den Auseinandersetzungen der 1860er-Jahre um die Erneuerung der russischen Gesellschaft…“ Und diese Kämpfe reichten bald immer tiefer.
So berichtet Maxim Gorkij aus der Zeit seines Wanderlebens in „Meine Universitäten“, wie sie in den ärmlichsten Kellerwohnungen Tschernyschewskis und Pissarews Texte studierten, an den Wänden hingen Bildnisse von Herzen, Darwin und Garibaldi, und ein Tolstoianer fragte sie nach seinen Ausführungen polternd: „Seid ihr also für Christus oder für Darwin?“ In den deutschen Arbeiterbüchereien hatte zur selben Zeit ein Buch mit dem Titel „Moses oder Darwin“ die größte Ausleihquote, wie Eric Hobsbawm in seiner Geschichte des „Imperialen Zeitalters“ erwähnt. Gorkij wurde dann von einem ehemals Verbannten mit weiteren „naturwissenschaftlichen Büchern“ versorgt, wobei der ihm riet: „Sie müssen lernen, aber so, daß das Buch Ihnen die Menschen nicht verdeckt.“
Für die gesamte russische Literatur dieser Epoche war es laut Rosa Luxemburg kennzeichnend gewesen, „daß sie aus Opposition zum herrschenden Regime, aus Kampfgeist geboren wurde“. Ein Jahr bevor Nikolai Tschernyschewski seine Erzählung „Was tun?“ veröffentlichte, erschien im „Russki westnik“ (Russische Nachrichten) Iwan Turgenjews Roman „Väter und Söhne. Er skizzierte darin als erster den „Neuen Menschen“ – den Revolutionär als „Beweger“, wie er bald geradezu massenhaft in Erscheinung treten sollte. Die Handlung spielt Ende der Fünfzigerjahre und die Hauptfigur darin, der Medizinstudent Basarow, gehört noch zur Rasnotschinzengeneration, d.h. zu jener revolutionären Bewegung, die nicht mehr wie die Dekabristen zuvor von Adligen angeführt wurde, sondern von Leuten „unterschiedlichen Ranges“, Kleinbürgern also. Turgenjew nennt sie „Nihilisten“ – und meint damit „Revolutionäre“.
Sie scharrten sich in jenen Jahren vor der Aufhebung der Leibeigenschaft 1861 um die Zeitschrift „Russkoje slowo“ und „betrachteten die Aneignung und Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse als einzigen Weg zum Fortschritt Russlands“, wie Klaus Dornbacher im Nachwort zur DDR-Ausgabe von Turgenjews „Väter und Söhne“ schreibt. Weiter heißt es dort: Tschernyschewskis Roman sei dazu sowohl „eine Art Fortsetzung als auch eine indirekte Polemik“. So decken sich Basarows Ansichten über „den bestimmenden Einfluß des sozialen Milieus und der Erziehung auf die Entwicklung des Menschen“ fast wörtlich mit den von Dobroljubow und Tschernyschewski propagierten Ideen. Letztere standen damals an der Spitze des Kampfes für den Sturz des Zarismus durch eine Bauernrevolution und die entschädigungslose Aufteilung des Gutsbesitzes. In Turgenjews Roman diskutieren die „Alten“ und die „Neuen Menschen“ bereits die Frage, ob die „Gemeindeselbstverwaltung“ erhaltenswert sei. Basarow zeichnet sich durch eine unsentimentale, vulgärmaterialistische Haltung gegenüber dem „Leben“ aus. Seine Bemerkungen über das Sezieren von Fröschen, um mehr über das Innere der Menschen zu erfahren, mußten übrigens die russischen Schüler mindestens bis zum Ende der Sowjetunion noch auswendig lernen – und sogar auch in Kleingruppen experimentell nachvollziehen: „Das war besonders eklig!“, so Wladimir Kaminers Kommentar dazu 2007.
Auch Tschernyschewski bediente sich bereits in seinem Buch laut Torsten Rütting eines „neurologischen Vokabulars“, um einerseits die Sexualität und die Beziehungen zwischen den Geschlechtern neu zu verhandeln und andererseits diese mit den damals aktuellen Debatten um die Neuordnung der Gesellschaft zu verbinden. Dergestalt nimmt er die lamarckistischen Naturwissenschaften in den Dienst der Zukunft des Neuen Menschen, der kontrolliert und rational ein moralisches und sinnvolles Leben führt. „Viele der russischen Intellektuellen verwarfen in Übereinstimmung mit Marx und Engels, aber auch unabhängig von ihnen, die Idee von der Höherentwicklung durch Konkurrenzkampf, die Darwin von dem englischen Nationalökonom Thomas Malthus übernommen hatte“. Malthus glaubte, bewiesen zu haben, dass das rapide Bevölkerungswachstum verbunden mit einem ständig zunehmenden Mangel an Nahrung quasi automatisch eine natürliche Auslese der Besten gewährleiste.
Während jedoch Marx und Engels davon ausgingen, dass Darwin Malthus überwunden habe, indem er dessen Gesetz auch in der Tier- und Pflanzenwelt für gültig erklärte, hielt man in Russland das ganze Prinzip der Konkurrenz eher für ein englisches Insel-Phänomen, dass in den unterbesiedelten russischen Weiten keine Gültigkeit habe. In dieser Einschätzung war sich noch der revolutionäre Narodnik Michailowski mit dem mächtigen ultrakonservativen Oberprokuror Pobjedonoszew einig: Beide taten diesen Aspekt des Darwinismus als eine „händlerische Faustregel“ ab, die „unsere [russische] Seele nicht annehmen“ könne.
Auch der Geograph und Anarchist Pjotr Kropotkin war dieser Meinung und bemühte sich, demgegenüber die „Sittlichung“ der biologischen Gesetze – ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen in Sibirien – heraus zu arbeiten – der konservativen Soziobiologie also eine fortschrittliche (russische) Biosoziologie entgegen zu stellen. Ebenso abgelehnt wurden in Russland dann auch die Experimente von August Weismann zur Widerlegung der Vererbung erworbener Eigenschaften und zur Konstanz des Keimplasmas, die u.a. die Theorie des Neo-Darwinismus begründeten, der in seiner molekularbiologischen Fassung dann von einem – „unbewegten Beweger“ ausging und -geht, wie Max Delbrück das später aristotelisch gestimmt nannte.
Die russische Debatte mußte sich nach der Revolution von 1917 noch zuspitzen, denn nun ging es ja um die planmäßige Gestaltung der gesamten Produktion – und auch die Schaffung des Neuen Menschen konnte jetzt im großen Stil in Angriff genommen werden. Zunächst bekamen dabei anscheinend die Neodarwinisten Oberwasser, indem sie die Eugenik als praktisches Projekt ins Spiel brachten – sie versprachen sozusagen eine flächendeckende Verbesserung des Menschenmaterials. 1920 gründeten sich gleich mehrere „Russische Eugenische Gesellschaften“, und die Akademie der Wissenschaften gab einige Jahre lang eine Zeitschrift mit „Eugenik-Nachrichten“ heraus. Es ging den russischen Eugenikern darum, „das menschliche Wesen zu verbessern“, den „höchsten Typ“ aus der Gattung Mensch herauszumendeln. Weil sie dabei auf das nicht zuletzt finanzielle Wohlwollen der Kommunisten angewiesen waren, sahen sie in ihrer Eugenik auch ein „biosoziales Problem“. So gingen einige z.B. davon aus, dass mit dem Sozialismus die Familie und die Ehe als kleinste Zellen der Gesellschaft absterben werden – und schlugen, um einem daraus ihrer Meinung nach resultierenden Bevölkerungsrückgang zu begegnen – die künstliche Besamung vor, aus Samenbanken mit dem Erbgut der „höchsten Typen“ natürlich.
Noch 1935 legte z.B. der amerikanische Drosophilaforscher und spätere Nobelpreisträger Hermann Joseph Muller Stalin einen großen eugenischen Plan vor, den er „Aus dem Dunkel der Nacht“ betitelte: „Viele zukünftige Mütter, befreit vom religiösen Aberglauben, werden stolz sein, ihr Keimplasma mit dem eines Lenin oder Darwin zu mischen, um der Gesellschaft mit einem Kind von ihren biologischen Eigenschaften zu diesen…Echte Eugenik kann nur ein Produkt des Sozialismus sein“. Gegen diese makropolitischen Pläne protestierten nicht nur die Frauenverbände, auch in den Zeitungen wurde gegen solche oder ähnliche Mixturen aus Soziologie und Biologie zur Massenproduktion des Neuen Menschen polemisiert, zumal nachdem ab 1933 das faschistische Deutschland die Rassenverbesserung qua Biopolitik auf seine Fahnen geschrieben hatte und die Eugenik damit für die sozialistische Sowjetunion quasi „verbrannt“ war, wobei das Ziel jedoch nicht in Frage gestellt wurde, das man aber eher durch Pädagogik, Kollektivierung, Arbeit auf den Großbaustellen des Sozialismus, mit Taylorismus, Arbeitswissenschaft und – bis zum Sturz Trotzkis – mit Psychoanalyse erreichen wollte. Immer wieder kam es dabei zu neuen Kampagnen und Komsomolprojekten. Nicht die unwichtigsten waren sicher die Selbstversuche, bei denen Einzelne analog zu den einst „berühmten Männern und Frauen der Sechzigerjahre“ sich selbst zu neuen Menschen erzogen – und gleichzeitig in einem Tagebuch darüber Rechenschaft ablegten. Unmerklich weitete sich dieser eher mikropolitisch zu nennende Ansatz – von oben kontrolliert und gefiltert, indem nun auch eine „Neue Natur“ in den Blick geriet: Alles war machbar und ließ sich bewegen. Auch die Pflanzen und Tiere waren lernfähig, man konnte sie erziehen – verbessern. Ein neues Vokabular entstand (dafür) – schließlich eine ganze „proletarische Biologie“….
Zurück zum Mutterland der Genossenschaften:
Bis zur Revolution gab es 200.000 Artel in Rußland. Die dortigen Revolutionäre gründeten sogar im Knast und in der Kartoga stets Zellen-Genossenschaften, d.h. das Geld und alle Einkünfte wurden in eine Kasse getan, aus der die Bedürfnisse der Beteiligten gerecht befriedigt wurden. Jetzt hatten die Genossenschaften – bei der Umwandlung der Kolchosen – wieder Konjunktur, in der Nach-DDR paßten sich einige hundert Landwirtschaftliche Produktions-Genossenschaften ans westliche Genossenschaftsrecht an. Gleichzeitig wurde das kurz zuvor entfernte Denkmal für den Begründer der Genossenschaftsbewegung Hermann Schulze-Delitzsch in Berlin-Mitte wieder aufgestellt.
Daß Betriebsräte ihre Abfindungen zusammenlegten und gemeinsam eine Firma gründeten, geschah jedoch selten, häufig war dagegen der typisch proletarische Aufstiegsweg: eine Band gründen oder sonstwie sich kollektiv im kulturellen Bereich behaupten. Jüngst ließ z.B. die junge Punkgruppe „Böse Mädchen“ aus dem Wedding ihre CD von der dortigen Randgruppenpädagogik-Stiftung „Werkschule“ finanzieren, diese war einmal selbst ein selbstverwaltetes linkes Projekt – das derartig sorgfältig wirtschaftete, bei Minimalstgehältern, das am Ende ein paar Millionen übrig blieben – fürs Stiftungsvermögen. Obwohl heute auch schon der Staat solche „Betriebe ohne Chef“ finanziell fördert, kommt die Kritik immer noch gerne mit dem jugoslawischen Beispiel der Arbeiterselbstverwaltung an, das angeblich und nicht zuletzt am Konflikt ‚Lohn oder Investition‘ scheiterte. Dagegen stehen die positiven Erfahrungen der israelischen Kibbuzim, von denen u.a. noch die Landkommune Longo Mai in Mecklenburg zehrt.
Daß sich Leute zusammentun, um gemeinsam einen Betrieb zu gründen oder einen pleite gegangenen in „Belegschaftshand“ zu überführen, ist in Asien nichts Besonderes, gerade wurden in Bombay mehrere zuvor liquidierte Textilfabriken von den Arbeitern übernommen. Fast die gesamte florierende italienische Textilindustrie, aber auch Teile der dortigen Stahlindustrie, verdankt sich dem Umstand, daß die Unternehmer einst ihre Arbeiter entließen – und ihnen die Maschinen nachschmissen, womit diese dann semikollektive Familienbetriebe gründeten. Ein ähnliches – jedoch eher feministisches – Modell gibt es in der Textilindustrie Bangkoks. In Istanbul fallen den kommunistischen Kollektiven meist Kneipengründungen auf Aktienbasis ein und in Neuseeland Landgasthäuser. Im Prenzlauer Berg wiederbelebte der alte Kollektivist Holtfreter das stillgelegte Oderberger-Bad als genossenschaftliches Kunstbad. Berlin ist im übrigen die Hauptstadt der selbstverwalteten Bordelle, es gibt rund 300 davon, das hat etwas mit der Abwesenheit von Zuhältern und Sperrbezirken zu tun, aber auch mit dem Feminismus, der wiederum seit seinen Anfängen die Prostitution thematisierte.
Hier wurde – aus Fördergeldergründen – auch der größte deutsche „Alternativbetrieb“, die taz, angesiedelt. Der Alternativgedanke geht auf einen SDS-Beschluß 1967 zurück, der die – bescheidenen – Verdienstspannen für Raubdrucker festlegte, aus diesen wurden dann Verlage, linke Buchladenkollektive, K-Parteien, Bio-Läden, FahrradWerkstätten usw. Theoretisch könnte man die Alternativen als liberale Sozialisten bezeichnen, die dem Kapital, aber nicht dem Markt böse sind – d.h. die anders (alternativ) produzieren wollen, aber nicht den Warencharakter antasten.
Es gibt jedoch auch Betriebe in Belegschaftshand, die geldlose Geschäfte anstreben – bis hin zu „Tauschbörsen“ bzw. eigenen Verrechnungseinheiten. Neben diesen Experimenten mit Distribution und Leistungsvergütung gibt es auch solche, die sich mit dem Warencharakter beschäftigen, indem sie das Verhältnis von Gebrauchs- und Tauschwert an konkreten Objekten – etwa bei der Umwandlung von kaputten Kühlschränken in Heizungen – problematisieren. Generell gilt: Je engagierter sich eine Gruppe auf spezielle „Problemlösungen“ konzentriert, desto selbstverständlicher ist das Kollektive, wohingegen die von Arbeitsämtern und Jobvermittlern ständig geforderte „Teamfähigkeit“ nichts anderes will als die alte Sklavenmentalität. Aber auch dort rühren sich natürlich spartakistische Tendenzen, d.h. bei einem Access-Coup kommt es zu kollektiven Verselbständigungen. Auf der anderen Seite haben aber vielleicht auch die Alternativbetriebe eine Halbwertzeit.
Noch mal zurück zum russischen Hang, sich zu Genossenschaft zusammen zu schließen:
1923 erschien Lenins Schrift „Über das Genossenschaftswesen“:
Dem Genossenschaftswesen wird bei uns, wie mir scheint, nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Wohl kaum alle begreifen, daß das Genossenschaftswesen jetzt, seit der Oktoberrevolution und unabhängig von der NÖP (1) (umgekehrt, in dieser Beziehung muß man sagen: gerade dank der NÖP), bei uns eine ganz außerordentliche Bedeutung gewinnt. In den Träumereien der alten Genossenschaftler ist vieles phantastisch. Sie wirken wegen ihrer Phantasterei oft lächerlich. Aber worin besteht ihre Phantasterei? Darin, daß diese Leute die wesentliche, grundlegende Bedeutung des politischen Kampfes der Arbeiterklasse zum Sturz der Ausbeuterherrschaft nicht verstehen. Dieser Sturz ist jetzt bei uns Tatsache geworden, und nun wird vieles von dem, was an den Träumereien der alten Genossenschaftler phantastisch, sogar romantisch, ja abgeschmackt war, zur ungeschminkten Wirklichkeit.
Bei uns ist wirklich, da die Staatsmacht in den Händen der Arbeiterklasse liegt, da alle Produktionsmittel dieser Staatsmacht gehören – bei uns ist wirklich nur die Aufgabe übriggeblieben, die Bevölkerung genossenschaftlich zusammenzuschließen. Unter der Voraussetzung des maximalen genossenschaftlichen Zusammenschlusses der Bevölkerung erreicht jener Sozialismus, der früher berechtigten Spott, mitleidiges Lächeln, geringschätziges Verhalten seitens derjenigen hervorrief, die mit Recht von der Notwendigkeit des Klassenkampfes, des Kampfes um die politische Macht usw. überzeugt waren, von selbst das Ziel. Nun geben sich aber nicht alle Genossen Rechenschaft darüber, welche gigantische, unermeßliche Bedeutung der genossenschaftliche Zusammenschluß Rußlands jetzt für uns gewinnt. Mit der NÖP haben wir dem Bauern als Händler, dem Prinzip des privaten Handels ein Zugeständnis gemacht; gerade daraus folgt (entgegen der landläufigen Meinung) die gigantische Bedeutung des Genossenschaftswesens. Unter der Herrschaft der NÖP ist ein genügend breiter und tiefer genossenschaftlicher Zusammenschluß der russischen Bevölkerung im Grunde genommen alles, was wir brauchen, weil wir jetzt jenen Grad der Vereinigung der Privatinteressen, der privaten Handelsinteressen, ihrer Überwachung und Kontrolle durch den Staat, den Grad ihrer Unterordnung unter die allgemeinen Interessen gefunden haben, der früher für viele, viele Sozialisten den Stein des Anstoßes bildete. In der Tat, die Verfügungsgewalt des Staates über alle großen Produktionsmittel, die Staatsmacht in den Händen des Proletariats, das Bündnis dieses Proletariats mit den vielen Millionen Klein- und Zwergbauern, die Sicherung der Führerstellung dieses Proletariats gegenüber der Bauernschaft usw. – ist das nicht alles, was notwendig ist, um aus den Genossenschaften, allein aus den Genossenschaften, die wir früher geringschätzig als krämerhaft behandelt haben und die wir in gewisser Hinsicht jetzt, unter der NÖP, ebenso zu behandeln berechtigt sind, ist das nicht alles, was notwendig ist, um die vollendete sozialistische Gesellschaft zu errichten? Das ist noch nicht die Errichtung der sozialistischen Gesellschaft, aber es ist alles, was zu dieser Errichtung notwendig und hinreichend ist.
Eben dieser Umstand wird von vielen unserer Praktiker unterschätzt. Man blickt bei uns auf die Genossenschaften von oben herab und begreift nicht, welche außerordentliche Bedeutung diese Genossenschaften haben, erstens von der prinzipiellen Seite her gesehen (das Eigentum an den Produktionsmitteln in den Händen des Staates), zweitens unter dem Gesichtspunkt des Übergangs zu neuen Zuständen auf einem Wege, der möglichst EINFACH, LEICHT UND ZUGÄNGLICH FÜR DEN BAUERN ist.
Und das ist ja doch wiederum die Hauptsache. Es ist eine Sache, über alle möglichen Arbeitervereinigungen zum Aufbau des Sozialismus zu phantasieren, und eine andere Sache, diesen Sozialismus praktisch so aufbauen zu lernen, daß JEDER Kleinbauer an diesem Aufbau teilnehmen kann. Gerade diese Stufe haben wir jetzt erreicht. Und es steht außer Zweifel, daß wir, nachdem wir diese Stufe erreicht haben, sie uns zuwenig zunutze machen.
Wir haben beim Übergang zur NÖP den Bogen überspannt, nicht in der Beziehung, daß wir dem Prinzip der Gewerbe- und Handelsfreiheit zuviel Platz eingeräumt hätten, sondern wir haben beim Übergang zur NÖP den Bogen in der Beziehung überspannt, daß wir vergessen haben, an die Genossenschaften zu denken, daß wir jetzt die Genossenschaften unterschätzen, daß wir schon begonnen haben, die riesige Bedeutung der Genossenschaften in dem oben angedeuteten zweifachen Sinn dieser Bedeutung zu vergessen.
Ich habe die Absicht, mich nun mit dem Leser darüber zu unterhalten, was man, von diesem „Genossenschafts“prinzip ausgehend, praktisch sofort tun kann und muß. Mit welchen Mitteln kann und muß man sofort beginnen, dieses „Genossenschafts“prinzip so zu entwickeln, daß seine sozialistische Bedeutung allen und jedem einleuchtet?
Man muß für die Genossenschaften eine solche politische Lage schaffen, daß nicht nur die Genossenschaften überhaupt und immer eine gewisse Vergünstigung genießen, sondern daß diese Vergünstigung rein materieller Natur ist (Höhe der Bankzinsen usw.). Man muß den Genossenschaften aus staatlichen Mitteln Darlehn geben, die, wenn auch nur um ein geringes, die Mittel übersteigen, die wir den Privatbetrieben, selbst den Betrieben der Schwerindustrie usw., als Darlehn gewähren.
Jede Gesellschaftsordnung entsteht nur, wenn sie durch eine bestimmte Klasse finanziell unterstützt wird. Man braucht nicht an jene Hunderte und aber Hunderte Millionen Rubel zu erinnern, die die Geburt des „freien“ Kapitalismus kostete. Jetzt müssen wir erkennen, daß gegenwärtig diejenige Gesellschaftsordnung, die wir über das gewöhnliche Maß hinaus unterstützen müssen, die genossenschaftliche Ordnung ist, und diese Erkenntnis in die Tat umsetzen. Aber unterstützen müssen wir sie im wahren Sinne dieses Wortes, d.h., es genügt nicht, unter dieser Unterstützung die Förderung eines beliebigen genossenschaftlichen Umsatzes zu verstehen, unter dieser Unterstützung muß man die Unterstützung eines solchen genossenschaftlichen Umsatzes verstehen, an dem WIRKLICHE MASSEN DER BEVÖLKERUNG WIRKLICH TEILNEHMEN. Dem Bauern, der sich am Genossenschaftsumsatz beteiligt, eine Prämie zu gewähren, das ist unbedingt eine richtige Form, doch es gilt hierbei, diese Beteiligung zu kontrollieren und zu prüfen, ob es eine bewußte und qualitativ einwandfreie Beteiligung ist – das ist der Kernpunkt der Frage. Wenn der Genossenschaftler in ein Dorf kommt und dort einen Genossenschaftsladen einrichtet, so ist die Bevölkerung, strenggenommen, daran nicht beteiligt, gleichzeitig aber wird sie, vom eigenen Vorteil geleitet, schleunigst versuchen, sich daran zu beteiligen.
Diese Sache hat auch noch eine andere Seite. Vom Standpunkt des „zivilisierten“ (vor allem des lese- und schreibkundigen) Europäers müssen wir nur noch sehr wenig tun, um ausnahmslos alle zu veranlassen, sich an den Transaktionen der Genossenschaften zu beteiligen, und zwar nicht passiv, sondern aktiv. Eigentlich bleibt uns „nur“ eines zu tun: unsere Bevölkerung so „zivilisiert“ zu machen, daß sie alle aus der allgemeinen Beteiligung an den Genossenschaften entspringenden Vorteile einsieht und diese Beteiligung organisiert. „Nur“ das. Wir brauchen jetzt keine anderen Weisheiten, um zum Sozialismus überzugehen. Um aber dieses „Nur“ zu vollbringen, bedarf es einer ganzen Umwälzung, einer ganzen Periode kultureller Entwicklung der gesamten Volksmasse. Deshalb müssen wir uns zur Regel machen: möglichst wenig Klügeleien und möglichst wenig Floskeln. Die NÖP bedeutet in dieser Hinsicht insofern einen Fortschritt, als sie sich dem Niveau des allergewöhnlichsten Bauern anpaßt, als sie von ihm nichts Höheres verlangt. Um aber durch die NÖP die Beteiligung ausnahmslos der gesamten Bevölkerung an den Genossenschaften herbeizuführen, dazu bedarf es einer ganzen geschichtlichen Epoche. Wir können im günstigsten Fall diese Epoche in ein, zwei Jahrzehnten durchschreiten. Aber dennoch wird das eine besondere geschichtliche Epoche sein, und ohne diese geschichtliche Epoche, ohne allgemeine Elementarbildung der gesamten Bevölkerung, ohne einen genügend hohen Grad von Aufgewecktheit, ohne die Bevölkerung in ausreichendem Grade daran gewöhnt zu haben, Bücher zu gebrauchen, und ohne die materielle Grundlage dafür, ohne eine gewisse Sicherung, sagen wir, gegen Mißernte, gegen Hungersnot usw. – ohne das können wir unser Ziel nicht erreichen. Alles kommt jetzt darauf an, daß wir es verstehen, den revolutionären Schwung, den revolutionären Enthusiasmus, den wir schon gezeigt, und zwar hinreichend gezeigt und mit vollem Erfolg gekrönt haben, mit der (hier möchte ich fast sagen) Fähigkeit zu vereinigen, ein aufgeweckter und des Schreibens und Rechnens kundiger Händler zu sein, was für einen guten Genossenschaftler durchaus genügt. Unter der Fähigkeit, ein Händler zu sein, verstehe ich die Fähigkeit, ein Händler zu sein, der Kulturansprüchen genügt. Das mögen sich die russischen Menschen oder einfach die Bauern hinter die Ohren schreiben, die meinen: Wenn einer Handel treibt, dann versteht er auch Händler zu sein. Das ist ganz falsch. Wohl treibt er Handel, aber von da bis zu der Fähigkeit, ein Händler zu sein, der Kulturansprüchen genügt, ist es noch sehr weit. Er treibt heute Handel auf asiatische Manier; um aber zu verstehen, ein Händler zu sein, muß man auf europäische Manier Handel treiben. Davon trennt ihn eine ganze Epoche.
Ich komme zum Schluß. Eine Reihe von ökonomischen, finanziellen und Bankprivilegien für die Genossenschaften – darin muß die Unterstützung bestehen, die unser sozialistischer Staat dem neuen Prinzip der Organisierung der Bevölkerung erweist. Damit ist jedoch die Aufgabe erst in allgemeinen Zügen umrissen, weil der ganze Inhalt der Aufgabe praktisch noch unbestimmt bleibt, noch nicht im Detail geschildert ist, d.h., man muß verstehen, jene Form der „Prämien“ (und jene Bedingungen für ihre Gewährung) ausfindig zu machen, die wir für den genossenschaftlichen Zusammenschluß geben, jene Form der Prämien, durch die wir die Genossenschaften genügend fördern, jene Form der Prämien, durch die wir zu einem zivilisierten Genossenschaftler gelangen. Aber ein System zivilisierter Genossenschaftler bei gesellschaftlichem Eigentum an den Produktionsmitteln, beim Klassensieg des Proletariats über die Bourgeoisie – das ist das System des Sozialismus.
4. Januar 1923
II
Immer, wenn ich über die Neue Ökonomische Politik schrieb, zitierte ich meinen Artikel über den Staatskapitalismus aus dem Jahre 1918 (2). Das erregte des öfteren Zweifel bei manchen jungen Genossen. Aber ihre Zweifel betrafen vorwiegend die abstrakt politische Seite.
Es schien ihnen, daß eine Gesellschaftsordnung, unter der die Produktionsmittel der Arbeiterklasse gehören und dieser Arbeiterklasse die Staatsmacht gehört, nicht als Staatskapitalismus bezeichnet werden dürfe. Sie merkten jedoch nicht, daß die Bezeichnung „Staatskapitalismus“ bei mir gebraucht wurde: ERSTENS, um den historischen Zusammenhang unserer gegenwärtigen Position mit der Position in meiner Polemik gegen die sogenannten linken Kommunisten herzustellen, und auch damals schon suchte ich zu beweisen, daß der Staatskapitalismus höher stehen würde als unsere heutige Wirtschaftsweise; mir lag daran, den kontinuierlichen Zusammenhang des gewöhnlichen Staatskapitalismus mit jenem ungewöhnlichen, sogar ganz und gar ungewöhnlichen Staatskapitalismus festzustellen, von dem ich sprach, als ich den Leser in die Neue Ökonomische Politik einführte. ZWEITENS war für mich stets der praktische Zweck wichtig. Und der praktische Zweck unserer Neuen Ökonomischen Politik bestand darin, zu Konzessionen zu gelangen; Konzessionen aber wären unter unseren Verhältnissen zweifellos schon ein Staatskapitalismus von reinem Typus gewesen. Aus dieser Sicht stelle ich meine Erwägungen über den Staatskapitalismus an.
Die Sache hat jedoch noch eine andere Seite, bei der uns der Staatskapitalismus oder wenigstens ein Vergleich damit nötig sein kann. Das ist die Frage der Genossenschaften. Es ist unzweifelhaft, daß die Genossenschaften in einem kapitalistischen Staat eine kapitalistische Kollektiveinrichtung sind. Unzweifelhaft ist auch, daß in unserer jetzigen ökonomischen Wirklichkeit, wo wir privatkapitalistische Betriebe – jedoch nur auf gesellschaftlichem Grund und Boden und nur unter der Kontrolle der Staatsmacht, die in den Händen der Arbeiterklasse liegt – mit Betrieben von konsequent sozialistischem Typus (sowohl die Produktionsmittel als auch der Grund und Boden, auf dem der Betrieb steht, wie der Betrieb als Ganzes gehören dem Staat) vereinigen, noch die Frage nach einer dritten Art von Betrieben auftaucht, denen früher vom Standpunkt der prinzipiellen Bedeutung aus keine Selbständigkeit zukam, nämlich den genossenschaftlichen Betrieben. Unter dem Privatkapitalismus unterscheiden sich genossenschaftliche Betriebe von kapitalistischen als kollektive Betriebe von privaten. Unter dem Staatskapitalismus unterscheiden sich genossenschaftliche Betriebe von staatskapitalistischen dadurch, daß sie erstens private, zweitens kollektive Betriebe sind. In der bei uns bestehenden Gesellschaftsordnung unterscheiden sich genossenschaftliche Betriebe von privatkapitalistischen als kollektive Betriebe, aber sie unterscheiden sich nicht von sozialistischen Betrieben, wenn sie auf dem Grund und Boden errichtet und mit Produktionsmitteln ausgerüstet sind, die dem Staat, d.h. der Arbeiterklasse gehören.
Eben dieser Umstand wird bei uns nicht genügend berücksichtigt, wenn man von den Genossenschaften spricht. Man vergißt, daß die Genossenschaften bei uns dank der Besonderheit unserer Staatsordnung eine ganz außerordentliche Bedeutung gewinnen. Sondert man die Konzessionen aus, die bei uns, nebenbei bemerkt, keine irgendwie beträchtliche Entwicklung erfahren haben, so decken sich die Genossenschaften unter unseren Verhältnissen in der Regel völlig mit dem Sozialismus.
Ich will meinen Gedanken näher ausführen. Worin bestand das Phantastische an den Plänen der alten Genossenschaftler, angefangen mit Robert Owen? Darin,daß sie von einer friedlichen Umgestaltung der modernen Gesellschaft durch den Sozialismus träumten, ohne eine so grundlegende Frage wie die des Klassenkampfes, der Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse, des Sturzes der Herrschaft der Ausbeuterklasse zu beachten. Und deshalb sind wir im Recht, wenn wir in diesem „Genossenschafts“sozialismus pure Phantasterei sehen, wenn wir etwas Romantisches, ja sogar Abgeschmacktes in den Träumereien erblicken, daß man durch den bloßen genossenschaftlichen Zusammenschluß der Bevölkerung die Klassenfeinde in Klassenfreunde und den Klassenkrieg in den Klassenfrieden (den sogenannten Burgfrieden) verwandeln könne.
Es besteht kein Zweifel, daß wir vom Standpunkt der Grundaufgabe der Gegenwart aus gesehen recht hatten, denn ohne den Klassenkampf um die politische Macht im Staat kann der Sozialismus nicht verwirklicht werden.
Man betrachte aber, wie sich die Sache jetzt geändert hat, da ja die Staatsmacht bereits in den Händen der Arbeiterklasse liegt, da die politische Macht der Ausbeuter gestürzt ist und alle Produktionsmittel (mit Ausnahme derer, die der Arbeiterstaat freiwillig, zeitweilig und bedingt den Ausbeutern als Konzession überläßt) sich in den Händen der Arbeiterklasse befinden.
Jetzt haben wir das Recht zu sagen, daß das einfache Wachstum der Genossenschaften für uns (mit der oben erwähnten `kleinen‘ Ausnahme) mit dem Wachstum des Sozialismus identisch ist, und zugleich müssen wir zugeben, daß sich unsere ganze Auffassung vom Sozialismus grundlegend geändert hat. Diese grundlegende Änderung besteht darin, daß wir früher das Schwergewicht auf den politischen Kampf, die Revolution, der Eroberung der Macht usw. legten und auch legen mußten. Heute dagegen ändert sich das Schwergewicht so weit, daß es auf die friedliche organisatorische „Kultur“arbeit verlegt wird. Ich würde sagen, daß sich das Schwergewicht für uns auf bloße Kulturarbeit verschiebt, gäbe es nicht die internationalen Beziehungen, hätten wir nicht die Pflicht, für unsere Position in internationalem Maßstab zu kämpfen. Wenn man aber davon absieht und sich auf die inneren ökonomischen Verhältnisse beschränkt, so reduziert sich bei uns jetzt das Schwergewicht der Arbeit tatsächlich auf bloße Kulturarbeit.
Vor uns stehen zwei Hauptaufgaben, die eine Epoche ausmachen. Das ist einmal die Aufgabe, unseren Apparat umzugestalten, der absolut nichts taugt und den wir gänzlich von der früheren Epoche übernommen haben. Hier ist ernstlich etwas umzugestalten, das haben wir in fünf Jahren Kampf nicht fertiggebracht und konnten es auch nicht fertigbringen. Unsere zweite Aufgabe besteht in der kulturellen Arbeit für die Bauernschaft. Und diese kulturelle Arbeit unter der Bauernschaft verfolgt als ökonomisches Ziel eben den genossenschaftlichen Zusammenschluß. Bei einem vollständigen genossenschaftlichen Zusammenschluß stünden wir bereits mit beiden Füßen auf sozialistischem Boden. Aber diese Voraussetzung, der vollständige genossenschaftliche Zusammenschluß, schließt ein derartiges Kulturniveau der Bauernschaft (eben der Bauernschaft als der übergroßen Masse) in sich ein, daß dieser vollständige genossenschaftliche Zusammenschluß ohne eine ganze Kulturrevolution unmöglich ist.
Unsere Gegner hielten uns oft entgegen, es sei ein sinnloses Beginnen von uns, in einem Lande mit ungenügender Kultur den Sozialismus einführen zu wollen. Aber sie irrten sich, und zwar deshalb, weil wir nicht an dem Ende anfingen, an dem es nach der Theorie (von allerlei Pedanten) hätte geschehen sollen, und weil bei uns die politische und soziale Umwälzung jener kulturellen Umwälzung, jener Kulturrevolution vorausging, der wir jetzt dennoch gegenüberstehen.
Uns genügt nun diese Kulturrevolution, um ein vollständig sozialistisches Land zu werden, aber für uns bietet diese Kulturrevolution ungeheure Schwierigkeiten sowohl rein kultureller (denn wir sind Analphabeten) als auch materieller Natur (denn um Kultur zu haben, braucht man eine bestimmte Entwicklung der materiellen Produktionsmittel, braucht man eine bestimmte materielle Basis).
6. Januar 1923. Zuerst veröffentlicht am 26. und 27. Mai 1923 in der „Prawda“ Nr. 115 und 116.
Darauf spielt Andrej Platonows Roman „Tschewengur“ aus dem Jahr 1929 an, in dem die Geschichte eines Dorfes in den Zwanzigerjahren erzählt wird, also bis zur Zwangskollektivierung.
„Er kannte sich in der Wissenschaft des sowjetischen Lebens nicht aus, ihn lockte nur ein Zweig – das Genossenschaftswesen. über das er in der Zeitung ‚Armut‘ gelesen hatte.
Als er über das Genossenschaftswesen gelesen hatte, trat er zur Ikone des Nikolaus von Myra und zündete das Öllämpchen mit seinen zärtlichen Weizenhänden an.
Bislang hatte er den Sozialismus nur gefürchtet, aber jetzt, da der Sozialismus Genossenschaft hieß, gewann er ihn herzlich lieb.
Zuerst wollte er sich ein Statut der Genossenschaft beschaffen, dann ins Kreisexkom gehen und sich brüderlich mit dem Vorsitzenden, dem Genossen Tschepurny, über den Aufbau eines Genossenschaftsnetzes unterhalten.“
Die Kollektivierung der Landwirtschaft ab 1929:
„Wir sind übergegangen von einer Politik, die Ausbeutertendenzen des Kulaken zu beschränken, zu einer Politik, den Kulaken als Klasse zu liquidieren“, verkündete Stalin. Gegenüber Churchill erwähnte er später die Zahl „10 Millionen“, die davon betroffen gewesen seien – also enteignet, erschossen oder verbannt wurden. „Es war [damals] leicht, einen Menschen ins Gefängnis zu bringen,“ schreibt Wassili Grossmann 1955 in seiner Erzählung „Alles fließt“, die erst 1989 veröffentlicht werden durfte, aber dann sofort vergriffen war, auch in der DDR im Jahr darauf. „Du schreibst eine Denunziation; du brauchtest sie nicht einmal zu unterschreiben. Alles, was du sagen mußtest, war, daß er Leute bezahlt hatte, um für ihn als Tagelöhner zu arbeiten, oder daß er drei Kühe besessen hatte.“ Die Leute betrachteten die so genannten Kulaken „als Vieh…; sie hätten keine Seelen, sie würden stinken…; sie seien Volksfeinde und beuteten die Arbeit anderer aus…Und es gab für sie keine Gnade“, selbst die Kulaken-Kinder waren geringer als eine Laus, schreibt Grossmann.
Der Stalin-Preisträger Michail Scholochow verfaßte bereits 1932 einen Roman über diese heroische Zeit der Kollektivierung: „Neuland unterm Pflug“, dessen erster Teil 1955 veröffentlicht wurde. Er spielt wie auch schon sein Kosaken-Epos „Der Stille Don“ in der Steppe am Don – in einem Bezirk, wo die Kollektivierung erst 14,8 Prozent der kosakischen Bauern erfaßt hat und deswegen die Entkulakisierung forciert werden muß. Der Dorfaktivist Andrej Rasmjotnow bekommt dabei irgendwann Skrupel – er sagt: „Ich halte nichts mehr von diesem Kulaken-Brechen.“ Der zum Parteiaufgebot der 25.000 gehörende Proletarier Dawydow, fragt ihn, was er damit meine. „Ich wurde nicht dafür ausgebildet, gegen Kinder zu kämpfen…Was bin ich, ein Henker? Oder ist mein Herz aus Stein?“ Dawydow kann ihn nur mit Mühe wieder auf Parteilinie bringen: „Gewiß, wir jagen die Kulaken fort, schicken sie nach Solowki. Krepieren werden sie aber ganz gewiß nicht…Und haben wir erst einmal unseren Aufbau vollendet, dann werden diese Kinder keine Kulakenkinder mehr sein. Die Arbeiterklasse wird sie inzwischen umerzogen haben.“ In dem Roman verschwören sich die Kulaken, aber auch der eine oder andere Kolchosmitarbeiter, mit den letzten Resten der untergetauchten weißen Offiziere – und scheuen selbst vor Morden nicht zurück. Dawydow versucht derweil die Masse der Dörfler mitsamt ihrem Eigentum in einer Kollektivwirtschaft zusammen zu fassen. Aber ihr Engagement und ihre Arbeitskraft sind sehr unterschiedlich und einigen bricht es schier das Herz, ihr Pferd oder ihre Kuh zu vergesellschaften, d.h. sie in einen Stall der Kolchose zu bringen, wo sie u.U. nicht so gut behandelt und gefüttert werden.
Sergej Tretjakow erwähnt in seinem 1968 veröffentlichten Roman „Das Ableben“, der die Geschichte des Kirchdorfes Poshary von 1917 bis in die Chruschtschow-Zeit erzählt, ein Erlebnis des „gescheiterten Bauernführers“ Iwan. [3] Er will einem Kutscherjungen, der gerade mit Pferd und Wagen von der Molkerei gekommen ist, beim Abladen helfen. „Das Pferd war groß, schmutzig, unter dem enthaarten Fell stachen die Rippen hervor, traurig ließ es den Kopf hängen. Als Iwan hinzutrat hob es plötzlich den Kopf, sah ihn mit feuchtem Blick an und begann leise und wehmütig zu wiehern. Er hatte es nicht erkannt, aber das Pferd hatte ihn erkannt…Einer seiner beiden ‚grauen Schwäne‘ [wie er sie früher immer genannt hat] – die Hufe beschädigt, die Fesseln geschwollen, der Bauch schmutzverkrustet, und der feuchte Blick, voller Wehmut und Trauer um das frühere Leben, um die warme Box und die liebevolle Hand des Herrn, die ihm Zuckerstückchen zwischen die samtigen Lippen gesteckt hatte. Er hatte seine Pferde geliebt, war stolz auf sie gewesen…Nie warf er einen Blick in den Pferdestall der Kolchose; wenn er seine Grauen irgendwo unterwegs sah, wandte er sich ab, zu schmerzlich war ihm der Anblick. Und nun stand er einem seiner Pferde Auge in Auge gegenüber, und das Tier hatte ihn zuerst erkannt.“
Anders sieht es in den Kollektivlandwirtschaften aus, die aus Nichtbauern bestehen, z.B. in der Gorki-Kolonie für kriminell gewordene Jugendliche von A.S. Makarenko, wo jedes neu angeschaffte Nutztier eine große Errungenschaft ist und dementsprechend von allen liebevoll behandelt wird. Allerdings bildet hier die Landwirtschaft nur die ökonomische Basis für die Kolonie, sie ist nicht deren Zweck, der darin besteht, die Kinder zu Neuen Menschen zu erziehen. Aber auch dabei werden „die Kulaken von Tag zu Tag zahlreicher,“ sorgt sich einer der Jugendlichen. Und Makarenko schreibt: „Anfangs [ab 1920] waren wir geneigt, nur die Landwirtschaft als wirtschaftliche Betätigung zu betrachten, und unterwarfen uns blind der alten These, die da behauptet, daß die Natur veredle. Diese These war in den Adelsnestern entwickelt worden, in denen die Natur in erster Linie als ein sehr schöner und gepflegter Ort für Spaziergänge und Turgenjewsche Erlebnisse aufgefaßt wurde…Die Natur aber, die den Gorki-Kolonisten veredeln sollte, schaute ihn mit den Augen der ungepflügten Erde an, des Unkrauts, das ausgerodet werden mußte, des Mistes, der gesammelt, aufs Feld gefahren und dann ausgestreut werden mußte, eines zerbrochenen Fuhrwerks, eines Pferdefußes, der geheilt werden mußte. Was konnte es da schon für eine Veredelung geben!“ Ähnlich ist es dann mit den Gewerken, d.h. mit den Kinderkolonien, „die ihre Motivationsbilanz auf das Handwerk aufbauten“. Makarenko beobachtete dabei stets ein und das selbe Ergebnis: dass die Jugendlichen als angehende Schuster, Tischler, Maurer etc. immer mehr „Elemente des Kleinbürgerlichen“ annahmen. Und diese stehen der Entwicklung eines revolutionären Kollektivs entgegen, wie er es anläßlich des Umzugs der Gorki-Kolonie in eine größere in der Nähe von Charkow sogar an sich selbst bemerkte – nachdem sie ihr knappes Hab und Gut zusammengepackt hatten und dabei eine Menge sauer erworbenes bzw. organisiertes „Eigentum“ zurück ließen: „All diese ungestrichenen Tische und Bänke allerkleinbürgerlichster Art, diese unzähligen Hocker, alten Räder, zerlesenen Bücher, dieser ganze Bodensatz knausriger Seßhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit war eine Beleidigung für unseren heldenhaften Zug…und doch tat es einem leid, diese Dinge fortzuwerfen.“
Oft genug wurde auch bei anderen Kolchosen der widerstreitende Individualegoismus der Bauern bloß durch einen vereinigten neuen Kollektivegoismus ersetzt: Was scheren uns die Nachbar-Kolchosen und -Dörfer, ob sie dort falsch wirtschaften und hungern, Hauptsache unser eigener Betrieb blüht, wächst und gedeiht. Um diese Denkweise auszurotten wurden die Kolchosen zu immer größeren Einheiten zusammengefaßt, bis aus ihnen riesige Agrarkombinate wurden. In der hitzigen Anfangszeit kollektivierte man hier und da sogar das Geflügel. Scholochow schildert einen erfolgreichen Aufstand der Bäuerinnen gegen diesen revolutionären Rigorismus, den Stalin selbst – Anfang 1930 – in seinem berühmten Artikel „Vor Erfolgen von Schwindel befallen“ kritisierte.
Der heute als der sowjetischste Schriftsteller von allen geltende Andrej Platonow (1899 bis 1951), begab sich nach Erscheinen dieses Artikels – im Auftrag der Zeitschrift „Krasnaja now“ (Rote Neuigkeit) – sofort in sein Heimatgebiet Woronesh, wo er sich zuvor als Ingenieur an der Melioration und Elektrifizierung der Dörfer beteiligt hatte, um diese von Stalin proklamierte Wende in der Kollektivierungspolitik von unten mit zu bekommen. Seine währenddessen entstandene „Armeleutechronik ‚Zu Nutz und Frommen'“ wurde zwar 1931 gedruckt, aber nachdem Stalin eigenhändig „Ubljudok“ (Schweinehund) auf die Ausgabe geschrieben hatte, mußte der Chefredakteur Alexander Fadejew sich von ihr distanzieren. Er bezeichnete sie als „Kulakenchronik“ und den Autor als „Kulakenagent“, der „das wirkliche Bild des Kolchosaufbaus und -kampfes verfälscht“ und „die kommunistischen Leiter und Kader der Kolchosbewegung verleumdet“ habe.
Der Erzähler in Platonows „Chronik“ ist eine „dämmernde Seele“, „zerquält von der Sorge um das Gemeinwohl“, der unruhig von einem Kollektiv zum anderen über Land wandert. In all seinen Büchern sind die Leute unterwegs, in der „Chronik“ ist es Platonow selbst, ein „Pilger durchs Kolchosland“ – der das Dorf verstand, wie Viktor Schklowski bereits 1926 feststellte, indem er aktiv an seiner Entwicklung teilnahm, denn „wertvolle Beobachtungen entspringen nur dem Gefühl emsiger Mitarbeit“. Diese Überzeugung teilte Platonow mit Sergej Tretjakow, der sich ebenfalls auf Viktor Schklowski berief, als er meinte, „der Schriftsteller muß in Arbeitskontakt mit der Wirklichkeit treten“.
1930 stellte Tretjakow sich dem nordkaukasischen Kombinat „Herausforderung“, einer Vereinigung von 16 Kolchosen unweit von Beslan, für Bildungsarbeit zur Verfügung. Anschließend veröffentlichte er das Buch „Feld-Herren“ darüber, das bereits im Jahr darauf auf Deutsch herauskam und hier fast zu einem Bestseller wurde. Es ist jedoch mehr von bolschewistischem Enthusiasmus als von wirklicher Kenntnis des Dorfes und der Landwirtschaft getragen – dazu absolut staatstragend. Der eher anarchistisch inspirierte Platonow ließ dagegen bereits 1928 in seinem Essay „Tsche-tsche-O“ seinen Helden sagen: „Die Kollektive in den Dörfern brauchen wir jetzt mehr als den Dnjeprostroi…Und schon bereitet der Übereifer Sorgen…verschiedene Organe versuchen, beim Kolchosaufbau mitzumischen – alle wollen leiten, hinweisen, abstimmen…“, so zitiert ihn die Platonow-Expertin der DDR Lola Debüser, die darauf hinweist, dass der Autor die Tragik und letztlich das Scheitern der Kollektivierung vor allem im „staatlich-bürokratischen und repressiven Mechanismus“ von oben sah, der den „Garten der Revolution“ mit seinen „kaum erblühten Pflanzen“ zerstampfte. Das Ringen mit dieser „mechanischen Kraft des Sieges“ thematisierte Platonow auch in seinen zwei Romanen aus dem „Jahr des großen Umschwungs“ 1929: „Tschewengur“ und „Die Baugrube“. In diesem läßt er einen Kulaken sagen: „…ihr macht also aus der ganzen Republik einen Kolchos, und die ganze Republik wird zu einer Einzelwirtschaft…Paßt bloß auf: Heute beseitigt ihr mich, und morgen werdet ihr selber beseitigt. Zu guter Letzt kommt bloß noch euer oberster Mensch im Sozialismus an.“ Daneben ging es Platonow auch um die durch die Mechanik der Macht (wieder) forcierte Trennung von Kopf- und Handarbeit, mit der die ganzheitlichen Maßstäbe und die bewußte Teilnahme des Einzelnen am Aufbau des Sozialismus zerstört werden. „Der Mensch war [durch die siegreiche Revolution] – so empfand Platonow das zumindestens – aus dem System der sozialen Determiniertheit ‚herausgefallen‘, alles schien möglich und leicht realisierbar,“ schreibt der russische Platonowforscher L. Schubin. Aber diese Möglichkeiten wurden nach und nach von der „Mechanik der Macht“ zurückgedrängt. „Die Technik entscheidet alles,“ verkündete Stalin 1934 und meinte damit nicht nur die Industrialisierung der Landwirtschaft – vom Traktor bis hin zu agronomischen Verfahren, sondern auch die administrativ umgesetzten neuen Erkenntnisse der Wissenschaft – vor allem der „proletarischen Biologie“.
Der französische Marxist Charles Bettelheim merkte dazu 1971 an: „Wer hier handelt, das ist die Technik, und es ist der Bauer, auf dessen Rücken gehandelt wird“. In seinen Samisdat-„Aufzeichnungen aus dem Untergrund“ kam Boris Jampolski 1975 zu einer ähnlichen Einschätzung: „Wenn [E.T.A.] Hoffmann schreibt: ,Der Teufel betrat das Zimmer‘, so ist das Realismus, wenn die [Sowjetschriftstellerin] Karajewa schreibt: ,Lipotschka ist dem Kolchos beigetreten‘, so ist das reine Phantasie.“ Für diese Autorin ist Literatur „staatliches Schönschreiben“, könnte man dazu mit Platonow auch sagen. In seinem Roman „Tschewengur“ läßt er einen seiner Helden zu der Erkenntnis kommen: „Hier liegen keine Mechanismen, hier leben Menschen, die kann man nicht in Gang setzen, solange sie nicht selbst ihr Leben einrichten. Früher habe ich gedacht, die Revolution ist wie eine Lokomotive. Jetzt aber sehe ich: Nein, jeder Mensch muß seine eigene Dampfmaschine des Lebens besitzen…damit mehr Kraft da ist. Sonst kommt man nicht vom Fleck.“
Auf dem Plenum der KPdSU zur Agrarpolitik am 15. März 1989 formulierte es zuletzt Michail Gorbatschow rückblickend so: „…die Führung des Landes ging [Ende der Zwanzigerjahre] nicht den Weg der Suche nach ökonomischen Methoden, um die Probleme und Widersprüche zu lösen, sondern einen anderen, direkt entgegengesetzten Weg – den Weg des Abbaus der NEP,…der administrativen Kommandomethoden…Die natürliche Unzufriedenheit der Bauern wurde als eine Art Sabotage gedeutet. Und damit wurde die Notwendigkeit repressiver Maßnahmen gerechtfertigt…Im Agrarsektor lebten die Methoden außerökonomischen Zwangs aus den Zeiten des Kriegskommunismus wieder auf“. Hierzulande kennen wir dagegen den „ökonomischen Zwang im Agrarsektor“ nur allzu gut: „Wer nicht wachsen will muß weichen“, sagen die Bauern dazu, d.h. von der EU wird permanent eine Politik der Liquidierung der Dorfärmsten als Klasse betrieben – zugunsten der Kulaken.
In Platonows „Armeleutechronik“ sucht der unstete Wanderer demgegenüber einen humanistischen Weg. Im Kolchos „Kulakenfrei“ trifft er auf den Vorsitzenden Senka Kutschum, der eine interessante Kollektivierungspolitik betreibt: Und im Kolchos des Vorsitzenden Kondrow geht die Kollektivierung so erfolgreich und ohne Überspitzungen voran, , „weil er selbständig denkt und andere zum Mitdenken auffordert, auch weil er sich gegen unqualifizierte Direktiven von oben wehrt. Kondrow ist glücklich, als Stalins Artikel seinen vernünftigen Weg bestätigt. Platonows Erzähler stellt fest: ‚…es gab Orte, die frei blieben von schwindelerregenden Fehlern…Doch leider waren solche Orte nicht allzu zahlreich‘.“ Stattdessen gab es viele Aktivisten, die nur allzu bereit waren, jede Maßnahme der Administration zu exekutieren. In „Die Baugrube“ hat Platonow solch einen porträtiert: „Auch dem Aktivisten war der gelbliche Abendhimmel, diese Begräbnisbeleuchtung, aufgefallen, und er beschloß, gleich morgen früh das Kolchosvolk zu einem Sternmarsch zu formieren, der in die umliegenden Dörfer führen sollte, die sich noch immer ans Einzelbauerntum klammerten…Der Aktivist befand sich noch auf dem Orghof, die vorige Nacht hatte nichts erbracht, keine einzige Direktive war von oben herab auf den Kolchos geflattert, und so mußte er notgedrungen den Gedanken im eigenen Kopf freien Lauf lassen. Doch sie brachten Unterlassungsängste mit sich. Braute sich nicht doch Wohlstand auf den Einzelgehöften zusammen? War ihm in dieser Beziehung etwas entgangen? Andererseits war nichts gefährlicher als Übereifer – deshalb hatte er nur den Pferdebestand vergesellschaftet und grämte sich nun über die vereinsamten Kühe, Schafe und Hühner, denn in der Hand des spontanen Einzelbauern konnte schließlich auch der Ziegenbock zum Hebel des Kapitalismus werden.“ Platonow spielt hier ironisch sowohl auf die Parteirechten um Bucharin an, die für eine eher sanfte Kollektivierung plädiert hatten, als auch auf die Linken, die Stalin mit den Trotzkisten aus der Partei ausgeschlossen hatte. Letztere befürworteten eine noch radikalere Lösung der Bauernfrage. Später wandte sich Stalin auch gegen die Bucharinisten.
In der Kolchose von Gremjatschi Log, deren Entwicklung Scholochow beschreibt, wird der Aktivist Makar Nagulnow wegen seines Kampfes für die „hundertprozentige Kollektivierung“ plötzlich des „Trotzkismus“ verdächtigt. Er verteidigt sich: „Ich bin nicht Trotzki wegen mit den Hühnern nach links geraten. Ich wollte nur so schnell wie möglich den Eigentumsmenschen, den Kleinbürger matt setzen“. Er muß sich jedoch sagen lassen, dass solche linksradikalen „Verzerrungen“ , ja sogar „ungebührliche Drohungen gegen Bauern“ bei der Kollektivierung laut Stalins Artikel „Vor Erfolgen vom Schwindel befallen“ nur dem Feind nützen – also dem „rechten Opportunismus“. Es wurde daraufhin beschlossen, dass die Kollektivbauern ihr Kleinvieh und sogar eine Kuh zurück bekommen. Stalin legte sogar genau fest, wieviel Morgen Land jeder in Zukunft privat bewirtschaften durfte. Damit gerieten viele Kolchosen erneut in Schwierigkeiten, denn die Bauern arbeiteten bald lieber auf ihrem kleinen Privathof als in der großen Kollektivwirtschaft.
Nach 1990 bekamen sie mehr Land, manchmal sogar sehr viel mehr, dass sie jedoch meistens gar nicht haben wollten: Womit hätten sie es bearbeiten können? Sie arbeiteten weiter auf den umgewandelten bzw. privatisierten Kolchosen und ließen auch weiterhin ihre kleinen Parzellen von deren Traktoristen mitbearbeiten.
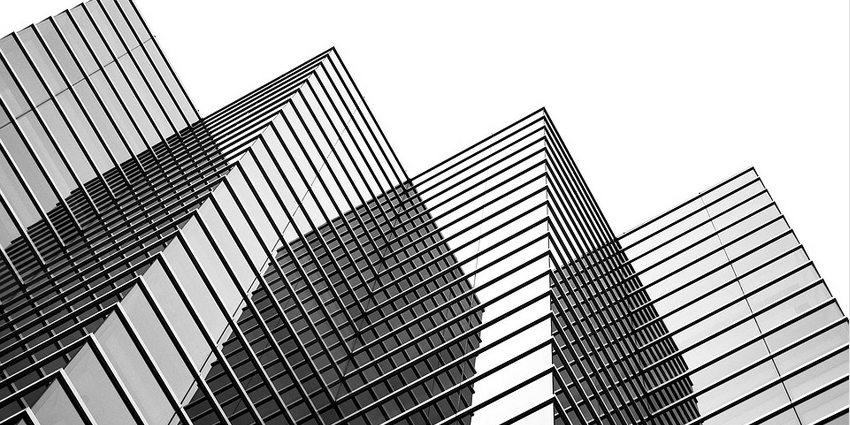



Wenn oben gesagt wurde, dass Russland das Mutterland der Genossenschaften ist, wobei vor allem an die dortige mindestens seit dem Mittelalter existierende „Obschtschina“ (Dorfgemeinschaft/Landkommune) gedacht war, die von den Bolschewiki dann in eine „Kolchose“ (Abkürzung aus Kollektiv und Wirtschaftsform) transformiert wurde, wobei sie den Boden, der vorher dem Dorf gehört hatte, verstaatlichten, dann muß man auch die Kibbuz-Bewegung in Palästina bzw. Israel erwähnen, denn diese so überaus erfolgreichen Agrargenossenschaften, die nahezu sämtliche Beziehungen ihrer Mitglieder – der Kibbuzniks – untereinander kommunistisch organisierten, wurden fast ausschließlich von russischen Juden gegründet – in den ersten vier Auswanderungswellen (Alija).
Die erste datiert man von 1882 bis 1903.
Die zweite von 1904 bis 1914.
Die dritte von 1919 bis 1923
Die vierte von 1932 bis 1948.
Erst mit den darauffolgenden Auswanderungswellen kamen auch Juden aus Westeuropa, Afrika, Asien und Angloamerika ins Land. Es waren dann auch vor allem diese – aus Deutschland und Angloamerika, die das russisch-kommunistische Kibbuz-Konzept langsam vor die Hunde gehen ließen, indem sie Individualismus, Privateigentum, Privatkonten, Privatautos, Privatkinder etc. einführten. Heute spricht man deswegen durchweg von einer „Kibbuz-Krise“.
Zwar gibt es auch wieder etliche Neugründungen, neuerdings sogar in Städten, aber das scheinen eher juvenile Modererscheinungen zu sein, so wie hier Hausbesetzungen, Punk-WGs, Veganer-Etagen, Friedens-Camps und ähnliches.
Diese ganzen experimentell engagierten „Studi-Projekte“ gab es in Russland auch – allerdings schon 1868!!!