
Der Titel bezieht sich auf das Lied der Seeräuber-Jenny in der „Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht. Es wurde zuletzt gesungen am Grab von Christian Semler. Die taz gibt bis zu ihrem alljährlichen „taz-lab“ im April ein Buch mit Semlers schönsten Texten heraus., daneben stellt sie einen Film über Semler von Harun Farocki online. Hoffentlich sind in dem Buch auch einige seiner Artikel über China dabei (Semler war Maoist). Als wir uns im Januar zuletzt unterhielten (in der Kaffeeküche), sprachen wir noch einmal über China. Hier ein Text aus
„Semlers Wortkunde“ (2008):
In der Krise zwischen China und Tibet erlebt der Terminus „Volkskrieg“ eine Renaissance. Nur was bedeutet er?
„Führt einen Volkskrieg, um den Separatismus zu bekämpfen und die Stabilität Chinas zu verteidigen, zerrt die widerwärtige Fratze der Dalai-Lama-Clique ans helle Licht des Tages!“ So zitiert die Sonntagsausgabe des offiziellen Tibet Daily aus einer Erklärung, die anlässlich eines Treffens von Funktionären der tibetanischen Branche der KP Chinas in Lhasa abgegeben wurde. George Orwell hätte an diesem Zitat seine grimmige Freude gehabt. Denn die Verwendung des Begriffs „Volkskrieg“ durch die kommunistischen Funktionäre passt ins Schema der semantischen Umkehrung, die in Orwells „1984“ dargestellt wurde: Freiheit = Sklaverei.
Ursprünglich war der Begriff des Volkskriegs im chinesischen Befreiungskampf ein Gegenbegriff zur Kriegsführung der japanischen Angreifer und – nach 1945 – zur Kriegsführung der nationalistischen Streitkräfte Tschiang Kai-scheks. Gemeint war damit viererlei: erstens das Primat der Politik bei den kommunistischen Streitkräften, Gleichheit zwischen den Rängen, Verzicht auf brutale Disziplinierungsmaßnahmen; zweitens die Unterstützung durch die Bevölkerung, sei es in Form des Partisanenkampfes oder durch materielle Hilfe; drittens das Verbot, die Zivilbevölkerung zu berauben oder sie zum Kriegsdienst zu pressen; und viertens die Durchführung sozialer und kultureller Programme in den „befreiten Gebieten“, also den Territorien, die von den kommunistischen Streitkräften kontrolliert wurden.
Dieses Element der sozialen Emanzipation war es vor allem, das die radikalen Studenten Ende der 60er-Jahre in Deutschland „Sieg im Volkskrieg“ skandieren ließ – diesmal auf den Befreiungskampf des vietnamesischen Volkes bezogen.
Nun ist uns aus dem Sprachgebrauch der westlichen Welt die uferlose Ausweitung des Begriffs „Krieg“ bekannt, bis hin zu offensichtlich sinnwidrigen Begriffsbildungen wie „Krieg gegen Aids“ oder „Krieg gegen Armut“. Diese metaphorische Weiterung hatten augenscheinlich die Funktionäre in Lhasa im Sinn, als sie „Volkskrieg“ mit „Massenmobilisierung“ identifizierten. Es geht also um die tibetischen „Massen“, die den Dalai Lama bekämpfen sollen. Diese Rolle nehmen chinesische Polizei und Soldateska wahr, unterstützt von tibetischen „Wohlgesinnten“. Sie sind das eigentliche Volk, das gegen eine bloße Zusammenrottung, eine „zufällige“ Volksmenge, also das empirische tibetische Volk, den gerechten Volkskrieg führt.
Hier drei chinesische Feng-Shui-Poller:

Das folgende Photo zeigt einen versenkbaren Poller aus den USA auf einem deutschen Prüfstand von Promis. Es wurde von Philipp Goll bei einer Uwe-Nettelbeck-Recherche gefunden. Nettelbeck druckte in seiner Zeitschrift „Die Republik“ einmal alle Dialoge ab, die in der von Hans Rosenthal moderierten Sendung „Dalli-Dalli“ geführt wurden.

Flugfähigkeit und -sicherheit
Alle reden von der Flugsicherheit (beim neuen Flughafen), aber keiner von der Flugfähigkeit. Ich befragte dazu einen Experten – zunächst über die Flugfähigkeit der Schwäne, der schwersten Vögel Europas: den Aviaingenieur Johannes Eissing, der sich bereits als Jugendlicher technisch mit dem Flug der Schwäne beschäftigte – während seine Schwester in ihrem damaligen Wohnort an einem Kanal, in dem einige Schwäne lebten, es diesen dergestalt nachtun wollte, dass sie, wenn die Vögel aufflogen, neben ihnen her lief und dabei heftig mit den Armen ruderte. Später verlegte sie sich aufs Meditieren, um wenigstens im metaphorischen Sinne Wind unter die Flügel zu bekommen. Ihr Bruder, der weiterhin auf das Fliegen mit Hilfe einer Maschine setzte und inzwischen als Konstrukteur von Luftschiffen in Kalifornien arbeitet, schrieb mir von dort: „Schwäne sind tatsächlich mit ihrer Größe ziemlich am Rande des Möglichen, bei gegebenem Muskelwirkungsgrad, Sauerstoffgehalt und Dichte der Luft. Das ist sehr schön populärwissenschaftlich erklärt in Werner Nachtigals ‚Vogelflug und Vogelzug‘. Größer geht nicht. Flugsaurier und Riesenlibellen hatten damals wahrscheinlich mehr Sauerstoff zur Verfügung. Das andere Ende der Fahnenstange bilden etwa Hummelkolibris, die es mit ihren 2-5 Gramm über den Golf von Mexiko schaffen. – eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Der Biologe Erich von Holst hatte mehrere Schwingenflugmodelle aus Balsaholz, Papier, Schilfhalmen, Gummi und Draht gebaut. Eines davon hiess ‚Schwan‘: Es gibt ein Video auf Youtube über seine Arbeiten. Ich hatte ähnliche Modelle nachgebaut und selbst entworfen. Weil mich das an die Grenzen meines Physik-Wissens brachte, hab ich dann schliesslich Flugzeugbau studiert.“
Bereits Leonardo da Vinci riet – aristotelisch beflügelt, man solle die Anatomie der Vögel studieren, samt „den Brustmuskeln, den Bewegern der Flügel.“ Und das gleiche müsse man bei den Menschen machen, um herauszufinden, „welche Möglichkeit im Menschen steckt, wenn er sich durch Flügelschlagen in der Luft halten will.“
In diese Richtung dachte noch Otto Lilienthal bei seinen Flugexperimenten, weil er ebenfalls eine „homomorphe Konstruktion“ anstrebte, wie Hans Blumenberg das 1957 in seinem Aufsatz über die „Nachahmung der Natur“ nennt. Der Philosoph bemerkt danach jedoch einen „Paradigmenwechsel“ im Flugmaschinenbau: Spätestens mit den amerikanischen Luftfahrtpionieren, den Gebrüdern Wright, sei es zu einer „Erfindung“ gekommen, die sich „von der alten Traumvorstellung der Nachahmung des Vogelflugs freimacht und das Problem mit einem neuen Prinzip löst.“ Voraussetzung dafür war laut Blumenberg der Explosionsmotor und, noch wesentlicher, „die Verwendung der Luftschraube“: Solche „rotierenden Elemente“ seien „von reiner Technizität,…der Natur müssen rotierende Organe fremd sein.“
Das sind sie aber nicht: In ihrem 1989 veröffentlichten „Leitfaden“ der Biologie: „Die fünf Reiche der Organismen“ schreiben die Mikrobiologen Lynn Margulis und Karlene V. Schwartz: „Während bestimmter Stadien ihres Lebenszyklus besitzen die Zellen der meisten Eukaryoten – viele Pflanzen, die meisten Protoctisten und die meisten Tiere – flexible, peitschenartige, im Zellinneren verankerte Fortsätze – sogenannte Undulipodien (Flagellen bei den Bakterien gennnt). Sie bestehen aus Bündeln von Mikrotubuli. Diese werden von einer Undulipodienmembran umschlossen, die eine Ausbuchtung der Zellmembran darstellt… Die Schlagbewegung eines Undulipodiums wird durch Umwandlung von chemischer in kinetische Energie entlang des gesamten Organells erzeugt. Bei den Flagellen der Bakterien (Prokaryoten) kommt die Bewegung durch die Rotation der Verankerungsvorrichtung in der Zellwand zustande.“ Die Autorinnen sprechen dabei von einem „Drehmotor“. Demnach gehören die „rotierenden Elemente“ quasi zur Grundausstattung der Natur…
Abschließend sei noch erwähnt, dass selbst die Mischwesen Engel, so wie Leonardo da Vinci und viele andere sie dargestellt haben, vollkommen flugunfähig sind. Ein Biologe der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hat 2002 ausgerechnet, welche Muskeln ein Engel haben müßte, um wirklich fliegen zu können. Er war auf eine Engelsgestalt mit dünnen Vogelbeinen gekommen und mit einer so muskelbepackten Brust, daß vorne ein großer Doppel-Buckel hervortreten müßte.
Schon 1845 hatte der Berliner Arzt Rudolf Virchow die Engel in der Malerei aus Sicht eines Anatomen kritisiert. Andere folgten. Unter ihnen bald auch Kunsthistoriker – wie Julius Langbehn, der die „Flügelmenschen“ als der „Wirklichkeit widersprechend“ ablehnte. Neuerdings hat sich der Wissenschaftshistoriker Peter Geimer mit dieser Engelskritik befaßt – in „Das Gewicht der Engel“ (abgedruckt in dem Aufsatzband „Kultur im Experiment“). Geimer konzentrierte sich dabei auf den Physiologen Sigmund Exner, der sich dabei bereits die Frage stellte, wie „es möglich wäre, dass sich ein menschlicher Körper gegen die Wirkung der Schwerkraft erhält“. Exner nahm sich einen Sperling als „Modell“, seine Überlegungen dazu erinnern Peter Geimer an jene, „die sieben Jahre später Otto Lilienthal in seiner Abhandlung ‚Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst‘ anstellte.“ Als Exner sie auf den Menschen übertrug, kam er auf einen „riesigen Buckel“, ebenfalls vorne. Er war weniger an Konstruktionen von Flugmaschinen interessiert als an der psychologischen Frage, warum das Schweben der Engel auf Bildern ihren Betrachtern, „obwohl es allen Naturgesetzen Hohn spricht, gleichwohl nicht als unwahrscheinlich, falsch oder ‚unschön‘ ‚erscheint‘.“ 1906 veröffentlichte er nach einer Reihe von Experimenten ein Buch über „Das Schweben der Raubvögel“.
Lebenswissenschaften
In Berlin gründeten mehrere naturwissenschaftliche Einrichtungen gerade zwecks Profitabilisierung ihrer Arbeiten den zentralen Bereich „Life Siences“ – mit einem Festakt. Der Name ist ironisch gemeint, denn natürlich erforschen diese Wissenschaftler schon lange nicht mehr „das Leben“. Sie interessieren sich nur noch für „die Algorithmen des Lebendigen,“ wie man das mit dem Genetiker Francois Jacob seit 1965 nennt. Mich interessiert das Leben jedoch weiterhin. Als ich neulich in die JW kam, fragte ich die Feuilletonredakteure: „Habt ihr Tierbücher?“ Hatten sie nicht, aber im Papierkorb unten im Haus fand ich dann in einer SZ vom Vortag gleich zwei Lebensberichte:
1. Über Darwins Frage, wie denn die „Falkland-Füchse“ auf die Inseln kamen. Sie waren „derart zahm, dass sie aus der Hand fraßen“ – wahrscheinlich, weil sie den Menschen 1833 noch nicht als Feind kannten.
So hat also der sowjetische Biologe Beljajew mit seiner Auslese der zahmsten „Blaufüchse“ in Sibirien über 50 Generationen nur das erreicht, was „die Natur“ schon vor 16.000 Jahren eingerichtet hatte. Damals – „auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit“ – gelangte der Falklandfuchs auf die Inseln – und das ohne die unangenehmen Nebeneffekte (Verkindlichung) von Beljajews künstlich erzeugter Zahmheit. Diese Effekte sind demnach Resultat einer auf Unterwerfung (Deduktion) beruhenden Zahmheit, während die natürliche aus Arglosigkeit gepaart mit Neugier besteht, mithin selbstinduziert ist. Die australischen Forscher, die ihre Datierung der Ankunft der Füchse auf den Falklandinseln durch Vergleich der DNA mit anderen ausgestorbenen Fuchsarten gewannen, wiederlegten damit u.a. die Ansicht, „dass frühe Menschen ihn mitbrachten“. Erst nach Darwins Falkland-Reise, da der Fuchs noch handzahm war, wurde er wegen der massenhaften Einführung der Schafzucht verfolgt, 1876 erschoß man den letzten.
Einige europäische Forscher meinen: „Eine Besiedlung über eine Eisbrücke ist unwahrscheinlich, da der Fuchs die letzte Eiszeit wohl kaum auf den Inseln überlebt hätte.“ Während die australischen Forscher behaupten: „Wenn das Meer auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit an einigen Stellen zufror, konnte der Fuchs hinüberlaufen und unterwegs Robben und Pinguine fangen. Kleinere Säugetiere wie Ratten aber wären auf dem Eis verhungert.“
2. Kanadische Biologen haben sich in der Erforschung des ausgestorbenen Riesenkamels hervorgetan, dessen 3,5 Millionen Jahre alte Knochen auf der arktischen Insel „Ellesmere Island“ sie untersuchten. „Kamele stammen aus Nordamerika und haben sich über die Bering-Landbrücke nach Eurasien ausgebreitet,“ schreiben die Forscher. Ihr Vorfahr ist das Riesenkamel, als es lebte, war die Arktis noch bewaldet. Auf der immer schmaler werdenden Landbrücke zwischen Alaska und Sibirien drängten also einerseits die sibirischen (mongolischen) Völker nach Amerika und andererseits die nordamerikanischen Trampeltiere nach Sibirien.
Bei der „Entdeckung“ Amerikas“ 1492 lebten ca. 12 Millionen „Indianer“ in Nord- und Südamerika. Man nahm an, ihre Vorfahren wanderten vor etwa 15.000 Jahren aus Asien ein. Dafür sprachen die Steinwerkzeug-Funde der sog. „Clovis-Kultur“: Jäger, die Mammuts, Büffel und die später ausgerotteten amerikanischen Pferde verfolgten. Als vor rund 9.000 Jahren angeblich das Wild ausstarb, soll auch die Clovis-Kultur zugrunde gegangen sein.
Dagegen sprechen nun über 30.000 Jahre alte Funde aus Brasilien und Chile. Man mußtmaßt, dass die Südamerikaner gar nicht mit den Nordamerikanern verwandt sind. Sie erreichten den südlichen Kontinent von dem Australien vorgelagerten Polynesien aus: „Wegen der Eiszeit lag der Meeresspiegel so niedrig, daß sie mit Booten von Insel zu Insel hopsten.“ Der norwegische Widerstandskämpfer Thor Heyerdahl hat nach dem Krieg die entgegengesetzte Route zu beweisen versucht, indem er mit einem Floß aus Balsaholz 1947 von Südamerika aus nach Polynesien segelte. Sein Bericht darüber heißt wie sein Floß: „Kon-Tiki“.
Etwa zur gleichen Zeit meinte der Verhaltensforscher Konrad Lorenz über die australischen Dingos, sie seien als Haushunde mit den ersten Aborigines per Schiff gekommen. Und diese Menschen hätten sich rückwärts entwickelt, seien also immer primitiver geworden, weil sie u.a. den Bootsbau verlernt hätten und ihre Haushunde verwildern ließen. Im Zuge der Besiedlung durch die Weißen ab 1788 waren die Ureinwohner von diesen im Maße sie sie unterdrückten als zunehmend primitiver eingestuft worden. Die Einschätzung reichte vom „geistigen Niveau eines Kindes“ bis zu „kaum menschlich“ und „fast wilde Tiere“. Heute heißt es quasi offiziell: Sie gehören zusammen mit den Buschmännern und den Pygmäen zur ältesten menschlichen Rasse. Sie waren die ersten, die vor 60.000 Jahren Afrika verließ. Die Aborigines haben die größte genetische Vielfalt – gefolgt von den Buschmännern. Die DNA ihrer Mitochondrien ist mindestens 35.000 Jahre alt. So lange leben in etwa auch die Dingos in Australien. Aborigines und Dingos jagen jeder für sich (inzwischen?).
Für die Lokalausgabe der taz nahm ich dann noch einmal einen Anlauf zu den neugegründeten „Lebenswissenschaften“ (Life Sciences) in Berlin, indem ich zum Gründungs-Festakt in der Humboldt-Universität ging. Als ich meinen Text in der Redaktion abgab, hatte ich das Gefühl, das diese Gründung, die mich ziemlich deprimiert hatte, als nicht besonders „wichtig“ wahrgenommen wurde.
Mir schien dagegen, dass mit dem immobilienmäßig abgerundeten Gründungs-Festakt für ein „Life Sciences“-Zentrum etwas nachvollzogen wird, was die Universität Basel II schon vor etlichen Jahren versuchte – damals gab es noch Proteste dagegen:
Ich schrieb 2012 darüber: Es gibt noch ein paar andere Lebensforscher: Die Schweizer Biologin Florianne Koechlin z.B.. Sie hat drei Jahre nach ihrem Buch „Zellgeflüster“ (2005) einige neuere Pflanzenforschungsergebnisse zusammengetragen. Dazu interviewte sie Botaniker, Mikrobiologen, Bauern, Gärtner, Neurobiologen und Künstler. „Pflanzenpalaver“ heißt ihre neue Aufsatzsammlung. Koechlin hat daneben die „Rheinauer Thesen zu Rechten von Pflanzen“ zusammengestellt. Sie sind Grundlage dafür, dass der Schweizer Ethikrat beschließen möge, Pflanzen sind nicht länger eine „Sache“ – ein seelenloser Gegenstand.
In einem Artikel über ihren Biologielehrer, den Basler Professor Adolf Portmann, schrieb sie: „Seine Tiersendungen waren legendär. Portmann, der Autor von Büchern wie ‚Alles fliesst‘ oder ‚Biologie und Geist‘, ist 1982 im Alter von 85 Jahren gestorben, doch seine holistische Biologie ist aktueller denn je. ‚Portmann war einer der grössten Biologen des zwanzigsten Jahrhunderts‘, sagt der Basler Biologe Markus Ritter. ‚Ihn interessierte die stupende Vielfalt der lebenden Welt. Er versuchte, Lebewesen in einem ‚ganzheitlichen‘ Sinn zu erfassen‘.
…Ritter spinnt den Faden von Portmanns Geschichte weiter: ‚Die Biologie der Kriegsperiode von 1931 bis 1945 war eng mit dem politischen Weltbild des Nationalsozialismus verschränkt.‘ In Mode war ein simpler Neodarwinismus: Die Tüchtigsten überleben; die Schwachen sterben aus. Portmann widersprach dezidiert und führte seine Gestaltenlehre an: Warum, so fragte er, sind maritime kleine Hinterkiemerschnecken derart farbenprächtig und warum haben sie eine so unglaubliche Formenvielfalt? Das kann durch simple Selektionstheorien allein nicht erklärt werden.
In den sechziger Jahren kam die Molekularbiologie auf. Euphorische Töne um die genetische Verbesserung des Menschen zogen die Wissenschaftswelt in ihren Bann. 1962 fand in London das berühmte Ciba-Symposium mit dem Titel ‚Der Mensch und seine Zukunft‘ statt. Thema war die genetische Manipulation und Verbesserung des Menschen. Die damals bekanntesten GenetikerInnen – unter ihnen einige Nobelpreisträger – entwarfen dort ihre kühnen Visionen zur Planung des Menschen: Menschen sollten intelligenter sein, älter werden, weniger Schlaf benötigen, grössere Gehirne haben. Portmann war schockiert: ‚Da betreiben wir heute einen wahren Götzendienst und tun, als sei wirklich der Schlüssel zu allem Erbgeschehen gefunden. Wer in Hinsicht auf das Erbgeschehen die Proportion zwischen gesichertem Wissen und noch unbekannten Vorgängen auch nur einigermassen ahnend vor Augen hat …, der kann gegenüber dem Optimismus mancher genetischer Planung nur ein kategorisches Nein aussprechen‘.
Die Molekularbiologie eroberte auch Basel. In den sechziger Jahren entstand die Idee, ein spezielles Institut für Molekularbiologie und Genetik zu gründen, das spätere Biozentrum. Damit begann ein Kulturkampf: Die Zukunft gehörte fortan der Molekularbiologie und der Genetik, also den exakten Wissenschaften, die das Leben von den Bausteinen her zu erklären versuchten. Dahin sollten die Finanzströme fliessen, nicht in die als altmodisch empfundene Vielfaltsforschung. Portmann wurde kaltgestellt und aus fachwissenschaftlichen Kreisen ausgegrenzt.“
Später heißt es dazu in einem Flugblatt des Basler Biologie-Lehrgangs:
„Die Biologie an der Uni Basel ist heute immer noch schwergewichtig auf die Molekularbiologie und das Biozentrum ausgerichtet. Doch seit drei Jahren gibt es ein interdisziplinäres Biologie-Curriculum, das allen Biologiestudierenden eine breite Ausbildung ermöglicht: Angehende Molekularbiologinnen sollen nebst Genen auch ganze Organismen und Ökosysteme kennen lernen; angehende Zoologen die Grundlagen der Molekularbiologie rudimentär beherrschen. Das Curriculum gilt als innovativ und pionierhaft…
Ein umstrittener Sparbeschluss des Unirates könnte diese Entwicklung nun torpedieren. Der Unirat will eine Botanik-Professur streichen und einen Teil der Botanik aus dem Departement Integrative Biologie herausnehmen. Das würde die integrative Biologie massiv schwächen, während die ohnehin starke Molekularbiologie nochmals aufgestockt würde.“
Hier mein taz-Artikel über die Gründung des lebenswissenschaftlichen Zentrums zu Berlin:
– Am 7.März im Festsaal der Humboldt-Universität. Der Gebäude-Park-Komplex des alten veterinärmedizinischen Instituts der Humboldt-Universität nennt sich heute „Campus-Nord“. Dazu gehört das ehemalige Hauptgebäude der Akademie der Künste an der Luisenstraße und demnächst auch das Haus der Ständigen Vertretung der BRD in der Hannoverschen Straße, in dem jetzt noch das Bundesministerium für Bildung und Forschung untergebracht ist. Dieses wird sich auf Basis eines „Public-Private-Partnerships“ anderswo domizilieren. Auf dem Campus-Nord, wo auch für die HUB-Biologen ein neues Haus gebaut wird, entsteht ein „integratives Forschungsinstitut für die Lebenswissenschaften“ (kurz: IRI-LS). Vorgestern wurde es gegründet – als „Flagschiff“ im Rahmen der HUB-Exzellenz-Initiative. Beteiligt sind daran die Charité und das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Buch (wo man einst im Krieg die Idee „Ein Atom ein Gen“ entwickelte). Letzteres, das MDC, ist mit ihrem „Berlin Institute for Medical Systems Biology“ (BIMSB) vertreten, für das ebenfalls ein neues Gebäude geplant ist. Der Charité wird dafür das Betten-Hochhaus renoviert. Im IRI-LS will man „lebenswissenschaftliche Spitzenforschung“ betreiben.
Ende 2012 wurde mit der Teilfusion von Charité und Max-Delbrück-Centrum bereits ein „Berliner Institut für Gesundheitsforschung“ (BIG) gegründet, mit dem ein „international sichtbarer Leuchtturm in den Lebenswissenschaften geschaffen wurde“, wie es hieß. Die Erben des Kriegsgewinnlers und Ariseurs Quandt steuerten 40 Millionen Euro zum BIG bei.
Der „Life Sciences“-Leuchtturm und das „Life Sciences“-Flaggschiff wollen nun aber nicht gegeneinander Wissen schaffen, sondern dabei kooperieren. Der bereits vielgelobte HUB-Campus Adlershof gibt dabei das „Schema“ vor. Es geht auf dem Campus-Nord organisatorisch und theoretisch um die Einheit der Naturwissenschaft (an der Humboldt scheiterte) und praktisch um „personalisierte Medizin“, d.h. genetisch auf den Kranken zugeschnittene Therapien, wobei die Grundlagenforschung von der molekularen Ebene bis zur medizinischen Arbeit reicht. Dazu müssen „Lösungen für komplexe biomedizinische Probleme“ gefunden werden. Das „neue Forschungsformat“ soll „internationale Spitzenleistungen“ erbringen. Und wenn das gelingt, dann ist nicht nur der „Weg zur Weltspitze nicht mehr fern,“ wie einer der Festredner visionierte, sondern auch der Weg der Forschungsergebnisse in die wirtschaftliche Verwertung.
„Wir sind dabei sehr darauf aus, quantitativ zu arbeiten, auf der Basis mathematischer Theoriebildung,“ fügte der Sprecher des IRI LS hinzu, wobei man sich „auf den großen Reichtum an Mathematikern, den es in dieser Stadt gibt“, stützen will. Der Informationsdienst Wissenschaft frohlockte: „In Berlins Mitte wird das Leben erforscht“. Besser gesagt: das, was vom „Leben“ übrig geblieben ist: Gene, Epigene, Enzyme, Moleküle, Botenstoffe, Proteine… Die Lebenswissenschaften erforschen „nicht mehr das Leben, sondern die Algorithmen des Lebendigen,“ könnte man mit dem Genetiker Francois Jacob sagen, der für diesen „Switch“ (von ihm „Operon“ genannt) 1965 den Medizin-Nobelpreis bekam. So gesehen ist der neue Begriff „Life Sciences“ nur noch ironisch gemeint. „Das Leben lebt nicht mehr,“ unkte bereits Adorno. Das merkt man bereits am Jargon. So ist z.B. von „Photosyntheseapparaten“ die Rede, wenn die frei lebend und zugleich als Symbionten in Pflanzen und Cyanobakterien vorkommenden Chloroplasten gemeint sind, mit deren Hilfe man z.B. im schon bestehenden „Exzellenz-Cluster ‚UniCat'“ der Humboldt-Universität Wasserstoff gewinnen will.
Als Hauptredner auf dem Festakt zur Gründung des Life Sciences Zentrums sprach der israelische Chemiker Aaron Ciechanover über molekulare Medizin. Er bekam 2004 den Nobelpreis für die Entdeckung der Funktion des Steuer- und Kontrollproteinsystems „Ubiquitin“ (von ubiquitär – allgegenwärtig) in Zellen mit Zellkern: „Ist dieses System gestört, kann es zu zahlreichen Krankheiten beitragen – Krebs, Alzheimer…Pharmafirmen stiegen in dieses Forschungsfeld ein und inzwischen gibt es auf dieser Basis ein Medikament zur Krebsbehandlung auf dem Markt,“ erklärte Aaron Ciechanover dazu der Berliner „Jüdischen Zeitung“ am Tag des Festaktes. Und zeigte damit bereits den Weg von der molekularen Grundlagenforschung bis zur medizinischen Therapie auf. So kann es also funktionieren. Bleibt zu hoffen, dass die Humbodt-Universität mit der Einrichtung eines kulturwissenschaftlichen Bereichs „Animal Studies“ ein gewisses „Lebens“-Gegengewicht schafft.
P.S.: Zu den Forschungsschwerpunkten des neuen Berliner Instituts für Lebenswissenschaften gehören natürlich auch die „Neurowissenschaften“. Dafür wird es wohl Gelder von der EU geben – den n erst kürzlich hatte die Europäische Kommission entschieden, eine Milliarde Euro in ein „Human Brain Project“ zu investieren. Und wenig später verkündete US-Präsident Obama, dass die USA in den nächsten 10 Jahren bis zu 3 Milliarden Dollar in ein neues Projekt, genannt „Brain Activity Map“, investieren wollen. „Wir müssen in die besten Ideen investieren“, sagte Obama. „Jeder Dollar, den wir für die Kartierung des menschlichen Erbguts ausgegeben haben, hat uns 140 Dollar eingebracht. Heute kartieren Wissenschaftler das menschliche Gehirn.“ Auch dabei soll sich jeder Dollar hundertfach auszahlen. Der Tagesspiegel schrieb über dieses Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Vermessung unserer lichtlosen Schädel:
Henry Markram, Leiter des „Human Brain Project“ an der Schweizer Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, sieht die „Brain Activity Map“ nicht als Konkurrenz: „Sie generieren Daten, wir fügen die Puzzlesteine zusammen“, sagt er. Sein Ziel ist es, mithilfe von Supercomputern alle bisher bestehenden Daten über das menschliche Gehirn zusammenzufassen. Spezielle Algorithmen sollen ihm dabei helfen, trotz enormer Wissenslücken ein Computermodell des Gehirns zu erstellen. „Wir sind sehr froh über das amerikanische Projekt“, sagt Markram. „Je mehr Daten es gibt, desto besser ist das für uns.“
Die Endspieltheorie
1984 (!) veröffentlichte der US-Schriftsteller Thomas Pynchon in der „New York Times Book Review“ einen Text, in dem er die alte Frage beantwortete „Is it o.k. to be a Luddit?“ Pynchon spielte damit auf die englischen Maschinenstürmer an, die man „Ludditen“ – nach ihrem fiktiven Anführer Ned Ludd – nannte, wobei er jedoch an eine mögliche Zerstörung der heutigen elektronischen Rechner dachte. Sein Text endete mit dem Satz: „Wenn die Kurven der Erforschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Robotern und der Molekularbiologie konvergieren… Jungejunge! Es wird unglaublich und nicht vorherzusagen sein, und selbst die höchsten Tiere wird es, so wollen wir demütig hoffen, die Beine wegschlagen. Es ist bestimmt etwas, worauf sich alle guten Ludditen freuen dürfen, wenn Gott will, dass wir so lange leben sollten.“
Der Anarchist Pynchon setzte in diesem Text eher auf einen marxistischen Determinismus, als auf Banden von Maskierten, d.h. er sieht den Aufstand bzw. Umsturz als einen, den die Geschichte (der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse) selbst hervorgebringen.
Von den „Ludditen“ war bereits 1953 in dem Roman „Das höllische System“ von Kurt Vonnegut die Rede gewesen. Es geht darin um die Massenarbeitslosigkeit produzierenden Folgen der Computerisierung, die den Menschen nur noch die Alternative Militär oder ABM läßt. Schon bald sind alle Sicherheitseinrichtungen und -gesetze gegen Sabotage und Terror gerichtet. An vorderster Front steht dabei der Mathematiker Norbert Wiener. Trotzdem organisieren sich die unzufriedenen Deklassierten im Untergrund, sie werden von immer mehr „Aussteigern“ unterstützt. Irgendwann schlagen sie los, d.h. sie sprengen alle möglichen Regierungsgebäude und Fabriken in die Luft, wobei es ihnen vor allem um den EPICAC-Zentralcomputer in Los Alamos geht. Ihr Aufstand scheitert jedoch. Nicht zuletzt deswegen, weil die Massen nur daran interessiert sind, wieder an „ihren“ geliebten Maschinen zu arbeiten. Bevor die Rädelsführer hingerichtet werden, sagt einer, der ausgestiegene Mathematiker John von Neumann: „Dies ist nicht das Ende, wissen Sie“.
Nach Erscheinen des Romans beschwerte sich Norbert Wiener brieflich beim Autor über seine Rolle darin. Die Genetik-Historikerin Lilly Kay merkt dazu an: „Wiener scheint den Kern von Vonneguts Roman völlig übersehen zu haben. Er betrachtete ihn als gewöhnliche Science Fiction und kritisierte bloß die Verwendung seines und der von Neumanns Namen darin.“ Vonnegut antwortete Wiener damals: „Das Buch stellt eine Anklage gegen die Wissenschaft dar, so wie sie heute betrieben wird“. Tatsächlich neigte jedoch eher Norbert Wiener als der stramm antikommunistische von Neumann dazu, sich von der ausufernden „Militärwissenschaft“ zu distanzieren, wobei er jedoch gleichzeitig weiter vor hohen Militärs über automatisierte Kontrolltechnologien dozierte. Erst der Mathematiker Theodore Kaczynski machte dann als „UNA-Bomber“ ernst. Er bekam lebenlänglich dafür.
Als das Gros der Militärwissenschaftler sich nach Ende des Kalten Krieges und der Reduzierung ihrer Forschungsbudgets nach neuen Jobs umtaten – und etliche dabei an der Wall Street landeten, besannen sie sich noch einmal auf den ungarischen Mathematiker John von Neumann, denn der hatte einst die „Spieltheorie“ ersonnen, die er 1944 mit dem Nationalökonomen Oskar Morgenstern in einen Zusammenhang mit „ökonomischem Verhalten“ brachte.
Der FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher hat diesen Einzug der Spieltheorie in die globalisierte Finanzökonomie als eine Katastrophe beschrieben – in seinem neuen Buch „Ego. Das Spiel des Lebens“. Und zwar deswegen, weil sie dort aus jedem von uns einen inhumanen „homo oeconomicus“ macht – einen Egomanen. Dazu ist zweierlei zu sagen: Zum Einen hat der Mathematiker und Politologe Robert Axelrod in spieltheoretischen Experimenten auch das Gegenteil beweisen können: „Die Evolution der Kooperation“ heißt diesbezüglich seine berühmte Studie. Er kooperierte dazu auch selber – mit der Mikrobiologin Lynn Margulis, die lamarckistisch inspiriert Symbiosen in der Natur für die evolutionäre Triebkraft hält – und nicht die Konkurrenz.
Zum Anderen erschien ein Jahr vor Schirrmachers „Ego“-Buch bereits ein Festschrift für den Philosophen Wolfgang Pircher mit dem Titel: „Spielregeln“ ( herausgegeben vom Kulturwissenschaftler Peter Berz u.a.). Darin beschäftigen sich nicht wenige der 24 Autoren mit der „Spieltheorie“. Ein Beitrag hat sogar Schirrmachers Titel vorweggenommen: „Das Spiel des Lebens“. Schirrmacher hat diese für sein Thema wichtige Aufsatzsammlung nicht erwähnt, ob er sie ignoriert, gar plagiiert hat, weiß ich nicht, das läßt sich aber rauskriegen.
P.S.: Vom Mitherausgeber der Festschrift, Peter Berz, bekam ich folgendes Zitat aus dem Buch „Die Evolution der Kooperation“ von Robert Axelrod 1984/1988 geschickt: „Das iterierte Gefangenendilemma ist das E.coli der Sozialpsychologie.“ ( S. 25)
Arbeitsräume
Man geht davon aus, dass sich im „Quattrocento“ infolge der Verbesserung der Artillerie und damit zusammenhängend des Festungsbaus die noch als Handwerksverbund organisierten „Bauhütten“ zersetzten – in wenige Kopfarbeiter und viele Handarbeiter. Dies fand auf der einen Seite seinen räumlichen Ausdruck in der „Manufaktur“ und dann in der militärisch organisierten „Fabrik“ – auf der anderen Seite im „Büro“ oder im „Atelier“. Um diese Produktionsstätten von Künstlern, Architekten, Ingenieuren, die mitunter „Klösterliches“ zitierten, entstand schnell ein Kult. So wurden z.B. aus vielen „Arbeitszimmern“ der Intelligencija nach ihrem Tod Museen. Mit den Naturwissenschaften kamen die „Labore“ in Mode. Dazu heißt es auf Wikipedia: „Im Gegensatz zum Büro wird im Labor auch praktisch gearbeitet, das heißt es werden die verschiedensten Experimente, Prozesskontrollen, Qualitätskontrollen durchgeführt und/oder es werden chemische Materialien bearbeitet sowie chemische Produkte hergestellt (Beispiel Chemielabor).“ Manchmal fliegt so ein Labor auch in die Luft. Mit „Kult“ meine ich hier eine religiöse Praktik, die so etwas wie Anbetung bewirkt – die Genialität, die schon lange vor dem Menschenrecht mit dem Copyright liebäugelte. Aber im Laboratorium wurde, wie der Name schon sagt, meist gemeinschaftlich gearbeitet – z.B. Körperteile vermessen und verglichen. Die Französische Revolution vermehrte diese Art von Wissensproduktion noch einmal. Wolf Lepenies erwähnt in seiner Studie über „Das Ende der Naturgeschichte“ eine Besucherin des Zootomischen Kabinetts im Jardin des plantes, wo sie den Naturforscher Cuvier und seinen Prosektor Rousseau bei der Arbeit sah: Statt in eine „Kirche“ sei sie überraschenderweise in eine „Küche“ geraten, meinte sie. Einhundert Jahre später haben sich die Verhältnisse geändert: Ein Kritiker der ansonsten von ihm verehrten Naturwissenschaftler Claude Bernard, Darwin, Charcot und Pasteur fühlte sich zu der Feststellung veranlaßt, „ein Labor sei keine Kapelle, sondern nichts als eine Werkstatt.“
Während der russischen Revolution entstanden aus diesen Werkstätten bzw. Küchen oder Laboratorien ganze Fabriken. So sprach man z.B. von Iwan Pawlows „Physiologie-Fabrik“, in der über 100 Leute beschäftigt waren. Sie stellten laut dem Medizinhistoriker Daniel Todes „eine großen Anzahl unterschiedlicher Produkte“ her: „Berichte, Dissertationen, Techniken und Hunde-Technologien, reine Verdauungssäfte und ehemalige Schüler“.
Im „Posthistoire“ haben wir jetzt alles durcheinander: in leerstehenden Fabriken befinden sich „Künstlerateliers“ (mit Oberlicht und Ölfarbengeruch) und Medienkollektive nennen ihre Arbeitsräume „Werkstätten“ oder sogar „Labore“ (für „datenverarbeitende Visionen“ z.B.). Wenn irgendwo noch ein kalter Schornstein aufragt, kann man sicher sein, in seinem Umkreis auf heiße „Denkfabriken“ mit anglokreativen Namen zu stoßen. Solche und ähnliche „Laboratorien“ gehen unter Umständen fließend in „Firmen“ über. In den USA haben bereits über 80% aller Biologen/Genetiker Anteile an einer Firma oder besitzen eine solche – zur Vermarktung ihrer Produkte/Patente. Das Spektrum umfaßt kleine „Garagenfirmen“ bis zu aufgeblasenen Aktiengesellschaften in teurem Öko-Ambiente. Selbst die „Salons“ sind – wenigstens hierzulande – alle kommerziell. Daneben gibt es immer mehr „Lofts“: Wer ein „Loft“ sein eigen nennt, für den fällt „Leben und Arbeiten“ ineins. So einer spricht dann von einem guten „Projekt“. Auf Wikipedia heißt es: „Ein Loft ist ein zur Wohnung umfunktionierter Lager- oder Industrieraum.“ Ironischerweise werden immer mehr „Lofts“ in Neubauten verkauft. Gleichzeitig haben aber auch die (wissenschaftlichen) Labore die alten Gebäude verlassen: Ihre Experimente beziehen nun laut Bruno Latour unseren gesamten Lebensraum mit ein, d.h. wir sind alle Versuchspersonen geworden – wenn es z.B. um pflanzengenetische Freilandversuche, um Atomtests oder um eine gentechnisch veränderte „Designer-Mücke“ geht, mit der man flächendeckend dem Malariaerreger beikommen will: „Die Molekularbiologen wissen genau, was sie tun,“ meinte dazu der Malaria-Experten des Hamburger Tropeninstituts. Das Experiment wird von Bill Gates und Monsanto finanziert. Was ebenfalls nicht geeignet ist, diesem Globalprojekt zu vertrauen.
Bunte Hummer und große Welse, abwandernde Makrelen und winzige Krebse
Man spricht bereits von „Riesenwelsen“: „In den heimischen Gewässern sind Zwei-Meter-Exemplare keine Seltenheit mehr.“ Inzwischen haben die „Riesenwelse den Rhein erobert“. Biologen sprechen von der größten Veränderung der Wasserfauna seit der Eiszeit und rätseln über den Grund dafür, berichtet der Spiegel. Beobachter sind entsetzt über die großen Raubfische, weil sie nicht nur alle anderen Fische fressen, sondern auch schon Wasservögel und größere Nagetiere. In Bayern schreckte ein Zwei-einhalb-Meter-Wels – „Killer-Waller“ dort genannt – nicht einmal vor unseren größten flugfähigen Vögel – den Schwänen – zurück. In einem niederösterreichischen Badesse zog ein solcher Riesenwels sogar eine 14jährige unter Wasser. Im Berliner Schlachtensee wurde eine Schwimmerin schmerzhaft gebissen, anschließend zog ein Angler einen 2 Meter 60 langen „Monsterwels“ aus dem See. Das unheimliche, geradezu plötzliche Wachstum des schuppenlosen Schlammfisches „Europäischer Wels“ – um 100% geschieht zusammen mit anderen gravierenden Veränderungen in der Unterwasser-Fauna, von denen einige hier genannt seien:
1. Die Hummer vor der Ostküste der USA vermehren sich wie noch nie und werden immer bunter. Als Ursache wird ebenso wie bei den Hummern die Erwärmung des Wassers vermutet. Die dortigen Hummerfischer sind über ihre zunehmend üppigeren Hummerernten nicht froh, denn das Überangebot macht mehr Arbeit, gleichzeitig verdienen sie jedoch immer weniger, weil die Hummerpreise sinken. Die einstige Armen- und Gefängnis-Kost Hummer ist drauf und dran, wieder zu einer solchen zu werden. Jüngst kam es zu einem Streit zwischen kanadischen und amerikanischen Hummerfischern, weil diese ihre Tiere in Kanada zu Dumpingpreisen verkauften. Daneben müssen sie sich auch noch gegen den wachsenden Einfluß der Tierschützer wehren, die das Zubereiten des Großkrebses – z.B. auf der weltgrößten Hummerparty in Maine – als barbarisch kritisieren: Die Tiere werden dort lebend in riesige Behälter mit kochendem Wasser geworfen. Das rohe Massenvergnügen in der Hummerhauptstadt wurde vom Schriftsteller David Foster Wallace ausgerechnet in einer Gourmet-Zeitschrift kritisiert (sein Text heißt auf Deutsch: „Am Beispiel des Hummers“).
2. Die Makrelen wandern neuerdings immer weiter nordwärts – bis nach Island. Dort in der 200 Seemeilen-Fischfangzone werden die Schwärme von isländischen Fischern gefangen, die nun laufend ihre Fangquoten erhöhen. Die Fischer in der EU möchten den Makrelenschwärmen nachfolgen, aber die isländischen Kollegen sind schneller. Die EU droht Island und den Färöer-Inseln in dem Streit nun mit Sanktionen. Der Klimawandel habe das Verbreitungsgebiet der Tiere verändert, verteidigt sich und seine Fischer Islands Fischereiminister Steingrímur Sigfússon: „Große Mengen von Makrelen fallen in unsere Gewässer ein. Das sind gierige Tiere, die auch anderen Arten Futter wegnahmen. Island hat Anspruch auf einen gerechten Anteil von dieser wandernden Art. Das kann niemand bestreiten.“
3. Beim Abwandern eines anderen küstennahen Meerbewohners sorgen sich vor allem die Vogelfreunde: Bei den Sandaalen an der irischen, schottischen und norwegischen Küste, weil sie zur Hauptnahrung der dort brütenden Papageientaucher zählen. Der Biologe Cord Riechelmann fand an der Nordspitze Irlands heraus, dass die dortige Papageientaucher-Kolonie auf der Suche nach neuen Lebensräumen ist. Auf deren Brutfelsen beobachtete er, dass die Papageientaucher kaum noch Jungen großziehen konnten, weil es kaum noch Sandaale in ihren Revieren gibt. Diese seien wegen der Klimaerwärmung in kältere Meereszonen abgewandert. 4. Im Mittelmeer gibt es sogenannte Steckmuscheln, sie leben mit einem winzigen Krebs zusammen der Steckmuschelwächter heißt und sich in ihrem Inneren angesiedelt hat. Er hat Augen und wenn er sieht, dass Eßbares zwischen die Schalen der Muschel geraten ist, zwickt er sie, die sich daraufhin schließt und beide machen sich dann über die Nahrung her.
Schon Aristoteles und nach ihm Plutarch und Cicero haben sich mit dieser zu ihrer Zeit gerühmten Symbiose zwischen der Steckmuschel und dem Steckmuschelwächter beschäftigt. Ihr Interesse war jedoch auch ökonomisch miotiviert, denn die Steckmuschel hält sich mit sogenannten Byssusfäden am Boden fest. Diese Fäden hat man damals zu einer sehr edlen (und teuren) Seide für Kleidungsstücke verarbeitet. In zwei italienischen Hafenstädten werden die Byssusfäden der Steckmuschel heute noch verarbeitet. Unlängst wurde auch ihr Symbiont, der Steckmuschel-Wächter, zu einem ökonomischen Problem: Mitarbeiter der Schutzstation Wattenmeer fanden ihn vor Sylt im Inneren einer Miesmuschel. Sie vermuteten, dass die Ursache seines Vordringens in den Norden entweder eine Folge der Meereserwärmung ist oder der Einfuhr von Miesmuscheln aus England, wo er früher jedoch auch so gut wie gar nicht vorkam. Muscheln aus Großbritannien werden trotz Protesten der Naturschützer seit 2006 im Wattenmeer ausgebracht. Und bei Sylt befinden sich Schleswig-Holsteins größte Zuchtflächen für Miesmuscheln.
Die Miesmuschelfischer befürchten wegen der Muschelwächter-Fundes bereits eine Verunreinigung ihrer Muschelbänke – und damit Absatzprobleme, denn es sei wenig verkaufsfördernd, wenn Krebse in der Muschel hausten und mitgekocht werden. So könnte dieser tatsächlich zum Wächter der Muscheln werden: Er entwerte sie für die Vermarktung, erklärte der Biologe Rainer Borcherding von der Sylter Schutzstation. Das sei eine „Öko-Lüge“, erwiderte der Geschäftsführer der Firma Royal-Frysk: „Unsere Importe werden von der Fischereiabteilung des Amtes für Ländliche Räume überwacht.“ Den Muschelwächter gebe es überdies bereits seit 25 Jahren im Watt vor der Westküste, sagte er. In dem vielgelobten Buch „Der innere Sinn. Archäologie eines Gefühls“ des US-Literaturwissenschaftlers Daniel Heller-Roazen findet man ebenfalls eine Geschichte der mittelmeerischen Steckmuschel-Muschelwärter-Beziehung. Der Autor beruft sich dabei auf den schottischen Biologen D’Arcy Thompson.
Für diesen bestand deren Symbiose darin, dass der kleine Krebs der Muschel als „Türwächter“ dient – sie also eher beschützt als mit ihr zusammen Nahrung einfängt. Thompson konnte sich dabei auf Cicero und Plutarch berufen, für die der „Wärter“ nicht innerhalb, sondern außerhalb der Muschel angesiedelt ist, d.h. „vor dem Tor der Muschel sitzt und sie bewacht,“ wie Cicero schrieb. Während Plutarch auf ihre Jagdkooperation abhob: Gemeinsam „packen und fressen sie, was ihnen in die Falle gegangen ist.“ Beiden Autoren geht es um eine erfolgreiche „Zusammenarbeit“ am Beispiel von Krebs und Muschel: Dabei muß man sich laut Cicero „verwundert fragen, ob sie durch eine Übereinkunft oder schon seit ihrem Entstehen von der Natur selbst aus zu dieser Verbindung gekommen sind.“ Für die Stoiker war das ein Problem, weil sie davon ausgingen, dass allein der Mensch über „Rationalität“ verfüge, was ihn von anderen Tieren scharf unterscheide. Den einen wie den anderen eigne jedoch so etwas wie „Selbsterhaltung“ bzw. „Selbstbefreundung“ – denn sie hätten ein „Bewußtsein ihrer angeborenen Verfassung“. Das Kind, so erläutert Seneca, wisse zwar nicht, was körperliche Verfassung sei, aber es kenne die seine. Heller-Roazen fügt hinzu: Seneca „zeigt auch keine Scheu, für alle Tiere zu sprechen, wenn er von sich selbst spricht.“ Für die Stoiker gehe es dabei um das „Eigenste in jedem“ – seine „Verfassung“.
Der US-Autor kommt abschließend von dieser wieder zurück auf die beispielhafte Muschel-Wächter-Beziehung – jedoch um den Preis ihrer gänzlichen Metaphorisierung: „Jene ‚Verfassung‘ ist das in jedem Tier, was nicht das Tier selbst ist und, insofern sie es nicht ist, ihm ‚von Anbeginn an‘ erlaubt, zu werden. Als Wärter in ständiger Bewegung zwischen dem Außen und Innen der beweglichen Schale des Selbst ist sie dieser kleine Krebs, der die Muschel bewacht und sie von Zeit zu Zeit vorsichtig zwickt, um sie darauf aufmerksam zu machen, das da Nahrung ist.“
Der Schriftsteller Rudolf Kleinpaul blieb dagegen in seinem 1893 veröffentlichten Werk „Das Leben der Sprache und ihre Weltausstellung“ skeptisch: „Die Alten glaubten, diesmal aber irrigerweise, an ein Freundschaftsbündnis zwischen Krebs und Muschel. Die Steckmuschel sollte in ihrer Mantelhöhle einen rundlichen Krebs beherbergen, den sie Wächter, nannten.“ Ähnlich heißt es in „Meyers Konversationslexikon“: „Im Altertum sprach man von dem sogen. Muschelwächter, einem Krebs, der seinen Wirt vor Gefahren warnt, dafür aber in ihr wohnen sollte. Letzteres ist richtig, ersteres grundlos.“ Das Internet-Lexikon „arcor.de“ spricht von einer „Parabiose“ (statt von einer Symbiose) zwischen einer Miesmuschel (nicht Steckmuschel!) und dem Krebs: „Der Muschelwächter lebt in der Mantelhöhle einer Miesmuschel, wo er fast sein ganzes Leben verbringt. Er hat nur einen weichen Panzer und ist in der Muschel vor Feinden geschützt. Lediglich zur Paarungszeit verlässt der Muschelwächter die Miesmuschel, da er nur zu dieser Zeit einen festen Panzer besitzt. Er profitiert als Mitesser vom Nahrungs- und Atemstrom der Miesmuschel.“ Im Lexikon „wissen.de“ heißt es dagegen über den Muschelwächter – quasi definitiv: „bis 1,8 cm breite Krabbe aus der Gruppe der Pinnoteridae; lebt frei im Mantelraum verschiedener Muscheln. Zur Paarung verlassen die Tiere ihre Muschel. Danach sterben die Männchen, während die Weibchen wiederum eine Muschel aufsuchen.“
Die Art der Krebs-Muschel-Beziehung bleibt dabei unerörtert, auch, ob der mittelmeerische Muschelwächter wegen der Klimaerwärmung nach Norden zu den Miesmuscheln gewandert ist. Für das unheimliche Wachstum des europäischen Wels haben die Fischforscher und Fischer mehrere Erklärungen: Neben der Klimaerwärmung könnten auch die vielen Rückstände von Medikamenten, u.a. Östrogen, das Wachstum der Raubfische anregen. Eine andere These ist, dass die langsam von Industrieabfällen und Agrarrückständen gesäuberten Gewässer dem Fischbesatz zugute kommt und damit auch ihrem Freßfeind. Genetiker sprechen dagegen von einer spontanen „Mutation“, Mikrobiologen von einem Magen-Darm-Parasiten, der die Verdauung beim Wels anregt, was wiederum zur Nahrungsaufnahme anregt, die schließlich sein Wachstum beschleunigt: „Das geht aber nicht lange gut!“.
Die Eso-Szene vermutet eher Einflüsse des Mondes und der Sonnenprotuberanzen, die seit einigen Jahren zunehmen. Einige Kreuzberger Angler geben dagegen zu bedenken: Im Mekong ist aus industriellen Gründen, wegen Dammbauten, gerade der dort heimische „Riesenwels“ am Aussterben, dafür haben wir ihn jetzt hier…“So what!“ Die vietnamesischen Fischhändler in ihrer Lichtenberger Großmarkthalle versprechen bereits, sich darauf einzustellen. Zwei Mitarbeiter des „Instituts für Küstenforschung“ am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht, der Klimaforscher Hans von Storch und der Ethnologe Werner Krauß, haben gerade ein Buch mit dem Titel „Die Klimafalle“ veröffentlicht, darin geht es darum, dass „die Klimaforschung von der Politik gekidnappt wurde, um ihre Entscheidungen als von der Wissenschaft vorgegeben und als alternativlos verkaufen zu können.“ Etwas anders verhält es sich mit den oben erwähnten Veränderungen bei der Unterwasser-Fauna, so weit es die Fisch-, Krebs- und Muschel-Bestände betrifft, die von den immer industrieller ausgerüsteten Fischern ausgebeutet werden: Hierbei liefert der „Klimawandel“ ihnen eine billige Erklärung für Probleme, denen sie machtlos vis à vis stehen, so dass sie nichts ändern müssen.
Fische verstehen
Eine vornehme Adresse: Unter den Linden, man muß klingeln, um in die Berliner Galerie der Schering-Stiftung zu kommen. Sie dient, sagt sie, „der Förderung von Wissenschaft und Kultur mit Fokus auf den Naturwissenschaften…“
Der Raum für die Ausstellung ist abgedunkelt, an den Wänden leuchten kleine und große Bildschirme und eine Doppelprojektion. In der Mitte steht ein Stahlgerüst für die Projektoren und Kabel. Eine Kunsthistorikerin erklärt einer Lehrerin das „Projekt“, derweil einige Schüler Schattenspiele vor der Projektionsleinwand veranstalten. Die beiden Frauen gehen von Bildschirm zu Bildschirm, es sieht aus, als würde eine Aquariumsführerin von Becken zu Becken gehen, um einer interessierten Besucherin deren „Inhalt“ zu erklären.
Hier besteht der „Inhalt“ jedoch aus postmoderner Kunst – bei der man wenig sieht, die aber viel Wissen, u.U. jedoch bloß in Form von Technik, enthält.
Das Projekt – des Zürcher Medienkünstlers Hannes Rickli – heißt „Fischen lauschen“. Dies tat auch erfolgreich der Erforscher der „Fischsprache“ Karl-Heinz Tschiesche, langjähriger Leiter des Aquariums im Deutschen Meeresmuseum von Stralsund. Er hängte dazu Nachts Mikrophone in die Becken. Sein Bericht darüber heißt: „Seepferdchen, Kugelfisch und Krake“. Es ist ein schönes kleines Werk, was man von Ricklis großer „Mehrkanal Audio-Videoinstallation“ leider nicht sagen kann. Die Technik hat sich hier gewissermaßen an die Stelle des „Inhalts“ gesetzt, der Künstler als „Content-Manager“ spricht dann auch nur von „Daten“, die „übertragen“ werden. Und zwar von Spitzbergen aus, genauer gesagt: von der nach dem Polarforscher Koldewey benannten Station im Ny Alesund. Dieser „verhaltensbiologische Forschungsstützpunkt“ ist eine Außenstelle der „Biologischen Anstalt Helgoland“, die ihrerseits ein Vorposten des Bremerhavener „Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in der Helmholtz-Gemeinschaft“ ist.
So wie der Schweizer Künstler Rickli eine „künstlerische Begleitforschung zur Entwicklung ästhetischer Strategien“ auf der Spitzbergen-Station durchführte, wird derzeit das Institut auf Helgoland von einem Schweizer Wissenschaftsforscher gewissermaßen heimgesucht. Dieser, Christoph Hoffmann, erklärte kürzlich in der Neuen Zürcher Zeitung, was ihn an der dortigen Fischforschung interessiert: „Schön ist an diesem Projekt, dass es drei Ebenen eröffnet. Die Fisch-Ökologen dort untersuchen, ob und wie Fische akustisch kommunizieren. Das Interessante für mich ist zum einen das Geisteswissenschaftliche, wo der Begriff der Kommunikation im Zentrum steht. Wenn Menschen kommunizieren, erkennt man das leicht. Bei Fischen von Kommunikation zu sprechen, verlangt zum andern aber nach neuen Kriterien. Diese müssen also zuerst definiert werden. Als Wissenschaftsforscher interessiert uns, wie diese entwickelt werden. Wir lernen dabei auch etwas über unsere eigenen Vorstellungen. Forschung an Tieren liefert oftmals den Anlass für Aussagen, was Menschen ausmacht. Auf einer weiteren Ebene spielt das Tier eine Rolle, das trotz eigenem Rhythmus mitspielen muss. Das Ziel des Forschungsprojekts muss also mit dem Leben des Tieres zusammengebracht werden. In den Forschungsperioden wird, damit man nicht in das Leben der Tiere eingreift, während sieben Tagen einfach das ganze akustische und optische Geschehen aufgezeichnet. Wir haben also riesige Datenmengen. Als dritte Ebene interessiert mich der Umgang mit dieser Datenflut.“ Zu diesem Zweck rückt der Wissenssoziologe Hoffmann mit seiner Schweizer Arbeitsgruppe nun laufend bei den Fischforschern auf Helgoland an, wahrscheinlich ebenfalls mit Kamera und Mikrophon.
Auf Spitzbergen geht es der Helgoländer Arbeitsgruppe unter der Leitung des Fischökologen Philipp Fischer allerdings nicht um die akustischen Lebensäußerungen der arktischen Meerestiere, sondern um die Erforschung ihrer „Habitate und Migrationen“. Um dafür die notwendigen „konstanten Meßreihen zu erhalten, wurde vor der Küste die Unterwasserstation ‚RemOs‘ installiert, die mit Meßsonden und Kameras bestückt aktuelle Daten wie Stereometriebilder, Temperatur, Trübheit oder Salzgehalt des Wassers ans Festland sendet. Über Remote und Datenstreaming kann aus großer Distanz auf diese Daten zugegriffen werden.“
Der Künstler Rickli hat sie für seine „Schau“ in der Galerie der Schering-Stiftung „archiviert“. Daneben hatte er aber auch noch vor der Küste von Spitzbergen „sechs akustische Sensoren neben die Sonden“ der Fischforscher unter Wasser installiert. Davon kann man sich nun mit einem Kopfhörer überzeugen. Die Ausstellungsführerin erklärt der Lehrerin, was man hört: „Und manchmal das Geräusch einer Schiffsschraube…“ Ich erwarte mindestens Geräusche von einem Knurrhahn, der ja, wie der Name schon sagt…Stattdessen höre ich Eisen klirren – leise im Rythmus von Wellen, wie ein Blick auf einen der Bildschirme vermuten läßt. Wahrscheinlich sind das die Trossen, an denen die Sonden hängen – und Ricklis Mikrophone. Auf den anderen Bildschirmen erkenne ich eine Bucht mit einer kleinen Siedlung – einmal nachts hell erleuchtet, und einmal an einem grauen Tag. Im Sekundenrythmus baut sich jeweils ein neues Bild auf – und eine weitere Welle umspült einen merkwürdig geröteten runden Felsbrocken am Strand.
Spitzbergen hat reiche Kohlevorkommen und gilt seit einiger Zeit als „größtes Labor der Welt“ für die Arktisforschung. Zudem war oder ist es noch Zentrum des dritten „Kabeljaukriegs“ der Isländer, die die 200-Meilenzone der Norweger um Spitzbergen nicht akzeptieren. Da müßte es eigentlich genug Stimmen zum „Fischen lauschen“ geben. Dem ist jedoch nicht so. Aber kann man das Rickli vorwerfen? – Der die „akustische Kommunikation“ ja bloß als „Daten vielspurig synchron ausspielt und damit eine vielschichtige Gleichzeitigkeit einer tausend Kilometer entfernten Forschungsrealität in den Raum der Schering Stiftung Berlin transportiert,“ wie es im Beiblatt seiner Ausstellung heißt…Der Projektemacher ist zuerst und zuletzt ein Rhetoriker.
Dem Künstler zur Seite stehen am 1. und 2. März mehrere Wissenschaftler – im „Einstein-Saal“ der Berlin-Brandenburgischen Akademie: U.a. der pensionierte Leiter des Berliner Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte Hans-Jörg Rheinberger – Übersetzer von Derrida und Lacan, der erst kürzlich bedauerte, dass er während seiner zehnjährigen Tätigkeit in einem gentechnischen Labor sich nicht ein einziges Mal seinen „Modellorganismus Bakterie“ unter dem Mikroskop angeschaut hat. Er spricht passenderweise zum Thema: „Fragile Daten“. Ihm folgen am darauffolgenden Tag der Leiter der Helgländer Station auf Spitzbergen Philipp Fischer und der wissenssoziologische Erforscher der Biologischen Anstalt Helgoland Christoph Hoffmann. Beide sprechen zum Thema: „Mit Daten umgehen“.
Mir deucht, dass die Künstler, die in Berlin nach der Wende zunächst den Bauherren der neuen Hauptstadt auf die Pelle gerückt waren (woraus das entstand, was man dann „Baustellenkunst“ nannte), nun den Naturwissenschaftlern mit ihren „Projekten“ kommen. Die Biologie ist zur neuen Leitwissenschaft geworden, und dort konkurriert man nun darwinistisch gesonnen um die „knappe Ressource Aufmerksamkeit“ (und z.B. Pharmagelder). Aber auch in den Kulturwissenschaften spricht man bereits von einem „animal turn“. In dieser Hinsicht gab die Ausstellung wie gesagt so gut wie nichts her. Es war eher eine gediegene Inspirationsquelle für die Mediamarkt-Kunden vom Alexanderplatz.
Ebenfalls seltsam ist die Verwendung einiger Pilone, die zwar nicht der Verkehrsaufklärung, aber der vorübergehenden Verkehrslenkung dienen:

Von Christoph Ludszuweit via Facebook/Südafrika

US-Zubehör

Von Christoph Ludszuweit/s.o.

Quelle des Photos unbekannt, ebenso, was der Maler sich dabei gedacht hat.

Von Peter Loyd Grosse

Immer-dabei-Pilon1. Photo: Peter Loyd Grosse

Immer-dabei-Pilon2. Photo: Peter Loyd Grosse

Ein Hauch von Revolution
Die Rosa-Luxemburg-Demonstration soll alle Jahre wieder so etwas wie eine linke Heerschau sein. Aber die eher staatsmarxistisch orientierten Ostler und die basisdemokratisch inspirierten Westler sind noch nicht unter einen Hut zu kriegen.
Die taz ist – zusammen mit der von Sartre gegründeten Libération – ein Projekt der „Spontiscene“, zu der ich mich damals wie heute zähle, obwohl sie nicht mehr so heißt und keine „Scene“ mehr ist. Das gilt grob auch für die anderen damaligen linken Gruppen, ob leninistisch, trotzkistisch oder maoistisch ausgerichtet. 1978 hatten sie noch ihre eigenen Theorieorgane und Zeitungen. Eine, der Arbeiterkampf (ak), heißt inzwischen Analyse & Kritik. Bis heute erhalten haben sich auch die anarchistischen Periodika graswurzelrevolution und Direkte Aktion (DA) sowie das immer noch „illegale“ Berliner Autonomenblatt Interim.
Das Projekt tageszeitung setzte von Anfang an auf eine Art antikoloniales „Patchwork der Minderheiten“ (Lyotard). Die Stoßrichtung aller sozialen Bewegungen, deren Teil man war, zielte auf eine grundumstürzende Veränderung der warenproduzierenden Gesellschaft: Theoretisch bis zur Kritik an der Zeitlosigkeit des naturwissenschaftlichen und mathematischen Wahrheitsbegriffs, praktisch bis zur Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit.
Wolfgang Müller, Autor des gerade erschienenen Readers „Subkultur Westberlin 1979-1989“, sprach zu Haus- und Instandbesetzerzeiten von den „Genialen Dilletanten“. Im „Fischbüro“, aus dessen Keller 1989 die Love-Parade kroch, wurde der Forschungsbegriff entsprechend ausgedehnt. Ein typischer Dialog am Tresen dort ging so: „Machen wir noch eine Bierforschung oder eine Nachhausegehforschung?“ „Ich muss erst mal eine Dönerforschung machen.“
Die aus der Spontibewegung hervorgegangenen Realogrünen stimmen inzwischen in so ziemlich allen Parlamenten mit. Aber dies ist zugleich mit einer Abkehr von radikaler Gesellschaftskritik und allem, wofür sie früher standen, verbunden. Erfolg versprechen fürderhin vor allem Single Issue Movements. Inzwischen spricht man wie selbstverständlich von NGOs. Jean Baudrillard beobachtete bei den Linken nach 1989 einen allgemeinen Shift weg von den „harten Ideologien“ (Klassenkampf, Diktatur des Proletariats) hin zu den „weichen“ (Menschenrechte, Ökologie): „Sie finden gleichzeitig den Weg zur poetischen Pose des Herzens und zum Geschäft.“ Und Daniel Cohn-Bendit erklärte auf dem taz-Kongress 2012: „Soziale Bewegungen sind notwendig. Aber sie kommen und gehen. Deswegen braucht es eine Partei wie die Grünen, um deren Forderungen durchzusetzen.“
Die Links- und die Piratenpartei sehen ihren Wählerauftrag ähnlich. So verhandelte die Kreuzberger PDS einmal mit der autonomen Spaßpartei KPD/RZ. Die Berliner Piraten beauftragten jüngst einen Mitarbeiter sozusagen vollamtlich, sich der Mieterbewegung – „Kotti & Co“, „Anti-GSW“, etc. – anzunehmen. Die vielen Kneipen- und Buchladenkollektive und nicht wenige Galerien machen hingegen nur noch sporadisch aus linken Themen einen „Diskussionsabend“ – wenn diese ein gewisses Erregungspotenzial offenbaren.
In einer Medien- und Informationsgesellschaft, in der die Softwareentwicklung eine immer größere Wertschöpfungstiefe erreicht und die Überwachungsdienste mit Nerds vom Chaos Computer Club um die besseren Algorithmen wetteifern, sollte man die Öffentlichkeit aber sowieso nicht mehr suchen, sondern sie eher meiden, um etwas „Soziales“ zu entwickeln. Das scheint etwa die Neuköllner Lunte-Truppe, aber auch die Jour Fixe Initiative und die Freunde der klassenlosen Gesellschaft so zu halten, die höchstens einmal im Jahr eine öffentliche Diskussion anzetteln.
Diese werden ergänzt durch die Event-Maschinen der staatlichen Kunst- und Kultureinrichtungen – die auch fast alle den erwähnten „weichen Ideologien“ anheim gefallen sind. Im übrigen enthusiasmierten 2011 die Aufstände der gebildeten Jugend und der Frauen in den arabischen Ländern auch die hiesigen Arabistik-Studenten und -Dozenten – bis hin zu den Palästinenserfreunden. Was schon bald eine ganze Reihe von Diskussionen und Soli-Initiativen „generierte“, wie man heute gerne sagt.
Gleichzeitig ergriff – jedenfalls in Berlin – ein gesunder Hang zum „Reduktionismus“ in der Lebensführung, ein Kümmern um sich selbst, die kritischen „Massen“. Einhergehend damit waren immer mehr Linke sich nicht mehr sicher, ob die warenproduzierende Gesellschaft und ihre „Realabstraktionen“ überhaupt umgestülpt gehören. An die Stelle einer politökonomischen trat die ökologische Utopie. Sie personifiziert sich etwa in den 7 Millionen deutschen Vegetariern. Das geht so weit, dass sich im Haus der Demokratie in Prenzlauer Berg „Nichtraucherverbände“ einquartierten.
In Summa: Es wimmelt weltweit von kleinen und größeren Protest- und Reformbewegungen. Im Osten geht es dabei eher um die Essenz, im Westen um die Existenz. Ähnliches gilt für die anschwellende Theorieproduktion, die nicht selten nur dem Autor weiter hilft. Aber sie hilft!
Da drunter breitet sich ein diffuses Gefühl aus, dass es nicht mehr lange so weiter gehen kann. Man erkundigt sich schon mal, wie Kartoffeln angebaut werden. Eine Gruppe junger Linker aus Indonesien kam bei ihrer teilnehmenden Beobachtung der vorletzten 1.-Mai-Krawalle in Kreuzberg, die sie bis dahin bloß aus CNN-Berichten kannte, zu dem Schluss: „Das ist ja alles nur Spiel. Selbst die Hubschrauber…“
Infrastruktur und Infratest
„Die Berliner Infrastruktur geht den Bach runter. Der neue Flughafen? Ein Desaster. Die S-Bahn? Nur teilweise einsatzfähig. Der Bahnhof Friedrichsstraße? Zerfällt ein seine Bestandteile. Und nun auch noch ein Rohrbruch am Nollendorfplatz. Das Wasser floss am Donnerstag in einem wildem Strom die Treppen herunter und flutete den Bahnhof,“ schrieb eine Kollegin verzagt.
Es stimmt, eine Infrastruktur, die privatisiert wird, ist keine Infrastruktur mehr. Das kann man an der englischen Eisenbahn im Detail studieren. Hier bekommt das Wort „Spree-Athen“ dadurch eine ganz neue Bedeutung.
Man kann aber auch eine gegenteilige Wahrnehmung der Stadt haben. Im Detail z.B. die dunkle, gefährlich wirkende Reichenberger Straße in Kreuzberg, wo selbst die Spätkauf- und Internetläden stets leer waren. Aber plötzlich tut sich da was: Immer mehr Kneipenkollektive eröffnen Sperrmüll-Cafés in den leerstehenden Läden, sie schmücken den Bürgersteig mit bunten Lämpchen. Hier ist „Nordneukölln“ quasi übergeschwappt. Richtig rübergeholfen wird der zuletzt in den Achtzigerjahren von Intarsienkünstlern aufgehübschten Kiez-Allee aber vom Kapital. Nicht nur, dass die Häuser laufend den Besitzer wechseln, es werden auch kühne Projekte dort platziert, in die graue Misere des Sozialmieter-Milieus sozusagen reingerammt – mit Markanz und Flair. Völlig irre war schon der Bau eines Hauses, in dem die Wohnungsbesitzer ihr Auto mit nach oben nehmen können: das sogenannte „Carlofts“-Haus, das dann auch laufend von Gentrifizierungsgegnern attackiert wurde, so dass es seit 2001 von Wachmännern geschützt wird, die in einem Container auf dem Bürgersteig davor hausen. Die Firma CarLoft® GmbH, die zwei Architekten gehört, hat sich die Idee der „Carlofts“ in 39 Ländern patentieren lassen. Zu diesem Wahnsinn, der Herbert Grönemeyer schließlich davon abhielt, sich dort einzukaufen, kommt nun aber noch ein Ladengeschäft im selben Haus hinzu, das es wirklich in sich hat: „Mary’s Nap“. Dort werden Luxus-Hundeartikel verkauft – in der Reichenberger Straße, wo derweil die letzten Kampfhunde friedlich wegsterben. Das muß man sich mal vorstellen. Als Renner in „Mary’s Nap“ erwiesen sich die Tragetaschen für Kleinhunde wie Chihuahuas und Dackel. Die Ladenbesitzerin „Mary“ schreibt über sich – auf ihrer Internetseite: „Als Mops bin ich immer glücklich, das ist mein Naturell.“ Neben „Mary’s Nap“ macht jetzt noch ein „Konzept-Laden“ auf.
Des weiteren sei der Öko-Supermarkt der Firmengruppe „LPG“ erwähnt, der in der Reichenbergerstraße immer noch wie ein dort versehentlich notgelandetes UFO aussieht – einschließlich seiner Kunden. Schräg gegenüber vom „Carlofts“ steht im übrigen noch so ein toskanafarbenes neues Wohnhaus für den gehobenen Geschmack, einschließlich eines gediegenen vegetarischen Restaurants und eines gepflegten Pärkchens drumherum. Noch abgefahrener und hochgestochener war die „Molekularküche“ am anderen Ende der Reichenbergerstraße: am Oranienplatz, in dem mit Kamelhaarpinseln renovierten Max-Taut-Haus, wo zunächst Wim Wenders oben eingezogen war. Nach mehreren Einbrüchen verließ er den „Problembezirk“ jedoch wieder. Die „Molekularküche“, wird auch „Metaphoric Cuisine“ vom Inhaber Cristiano Rienzer genannt. Wie alles Gute und Teure hat auch diese Kochkunst, die am Oranienplatz in Workshops gelehrt wird, eine „Philosophie“. Darin heißt es: „Alle Lebensmittel bekommen dieselbe Wertschätzung. Die salzige und die süße Welt bilden eine Symbiose.“ Das muß dem Besitzer des Dönerimbiß gegenüber keine Ruhe gelassen haben, denn seit einiger Zeit wird dort teures Fastfood von Bio-Rindern verkauft. Zu Rienzers metaphorischer Küche gehörte ein „Taller Store“, in dem man gleich im Anschluß an seine Workshops die Geräte und Zutaten kaufen konnte, um seine Gerichte zu Hause nachzumachen. Irgendwann blieb nur noch dieser „Store“ übrig, und jetzt ist dort glaube ich ein Spätkauf eingezogen. Dafür hat gleich um die Ecke im selben (Taut-) Haus ein Geschäft für Outdoor-Moden aufgemacht – das „360 Grad“. Der „Outdoorexperte“ Matthias Bischoff setzt darin auf die gehobene Survival-Klientel – und bietet vor allem skandinavische Edelmarken wie Fjällräven und Helsport an. Zwischen seinem Laden und dem Molekular-Späti hat das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) zusammen mit der Lüneburger Universität (Leuphana) eine „Denkerei“ eröffnet, nachdem ein Restaurant der gehobenen Preisklasse in den weitläufigen Räumen ökonomisch gescheitert war.
Der „Ideator“ vor Ort Bazon Brock will sich in den Räumen laut denkend „an unlösbare Probleme und Maßnahmen der hohen Hand“ heranwagen. Zuletzt dachte der Wuppertaler Ästhetikprofessor dort Evolution und Mathematik bis hin zur Quantenphysik zusammen: „Der Urknall war physikalisch-chemisch – naturgesetzlich. Erst die Bakterien gehen raus aus Physik und Mathematik – sie emanzipieren sich quasi von den Naturgesetzen. Der Mensch geht dann aber wieder rein – und weitet sie aus: auf eine künstliche Natur. Das beginnt mit Pythagoras…Und endet mit: 1 Punkt – 1 Pixel. Aber mit der Quantenphysik ändert sich wieder alles.“ Auch die Reichenberger: „the street is a perfect example of a city still in flux and the Kiez is alright,“ schreiben Sarah und George auf ihrer Weppage „be-my-guest“.
Die Journalistin Jeanette Tust stößt unterwegs gelegentlich auf Poller-Ensemble. Die folgenden drei Photos stammen von einem absurden Touristentreffpunkt in Kreuzberg auf einer Brücke über den Landwehrkanal:

Brückenpoller

Ein Mensch auf Brückenpoller

Zwei Menschen auf Brückenpoller

Unter-der-Brücke-Poller. Photo: Peter Loyd Grosse
Wenn die Welt im Lokalen aufschlägt
Zwar macht einen das Überangebot an Ausgeh-Möglichkeiten und Hingeh-Veranstaltungen in Berlin seit der Hauptstadtwerdung mitunter schlecht gelaunt, auch weil selbst viele der einst eher abseitigen Locations inzwischen von Touristen überrannt werden, dennoch ist das allabendliche Nosing-Around in den „Problembezirken“ und „-Kneipen“ für einen soziologischen Feldforscher und Lokaljournalisten noch die bequemste Methode der Wahrheitsfindung. Selbst Arbeitslose, die an Biertheken abhängen, kommen dort erwiesenermaßen schneller auf gute Ideen, als wenn sie sich schon morgens vorn Fernseher hocken.
Vor 89 zog es mich oft ins Kreuzberger Fischbüro: eine ehemalige Schusterei, in der es weder Publikum noch Performer gab – dennoch ein Programm. So erzählte der Künstler Kaethe B. dort einmal am Rednerpult, warum er welchen Namen in sein Adressbuch eintrug, und Sabine Vogel rekapitulierte die Herkunftsgeschichte ihrer Second- und Third-Hand-Klamotten, die sie gerade trug.
Aus dem Fischbüro-Übungskeller kroch in der Wende die Love-Parade ans Tageslicht – und das „Büro“ verwaiste. Seit 2011 gibt es stattdessen im Osten die Kulturspelunke Rumbalotte, in der, anders als bei den ganzen neuen Lesebühnen, Publikum und Performer ebenfalls nahezu identisch sind.
Als teilnehmender Beobachter hat man keine „Stammkneipe“, man bemüht sich vielmehr, irgendwann eine Karte des Großraums Berlin im Maßstab 1:1 im Kopf zu haben. Also alles und alle zu kennen. Aus Bequemlichkeit fällt dann aber doch eine Datschen-Party in Tegel oder eine Rinder-Ausstellung im Schloss Neuhardenberg aus, während ein Shuttleservice zur Festung Küstrin, wo bei Wein und Würstchen Friedrichs II. gedacht wird, hochwillkommen ist.
Manchmal bilden sich lokale Schwerpunkte heraus: der Wedding zum Beispiel. Erst interessiert das Afrikanische Viertel: Warum wollen alle hier lebenden Kameruner am liebsten in der Kameruner Straße wohnen? Dann: Wie konnte sich rund um das Café „Auf der Suche nach dem verlorenen Glück“ am Leopoldplatz eine alternative Szene etablieren? Wo sind all die Weddinger Thai-Puffs hin (man sprach früher vom „Gelben Wedding“, inzwischen ist sogar das dortige Thai-Kloster verschwunden)? Und wieso gab es dort dann so viele mongolische Treffpunkte – wo sind die nun alle hin?
Das Ausgehen gilt in Berlin nicht nur dem plötzlich aufgetauchten Neuen, sondern auch dem verschwundenen Alten. Ganz extrem war das im Industrie und Arbeiterviertel Oberschöneweide, das sich nun – entleert – mit Künstlern und Studenten füllt.
Neulich gingen wir in Zehlendorf aus, wo die Klingelschilder alle keine Namen haben: Erst ins Brücke-Museum und dann ins Café Roseneck, wo sich sonntags die Boutiquenbesitzerinnen und Immobilienhändler treffen. Als die Torte kam, meinte Stefanie: „Jetzt fehlt nur noch Rolf Eden!“ Und da kam er auch schon. Uns schien, dass man dort einen Tisch für ihn reserviert. So schien es auch mit Eberhard Diepgen in den „Wannsee-Terrassen“ gewesen zu sein – bis diese abbrannten. Er traf sich dort immer mit seiner Mutter. Wie so viele andere ältere Erwachsene mit ihren Eltern auch. Sie hatten sich meist nicht viel zu sagen – saßen oft stumm nebeneinander und konzentrierten sich auf den Sonnenuntergang über Kladow.
Ähnlich schweigsam geht es im Ausflugsziel Buddhistisches Haus in Frohnau zu. Hier meditieren ältere Frauen in wallenden Gewändern oder flüstern mit asiatischen Mönchen. Kornel Miglus, dessen Polnisches Filmfestival ebenfalls zu meinen Ausgeh-Terminen gehört, dreht dort zusammen mit den Polnischen Versagern eine „Reise um die Welt in 80 Tagen“ – die nicht aus Berlin rausführt. Das muss sie auch nicht, weil die Welt hier fortwährend im Lokalen aufschlägt.
Eine Weile lang ging ich fast täglich ins Gericht zu irgendwelchen Prozessen, am Interessantesten waren die im Jugendgericht. En passant lernte man dabei auch noch den Bezirk Moabit kennen. Wobei nach dem Rauchverbot dessen Sozialgeografie noch einmal neu strukturiert werden musste. Seitdem gilt es überall, ein Netz sogenannter Raucher-Inseln im Kopf zu haben. Die Suche nach solchen ufert bisweilen aus, aber dadurch lernt man neue Ziele zum Ansteuern kennen und die verräucherten Eckkneipen mit Schlagermusik und allerlei Spielgeräten kommen zu neuen Ehren: z. B. die Altberliner Kneipe „Bären-Eck“ an der Hermannstraße, das „Florian“ am Kreuzberger Heinrichplatz, die „Eselsbrücke“ im Prenzlauer Berg und die Pankower „Flora-Stube“. Das sind nun alles Ausgehziele, oder mindestens Zwischenstopps für Rauchpausen. Und ein Buch lesen kann man dort auch – genauso gut wie zu Hause im Bett.
Einmal photographierte die Journalistin Jeanette Tust auch in Polen Poller:

Innenbeleuchteter Indoor-Poller

Handgeschnitzter Jagiellonen-Poller

Moderner Vorgarten-Poller

Triumph-Poller
Der Club der Polnischen Versager in der Ackerstraße hat nach zwölf Jahren seine Geschichte als Buch veröffentlicht. Es heißt: „Der Club der polnischen Versager“ und als Autoren zeichnen die Clubgründer Adam Gusowski und Piotr Mordel verantwortlich. Gestern wurde ihr Buch in der Kneipe „Rumbalotte“ vorgestellt.
Triumph des mathematisch-technisch-naturwissenschaftlichen Denkens
Eine deprimierende Nachricht:
„Der Kampf von Umweltschützern gegen Patente auf Affen geht in eine neue Runde: Die bekannte Forscherin Jane Goodall geht gemeinsam mit 13 Organisationen aus Deutschland, England und der Schweiz gegen Patente auf Schimpansen vor.
Sie wollen Einspruch einlegen gegen das Patent der US Firma Altor auf gentechnisch veränderte Schimpansen (EP1409646), das das Europäische Patentamt (EPA) im Juni 2012 erteilt hatte. «Es ist für mich eine schockierende Vorstellung, dass eine Firma in einem Menschenaffen nur noch ein technisches Instrument sieht. Wenn wir das jetzt zulassen, werden die Menschen in Zukunft fragen: Wie konnten Sie nur?», sagte Goodall, die viele Jahre das Leben von Schimpansen in freier Wildbahn beobachtet hat, laut Mitteilung.
«Der Einspruch ist auf dem Postweg», sagte Christoph Then von der Organisation Testbiotech, der sich seit Jahren gegen Patente auf Lebewesen einsetzt. Die betreffenden Tiere sind in ihrer DNA so verändert, dass ihr Immunsystem dem des Menschen ähnlicher sein soll. An diesen menschenähnlichen Tieren sollen Medikamente und Antikörper-Therapien getestet werden. Nach Ansicht der Tierschützer verstößt das Patent gegen die ethischen Grenzen des Europäischen Patentrechts. «Insbesondere von Menschenaffen wird angenommen, dass sie über ihre Leidensfähigkeit hinaus auch über ein menschenähnliches Bewusstsein verfügen», sagte Christophe Boesch von der Wild Chimpanzee Foundation. «Forschungsergebnisse insbesondere über das Verhalten von Schimpansen und Bonobos haben zu einer intensiven Debatte darüber geführt, ob Menschenaffen nicht Grundrechte eingeräumt werden müssten.»
Das EPA hat im Jahr 2012 drei Patente auf Schimpansen erteilt, eines davon für die Firma Altor. Gegen ein weiteres dieser Patente war bereits im November 2012 Einspruch eingelegt worden: Ob und wann es in diesem Fall zu einer mündlichen Verhandlung kommt, ist nach Angaben eines EPA-Sprechers aber noch nicht klar. Ein dritter Einspruch ist für Mai 2013 geplant. «Es gibt keine Rechtfertigung für derartige Patente. Diese Patente dienen nicht der Förderung des medizinischen Nutzens, sondern nur der Vermarktung von Versuchstieren», sagte die Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes, Brigitte Rusche. Nach Angaben Thens gab es schon 2006 ein Patent auf Affen mit Krebsgenen (EP0811061), auf das der Inhaber später aber verzichtet habe. 2010 wurde ein Patent auf Affen mit Epilepsie vergeben.“
Wiedergutmachungsgesten
„Wiedergutmachung“ – das Wort kennt man als Deutscher. Thomas Kuczyinski hat Jahre damit zugebracht, die „Entschädigungsansprüche für Zwangsarbeit im ‚Dritten Reich‘ auf der Basis der damals erzielten zusätzlichen Einnahmen und Gewinne“ zu ermitteln. Noch jetzt versuchen einzelne Aktivistinnen in der Ukraine ehemalige Zwangsarbeiterinnen ausfindig zu machen, um sie finanziell (symbolisch?) zu entschädigen. Andere, sowjetische Juden z.B., bekommen – ebenfalls symbolisch (d.h. stellvertretend für die ermordeten) – eine Wiedergutmachung in Form von Daueraufenthaltsrecht und Rente, obwohl sie selbst erst nach dem Sieg bzw. der Niederlage Deutschlands geboren wurden.
Auf der Berlinale hatte ein österreichischer Dokumentarfilm mit dem Titel „Wiedergutmachung unmöglich“ Premiere. Die Berliner gaben ihm jedoch den nichtssagenden Titel: „Unter Menschen“. Es ging darin um die Zwangsarbeit von 40 Schimpansen, die man in Sierra Leone als Kinder eingefangen hatte (indem man ihre Mutter und alle sie verteidigenden erschoß). 15 Jahre lang testete der österreichische Pharmakonzern „Immuno“ an diesen Affen Medikamente gegen Aids und Hepatitis. Dann übernahm ein US-Konzern die Firma – und stellte die Versuche ein. Die weltberühmte Schimpansenforscherin Jane Goodall setzte sich für das Fernsehen in eines der Käfige, um zu zeigen, dass „Immuno“ die 40 Affen einer schrecklichen Langzeit-Isolationsfolter unterzogen hatte. Einige Schimpansen waren im Labor zur Welt gekommen und kannten nur ihren Stahl-Glaskäfig.
Die Tiere bekamen von den neuen „Immuno“-Chefs zur Wiedergutmachung mitsamt ihren vier „Betreuerinnen“ ein schönes neues Gebäude auf einem Safaripark. Aber auch hier, wo die Schimpansen bis an ihr Lebensende bleiben sollten, sah es innen wie im Hochsicherheitstrakt eines modernen Gefängnisses aus.
Dann ging jedoch der Safari-Park pleite und ein reicher Mann, Michael Aufhauser, übernahm das „Projekt“, er besaß bereits das „Gut Aiderbichl“ – für alle möglichen Tiere, die der Forschung „gedient“ hatten und dann „ausgemustert“ worden waren.
Wiedergutmachungszahlungen an Zwangsarbeiter werden heute bald, da es zu viel und nicht zu wenig menschliche Arbeitskräfte gibt, in Größenordnungen nur noch an Tieren geleistet. Als Teil des „Gut Aiderbichl“ bekam das Schimpansen-Hospiz nach langem Drängen der vier Betreuerinnen mehrere Außengehege. Dieser Moment, da die ersten 10 Tiere aus ihrem Käfig im Haus durch eine automatisch sich öffnende Stahltür nach 15 Jahren erstmals ins Freie traten, das war sozusagen der Höhepunkt des Dokumentarfilms über ihr Leben in Gefangenschaft. Auch Jane Goodall war wieder anwesend sowie jede Menge Prominenz aus Politik und Showbusiness – und natürlich das Fernsehen. Die Affenbetreuerin Renate Foidl hatte aber alle und alles im Griff. Die Photos, wie die Schimpansen in der Tür stehen und den ersten Schritt nach draußen wagen, gingen um die Welt, wie man so sagt. Im Film liest der Hospiz-Gutsbesitzer vor, in welchen Medien sie veröffentlicht wurden.
Als ich aus dem Kino ins Freie trat, verteilten vier Tierveruchsgegnerinnen Flugblätter. Darauf befand sich das Farbphoto von einem Affen, dem man die Schädeldecke weggesägt hatte, so dass sein Gehirn frei lag, mehrere Meßgeräte steckten darin, eins sah aus wie ein Faschingshütchen. Aber der Affe ohne Schädeldecke kuckte nicht fröhlich, er sah mehr tot als lebendig aus. Der Titel des Flugblatts lautete: „Umstrittene Affenversuche in Bremen dürfen weiter durchgeführt werden“ So hatte ein Bremer Gericht gerade entschieden. Auf Fortsetzung der Experimente an Affengehirnen hatte die Uni Bremen geklagt. Nun habe ich an dieser als „linke Kaderschmiede“ verrufenen Uni einst marxistische Erkenntnistheorie studiert – und schämte mich deswegen für diese widerliche „Elite-Forschung“, für die man sich dort jetzt engagiert. „Die neurologischen Versuche ihres „Zoologen“ Andreas Kreiter sollen herausfinden, wie bei bestimmten Regungen im Gehirn die Nervenzellen zusammenarbeiten und wie sie vernetzt sind.“ Die „Tierversuchsgegner“ merkten dazu auf dem Flugblatt an: „Bei den unzähligen Funktionen des Gehirns ist diese Forschung endlos. Das menschliche Gehirn hat ca. 100 Milliarden Nervenzellen.“
Zu bekämpfen ist darüberhinaus in toto diese ganze idiotische Fixierung der Wissenschaft auf das Gehirn und die Gehirnforschung, um die Psychologie – dumpfmaterialistisch – in naturwissenschaftliche „hard facts“ aufzulösen, und so medizinisch-pharmazeutisch profitabel zu machen. Neurosen vs Neuronen.
Weitere Affenfilme:
1. „Nénette“ – ein Film über vier Orang-Utans im Pariser Jardin des Plantes, speziell über „Nénette“ eine 40 jahre alte Orang-Utan-Frau – von Nicolas Philibert 2010. Besucher am Käfig, einige kommen jeden Tag, erzählen ihr Wissen über sie, sowie Affenpfleger, einer davon betreute sie 35 Jahre lang. Alles aus der Sicht der Besucher des Menschenaffenhauses gefilmt. Weil Nénette mit ihrem Sohn Tübo zusammen lebt bekommt sie die Antibabypille. Geboren wure sie 1969 auf Borneo, 1972 kam sie in den Jardin des Plantes. Eine Zuschauerin fragt: „Willst du mit mir reden?“ Ein anderer kommt jeden Tag, um sie zu sehen. Eine Pflegerin meint: „So lange in Gefangenschaft zu sein ist natürlich schrecklich, wir fühlen uns alle schuldig.“ Weil einige Besucher sich küssten, machten es irgendwann die Orang-Utan nach. Bei rothaarigen Besucherinen machen sie Kußgesten zu ihnen hin…
2. „Max, Mon Amour“ mit Charlotten Rampling und einem Schauspieler in Schimpansenkostüm: Spielfilm von Nagisa Oshima 1986.Wenn eine Frau sich in einen Menschenaffen verliebt reagiert ihr Ehemann genauso als hätte sie sich in irgendeinen anderen Affen verliebt.
3. „Primate“ Doku 1974 von Frederick Wiseman über das „Yerkes National Primate Research Center“ – eines der schrecklichsten Affenfolter-Orte, die es auf der Welt gibt, auch in quantitativer Hinsicht. Hier ein Artikel von Elen und Jim Moody darüber:
Last night I watched the most horrifying film I’ve ever seen and I’ve seen some horror. It’s a 1974 Frederick Wiseman film called Primate where he filmed the people or scientists who “do” science at Yerkes Regional Primate Research Center in Atlanta. (I hate to call them that but that’s why they would call themselves and would probably be granted that definition because of their methods of documentation) The daily cruelty inflicted on a group of apes unluckily caught and enslaved in cages is terrifying as you watch them do the meanest, most absurd, brutal, exploitation, and useless experiments on these animals. Researching these animals’ sexuality under conditions of extreme imprisonment, drugging, imprisonment inside various kinds of harnesses, versions of chains, includes forcing a chimp to ejaculate while you feed him grape juice; you keep him in cage, starve him so he is hungry and will come to the front and you put your hand in and do this to him. This is minor. I saw one gibbon beheaded slowly. The people wear doctors’ outfits. They are doing science, continually writing down every thing these animals are coerced into doing in these cages.
I then read an chapter printed in a 1989 book by Thomas Benson and Carolyn Anderson, Reality Fictions, where I learned as of that year the Yerkes institute was still performing these acts.
To my surprise I discovered it began with Anthony Trollope’s description of his realistic method IN CYFH? where he discussed self-reflexively how he put his “facts” on a page, what he meant to do in his novels: to make us see and face the real details of the world and see their relations and consequences quite apart from what the characters claim these are.
This is what Wiseman does. Benson and Anderson then quoted and discussed James Agee documentary book on sharecroppers in the depression where a similar point is made about political discourse and how to be effective.
Of course the Yerkes and its supporters have attacked Wiseman as unfair, gross, skewing the evidence. They say their talk was not included, their justifications. In fact they partly are. But these are irrelevant.
Look at what people do. I cannot better Benson and Anderson’s straight descriptions and evaluations:
Primate is 105 minutes long-feature length-and contains, according to an analysis by Liz Ellsworth, 569 shots.8 That works out to an average of eleven seconds per shot for Primate, approximately half of the average shot length of twenty-three seconds in Wiseman’s High School, and a third of the average shot length of thirty-two seconds in Titicut Follies. The unusually large number of shots in Primate is not simply a fact, but a clue, both to the rhythm of the film and to its method of building meanings.
The film opens with a long series of shots in which we may first notice the ambiguity of the film’s title, which applies equally well to men and apes. We see a large composite photograph, with portraits of eminent scientists, hanging, presumably, on a wall at the Yerkes Center. Wiseman cuts from the composite portrait to a series of eight individual portraits, in series, then to a sign identifying Yerkes Regional Primate Research Center, a bust of a man on a pedestal, an exterior shot of the center, and then a series of four shots of apes in their cages. The comparison is
obvious, though not particularly forceful, and it depends for its meaning both upon the structure Wiseman has chosen to use-at least he does not intercut the apes and the portraits-and upon our own predictable surprise at noticing how human the apes look.
Slightly later in the film, still very near the beginning, a pair of sequences occur that are crucial to how we will experience the rest of the film. Researchers are watching and recording the birth of an orangutan. The descriptive language is objective, but not altogether free of anthropomorphism: for example, it is hard not to refer to the female giving birth as the “mother.”
Immediately following the birth sequence, we watch women in nursing gowns mothering infant apes: the apparatus of American babyhood is evident-plastic toys, baby bottles, diapers, baby scales, and a rocking chair. To reinforce the comparison, we hear the women speaking to the infant apes. “Here. Here. Take it. Take it. Come on,” says the first woman, offering a toy to an infant ape. Then another woman enters the nursery, also dressed in gown and mask. “Good morning, darlings. Good morning. Mama’s babies? You gonna be good boys and girls for Mommy?” A moment later she continues, “Mama take your temperature. Come on, we’ll take your temperature. It’s all right. It’s all right. It’s all right. It’s all right.” Then a man enters and hands cups to the infants. He says, “Come on. Come on. Here’s yours.”
The rhetorical effect of this scene is to reinforce our sentimental identification with the apes. And this scene, by comparison, makes even more frightening a scene that follows close upon it, in which a small monkey is taken from its cage, screaming, as a man with protective gloves pins its arms behind its back and clamps his other hand around its neck.
After these scenes, every image in the film invites us to continue enacting comparisons, as part of the process by which we actively make meanings out of the images.
Wiseman establishes a dialectic between acts that we are likely to perceive as kindness to the apes and acts that we are likely to perceive as cruelty. Do the acts of kindness balance the acts of cruelty? Is there a journalistic attempt at fairness here? Not really. We understand that in this institution, the apes are subject to human domination, mutilation, and termination. In such a situation, the acts of kindness do not balance the acts of heartless research. Rather, kindness is reduced to hypocrisy, a lie told to ease the consciences of the scientists and to keep the apes under control. Far from balancing the harshness of the research scenes, the scenes of kindness turn the research into a cruelty and a betrayal.
Let us examine briefly another sequence in Primate. It is the climactic sequence of the film, a little over twenty minutes and over one hundred shots long. In it, researchers remove a gibbon from its cage, anesthetize it, drill a hole in its skull, insert a needle, then open its chest cavity, decapitate it, crack open its skull, and slice the brain for microscope slides. It is a harrowing sequence. From a structural standpoint, Wiseman uses the techniques we have noticed earlier. The images are often highly condensed, with close-ups of needles, drills, scalpels, the tiny beating heart, the gibbon’s terrified face, scissors, jars, vises, dials, and so on.
We are invited to engage in our continued work of making comparison and metaphors: the gibbon is easy to identify with, in its terror of these silent and terminal medical procedures. We are the gibbon, and we are the surgeons. At another level, we see the gibbons’ cages as a sort of death row and call upon our memories of prison movies when we see the helpless fellow gibbons crying out from their cages as the victim is placed back into its cage for a twenty-five-minute pause in the vivisection.
Wiseman has carefully controlled progression and continuity in this section of the film, first by placing the sequence near the end of the film, so that it becomes the climax of the preceding comedy, and then by controlling its internal structure for maximum effect. The sequence is governed by the rules of both fiction and documentary. We do not know until almost the very last second that the gibbon is certainly going to die. Earlier in the film we have seen monkeys with electrodes planted in their brains, so we are able to hope that the gibbon will survive. We keep hoping that it will live, but as the operation becomes more and more destructive of the animal, we must doubt our hopes. And then, with terrible suddenness, and with only a few seconds’ warning, the surgeon cuts off the gibbon’s head. We feel a terrible despair that it has come to this. But the sequence continues through the meticulous, mechanical process of preparing slides of the brain. Finally we see the researchers sitting at the microscope to examine the slides for which the gibbon’s life has been sacrificed. And for us, as viewers, the discovery ought to be important if it is to redeem this death. The two researchers talk:
FIRST SCIENTIST: Oh, here’s a whole cluster of them. Here, look at this. SECOND SCIENTIST: Yeah. My gosh, that is beautiful.
FIRST SCIENTIST: By golly, and see how localized. No fuzzing out. SECOND SCIENTIST: For sure it does not look like dirt, or-
FIRST SCIENTIST: No, no, it’s much too regular.
SECOND SCIENTIST: I think we are on our way.
FIRST SCIENTIST: Yeah. That’s sort of interesting.The whole operation, which viewers are invited to experience as pitiable and frightening, seems to have been indulged in for the merest idle curiosity, and, if the scientists cannot distinguish brains from dirt, at the lowest possible level of competence. Our suspicions are confirmed a few minutes later when a group of researchers seated at a meeting reassure each other that pure research is always justified, even if it seems to be the pursuit of useless knowledge.
We have already mentioned the sound-image relationships in this sequence in discussing the structural uses of comparison and continuity. But let us point to some special issues that relate to Wiseman’s use of sound. At many places in the film, people talk to apes, creating a dramatic fiction that the apes can understand and respond to human speech. But in the vivisection sequence, no word is spoken to the victim. This silence is almost as disturbing as the operation itself, because a bond of identification offered earlier is now denied.
The distortion of sexual behavior, in the name of understanding sexual behavior, sometimes reduces sexuality to mechanics, as in the many scenes where apes are stimulated to erection and ejaculation by means of electrodes implanted in their brains, or the scene in which a technician masturbates an ape with a plastic tube in one hand while distracting the ape with a bottle of grape juice in the other. At other times, the scientists seem gossipy, as they sit and whisper about sex outside a row of cages. The effect of the sex scenes is comic and undermines the dignity of the presumably scientific enterprise we are watching.
But along with the comedy, there is an undercurrent of horror, at times straightforward, at times almost surrealistic. Sometimes the horror occurs in small moments: a technician tries to remove a small monkey from its wire cage. He reaches inside the door of the cage and grasps the monkey, which tries to evade capture by clinging to the front of the cage next to the door, an angle that makes it difficult for the technician to maneuver it out of the door. The technician reaches up with his other hand and releases another catch, revealing that the whole front of the cage is hinged. The front of the cage swings open, and the technician grasps the clinging monkey from behind, as our momentary pleasure at the comedy of the impasse gives way to a small despair: there is no escape.
Benson and Anderson found the snipping of the gibbon’s head off the moment the film most made them shudder; for me the cruelty of these people was felt most when Wiseman photographed one of the apes operated on and we see him from the back with no clothes, no fur, just shuddering and not a thing is done to soothe, comfort, protect him. And again when the ape operated on so horrifyingly is brought back to his cell, and just dumped there, and the camera catches the creatures intensely distress confused eyes as he lays on the cement floor, and the keeper locks the door on him and walks away.
Oh the film is rightly called Primate. The creatures in charge in their white coats doing these deeds are primates just as surely as the creatures they torture.
This film more than any other shows the wisdom and decency of Sy Montgomery and the “Woman who walked with apes” (Goodall, Fossey, and Gildikas) whose methods are called “unscientific.” They watched the apes in their real habitat, did not attempt to control or change or manipulate them, took into account the apes’ subjective life and studied them from within as a culture. Theirs is the real way to discover truths about these animals.
Aus verschiedenen Ecken des Erdballs kamen hier erneut Kunstpoller und Pollerkunst aufs Schönste zusammen:

Husum (mit Stadtdesigner-Poller)

Berlin (mit umgefallenem Poller)

Brighton (Pollerperformance)

Norwegischer Lichtpoller

Amerikanischer Kunstpoller

Werbepostkarte mit Poller.

Amerikanisch-Russischer Tanz auf altem Navy-Poller

Pariser O-la-la-Poller

Aggressive Poller-Werbung. Photo: Peter Loyd Grosse
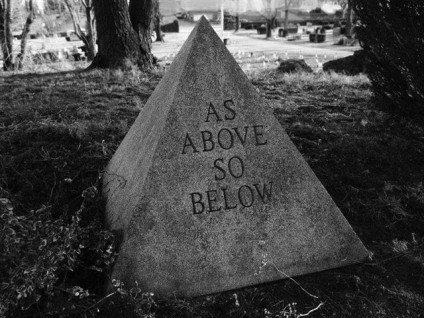
Englischer Resignations-Poller

Kopenhagener Abpollerungsbeispiel

künstlerisch gestaltete Poller-Barriere in Worpswede. Alle Photos: Peter Loyd Grosse
Kantsche Gemütlichkeit
„Man nennt das durch Ideen belebende Prinzip des Gemüts Geist,“ heißt es bei Kant. Der Geist „belebt“ also das Gemüt, indem er in ihm „die wimmelnde Bewegung der Ideen“ entstehen läßt – so erklärte sich Michel Foucault den Kant-Satz. Man könnte ihn aber auch so lesen, dass das „Gemüt“ aus Geist besteht – im Prinzip, und dieser muß ständig belebt, d.h. durch Ideen angetrieben werden.
Aber was versteht Kant eigentlich unter „Gemüt“ (Plural Gemüter)? Wenn er etwas behaupten will, macht Kant sich zum „man“: „Unter Gemüt versteht man nur das die gegebenen Vorstellungen zusammensetzende und die Einheit der empirischen Apprehension bewirkende Vermögen (animus) Üb. d. Organ, d. Seele,“ schreibt er an Sömmering 1795. An anderer Stelle heißt es – laut „Kant-Lexikon“: „Das Gemüt (animus) des Menschen ist der ‚Inbegriff aller Vorstellungen, die in demselben Platz haben‘. Es hat einen ‚Umfang‘ (sphaera), der die drei ‚Grundstücke‘: Erkenntnisvermögen, Gefühl der Lust und Unlust und Begehrungsvermögen befaßt, deren jedes in zwei Abteilungen, das Feld der ‚Sinnlichkeit‘ und der ‚Intellektualität‘, zerfällt (‚dem der sinnlichen oder intellektuellen Erkenntnis. Lust oder Unlust, und des Begehrens oder Verabscheuens‘).“
Man hat Kant wegen solcher und ähnlicher Äußerungen nicht ganz zu Unrecht einen „Gemütsathleten“ genannt: Als jemand, der noch über den „Gemütsmenschen“ steht – ein Übergemütsmensch sozusagen. Auf Wikipedia heißt es dazu: „In einem engeren Sinne ist der ‚Gemütsmensch‘ ein Mensch, der Gelassenheit ausstrahlt und schwer aus der Ruhe zu bringen ist. In diesem Sinne bezeichnet der Begriff ’starkes Gemüt‘ etwas Tugendhaftes, mit Gemütszustand wird die akute seelische und emotionale Situation eines Menschen bezeichnet, Gemütsschwankungen beziehen sich auf psychische Instabilität.“ Diesen gegenüber steht das „sonnige Gemüt“. Als Synonyme fürs Gemüt lassen die Internet-Lexika „Innenleben, Naturell, Wesen, Sinnesart“ gelten. Zum „Übergemüt“ gibt es nur einen Eintrag – und dieser führt zu einem „Neopangaia“-Forum. Dessen Betreiber versichern: Neopangaia sei das „neue globale Dorf“ – ein „Biocyberspace“. Von dort gelangt man dann zu ganz vielen Youtube-Clips. Aber wieso sie das „Übergemüt“ für sich in Anspruch nehmen, wird nirgends erklärt. Neo meint natürlich neu, Pan steht für Musik und Tanz und Dauergeilheit, Gaia für James Lovelocks Theorie von der Erde als ein Organismus“. Zusammengesetzt ergibt das einen neuen Eso-Orgasmus – als persönliches Projekt, als Weltverbesserung, als Internetplattform, Playlist, Mangamanie, Amispinnerei und Geschäftemacherei. Bei Lamarck waren Organismus, Organ und Orgasmus Synonyme, auch noch bei Wilhelm Reich. Das Gemüt geht jedoch in eine ganz andere Richtung: hin zu gemütlich, zum deutschen Gemüt und schließlich zur Gemütlichkeit. In seiner „Germanomanie“ schrieb Saul Ascher 1815: „So geschah es, dass von ihnen [den Deutschen] die Gemütlichkeit als das Höchste und Würdigste aufgestellt ward.“ In Dorothee Wenners Dokumentarfilm „Unser Ausland“ machte sich deswegen 2002 ein indischer Sozialforscher in deutschen Schrebergärten auf die Suche nach dieser Gemütlichkeit, die von Wikipedia als ein „subjektiv empfundener Gemütszustand des Wohlbefindens“ definiert wird, der nicht zuletzt von „materiellen Verstärkern“ lebe. Das ist aus den Kantschen Ideen geworden, die das Gemüt im Prinzip (Geist genannt) beleben. Man findet sie heute massenhaft z.B. im Bau- und Gartenbedarfsmarkt – wohin dann auch der indische Gemütlichkeitsforscher verwiesen wurde. Für das deutsche Gemüt ist dort jedes Sonderangebot ein Stimmungsaufheller – zwischen zwei Vergrübeltheiten. Man muß sich den Besuch eines solchen Baumarkts so ähnlich wie ein meteorologisches „Zwischenhoch“ vorstellen, das die Wettervorhersager kontrapunktisch als eine Art logische Sekunde zwischen zwei Tiefausläufern postulieren. Und es funktioniert sogar – bei den Wetterbericht-Zuhörern mindestens!
Werbung und Verbrechen
Was Besucher aus dem Westen als „schön bunt“ bezeichnen, die Werbeschilder und Leuchtreklame in Moskau, bezeichnet eine Moskauer Germanistin als „unerträglich“. Tatsächlich zeugt dieses aufdringlich vielfarbige Durcheinander der Markennamen und Warenzeichen von der „Unerträglichkeit des Seins“, das permanent „Leichtigkeit“, mindestens „Erleichterung“ verspricht. In Wirklichkeit wird dagegen das „Überleben“ immer schwerer, nicht nur in Moskau.
Kurz nach der Wende wollte/sollte die DDR-Kulturzeitschrift „Der Sonntag“ von „Die Zeit“ übernommen werden. Der „Deal“ kam nicht zustande, dafür ließ man die Sonntags-Redakteure ein „Zeit-Magazin“ frei gestalten – das Heft Nr. 46: „Start ins neue Deutschland“. Darin ließen die „Ostler“ sich zu einem Photo von Plakatwänden folgende Bild-Unterschrift einfallen: „Die Werbung überzieht das Land flächendeckend wie früher die Stasi.“
Die Chefredaktion des Zeit-Magazins bekam daraufhin einen wütenden Brief vom Bonner „Zentralausschuß der Werbewirtschaft“, in dem der „Zeit“ gedradezu gedroht wurde, sie durch Anzeigen-Entzug in den Ruin zu treiben, wenn so ein schlimmer Satz noch einmal vorkäme. Zur Wiedergutmachung quasi wurde das Magazin dazu verdonnert, sich demnächst gefälligst „einmal sachgerecht mit dem Thema Werbung und Gesellschaft auseinanderzusetzen“.
Wenig später versuchten die „Sonntag“-Redakteure genau dies in ihrer eigenen Zeitung, indem sie eine Rede des DDR-Werbegraphikers Helmut Brade abdruckten, die dieser auf einem Braunschweiger Graphiker-Kolloquium gehalten hatte. U.a. hieß es darin: „Jeder Einzelne arbeitet fleißig am Ende der Welt. Der Graphik-Designer in vorderster Reihe. Was so wünschenswert wäre, dass die Gesellschaft besser wird, ihr Tempo verlangsamt und sich mit der Natur versöhnt, bleibt im Hintergrund. Wie wäre es z.B. mit einem Verbot jeglicher Werbung, die den Verbrauch von Waren und Energie fördert? Werbung ist verbrauchsfördernd. Die Förderung von Verbrauch aber ist im Zusammenhang mit den Chancen zur Erhaltung der Menschen als lebensgefährlich erkannt. Also kann ein Beruf, der sich inzwischen fast ausschließlich und mit immer größer werdender Perfektion der Verbrauchsförderung angepaßt hat, kein guter Beruf sein, sondern befindet sich auf der Seite des Verbrechens.“
Und das „Verbrechen“ ist systemisch: Die kapitalistische Produktionsweise ist von Anfang an durch Überproduktion gekennzeichnet, erst recht seit dem Fordismus und dem Toyotismus, da man die heute elektronisch gesteuerte Produktion nicht einfach mal anhalten kann, das wäre chaplinesk, auch die Arbeiter kann man nicht so einfach mehr nach Hause schicken. Also muß der Absatz forciert werden – u.a. durch immer mehr Produktdesign und Werbedruck. Und wenn auch das nicht mehr geht, dann durch Krieg.
In den USA wollte man Ende der Zwanzigerjahre, die Unternehmen gesetzlich verpflichten, ihre Waren immer weniger haltbar zu machen, damit der Konsument immer schneller neue kaufen muß. Die Industrie verfiel stattdessen auf immer kürzere Produkzyklen, d.h. produzierte ständig selbst vermeintlich neue Waren: besser, bunter, billiger, die mittels Werbung und „Moden“ bzw. „Trends“ abgesetzt wurden. An dieser nur auf den Endverbraucher bezogenen „vordersten Front“ steht der Werbegraphiker, „Werber“ genannt.
Einigen Waren wurde und wird daneben seit den Zwanzigerjahren dennoch die „Lebensdauer“ sozusagen künstlich verkürzt: Das fing mit der Glühbirne und dann mit den Nylonstrümpfen an – und hört mit HP-Druckern und Apple-Geräten noch lange nicht auf.
Das Kunstmagazin „art“ interviewte dazu den „DDR-Design-Experten“ Günter Höhne, ehemals Chefredakteur der ostdeutschen Design-Zeitschrift „form+zweck“, danach Dozent an der FHTW, die jetzt im ehemaligen Kabelwerk Oberspree in Oberschöneweide domiziliert ist. Laut Höhne hatte man in der DDR „andere Ansprüche an die Produkte als in der kapitalistischen Warenwelt. Diese lebt vom Warenumschlag auf Krawall, von Produkterneuerungszyklen, die immer kürzer werden. Das war in der DDR ganz anderes. Zum einen waren die Ressourcen gar nicht vorhanden – man sagt ja so schön: Mangelwirtschaft. Man mußte sparsam mit Energie und Rohstoffen umgehen, und es herrschte bei zu geringen technologischen Innovationsschüben ein steter Arbeitskräftemangel.“
Zwischenbemerkung von Heiner Müller: „Ein Land, das Arbeitslose hat, braucht keine Stasi!“
Höhne: „Das andere war eine allgemeine Einstellung bei vielen Nutzern von Produkten, dass sie sich dagegen wehrten, Dinge zu ersetzen, bevor sie überhaupt eine Chance hatten, sich zu verschleißen. Der Anspruch war eher Langlebigkeit und die Dinge als Lebensbegleiter in Würde älter werden lassen.“
Das klingt fast nach einem Land, in dem sogar den Dingen „Menschenrechte“ zugestanden wurden. Am 3.Februar fand im „Industrie-Salon“ auf dem Gelände des abgewickelten Transformatorenwerks (TRO) in Oberschöneweide ein Gespräch mit zwei Experten für DDR-Plasteprodukte statt: Der eine, Richard Anger aus Ulm, sammelt sie seit 1991, und der andere, Günter Knobloch aus Ostberlin, war bis 1991 Direktor der dortigen Fachschule für Werbung und Gestaltung. Nach der Chemie-Konferenz der Partei 1958 wurde fast eine „Plastifizierung des ganzen Landes“ eingeleitet. 1968 gründete sich die tschechische Band „The Plastic People of the Universe“, deren Verhaftung 1976 die „Charta 77“ auslöste. In den Sechzigerjahren kamen hunderte neuer Produkte aus Plaste und Elaste in den DDR-Handel, hergestellt von damals 800 teilweise noch privaten Betrieben. Die „Gestaltung“ der Produkte sollte „im Sozialismus“ anders sein als im kapitalistischen Westen: „Modern, aber nicht modisch!“ Maßgeblich beteiligt waren daran die Formgestalter der Hochschule für industrielle Formgestaltung Halle – auf der Burg Giebichenstein.
Die Vorgabe, modern aber nicht modisch, wurde bei vielen Plasteprodukten eingelöst, im Kern war sie bereits von Rathenau und Siemens diskutiert worden, als es um die Vermarktung des Edison-Patents ging und die beiden dazu die Firma „Osram“ gründeten. Siemens wollte, preußisch denkend, die Erleuchtung – Elektrifizierung – Deutschlands und dann Europas über die Herrscherhäuser, also durch Lobbyismus, Bestechung und Korrumpierung – „Beeinflussung“von oben – erreichen, während Rathenau, US-inspiriert, auf Bedarfweckung durch Werbung von unten setzte, u.a. illuminierte er dazu das Café Bauer unter den Linden und ein Münchner Theater kostenlos mit Glühbirnen. Weil sie sich nicht einigen konnten, zog sich Rathenau aus Osram zurück. Nichtsdestotrotz wurde sein Konzern, die AEG, später neben Siemens führend im Welt-Elektrokartell „Phoebus“, das mindestens bis 1989 „International Electrical Association“ hieß und seinen Sitz in Pully bei Lausanne hat: Es bestimmte u.a. die Lebensdauer aller Glühbirnen in der westlichen Welt: 1000 Stunden.
Als das DDR-Kombinat Narva 1982 auf der Hannover-Messe „Langlebensdauerglühlampen“ vorstellte, die 2500 Stunden hielten, meinten die Osram-Kollegen abfällig: „Ihr wollt euch wohl alle arbeitslos machen!“ – „Im Gegenteil!“ erwiderten die Narva-Entwicklungsingenieure. Und recht hatten beide, wobei die einen eher betriebswirtschaftlich und die anderen volkswirtschaftlich dachten. Letzteres – die VWL – wird heute, nach Auflösung des Sozialismus, zwischen BWL und Globalisierung ebenfalls aufgelöst.
Ganze Generationen generieren
„Generieren“ heißt so viel wie „automatisch erzeugen (lat. generare)“, sagt der Wiktionary. Als „Gegenwort“ gilt ihm: „manuell erstellen“. Für den Duden ist „generieren“ ein Synonym für „kreieren“. Auf Englisch heißt das Verb „to generate“ – und ist noch weitgehender anwendbar: von „errechnen“ über vermehren bis „ausarbeiten“ (ein „document“ z.B.). In dem Wort ist das „Genus“ (Plural Genera) – Art, Gattung Geschlecht – enthalten, ebenso das „Gen“, die Genetik. Und damit die Fortpflanzung, die Fruchtbarkeit – das „Errechnen“ von Nachkommen oder Gewinnchancen bzw. Gewinne. Dergestalt wurde „generieren“ fast weltweit zu einem „Magic Word“. In einer Zeit, da täglich nicht nur Arten sondern auch Verben aussterben.
„Die 149 Logenplätze generieren ab 2014 angeblich Einnahmen von rund 70 Millionen Euro,“ heißt es z.B. in der taz über ein Fußballstadion. „Mit ihrer prominenten Besetzung könnte sie aber Aufmerksamkeit generieren,“ schreibt die taz über eine Umweltschutzkampagne. „Social-Media-Ranking-Dienste wie Klout oder Peerindex generieren aus den Kontakten in sozialen Netzwerken einen Wert auf einer Skala von 0 bis 100,“ mit diesen Worten erklärt eine taz-Autorin ein US-Unternehmen, das mit dem Slogan „Entdecke Deinen Einfluss“ wirbt. „Solche Veranstaltungen müssen wir immer wieder generieren,“ sagt eine Museumsleiterin in der taz über ihr gutbesuchte letztes „Event“. Es gelte, „anhaltendes Wachstum zu generieren,“ meint dort ein Ökonom. „Ich habe mich entschieden, Bewusstsein zu generieren,“ behauptet ein Filmer, der einen TV-Spot zur Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ drehte. Auf einer „Cryptoparty“ berichtete eine Frau, sie durchforste Webseiten „nach Daten, aus denen sich Passwörter generieren lassen“. Wer auch immer Suhrkamp übernimmt, er hat „die schier unlösbare Aufgabe, Bestseller zu generieren,“ schreibt ein taz-Literaturbetriebskritiker. „Islands Fischwirtschaft droht nicht nur ein Verkaufsverbot für Makrelen, sondern für alle ihre Fischprodukte. Sie generieren 75 Prozent des isländischen Exportwerts,“ heißt es über den Fischrechte-Streit zwischen der EU und Island in einem taz-Korrespondentenbericht. Eine ehemalige Linke, jetzt Maklerin sagt: „Geld muss nicht immer etwas Negatives sein. Man kann viel über Gentrifizierung schimpfen. Aber: All diejenigen, die jetzt nach Berlin kommen und hier investieren, bringen Geld in die Stadt. Sie generieren Jobs.“ In diesem „Statement“ haben wir das ganze derzeitige Scheißdenken wie in einer Nußschale. Eine alternative Imkerin gibt zu Protokoll: „Noch seien viele Fragen offen – deswegen gehe sie zum Beispiel auch auf die taz-Genossenschaftsversammlung, um dort Ideen zu generieren.“ Das Verb sickert in alle Bereiche ein – bis in die kubanische Musik z.B.: „verspielte Rhythmen betonen Gemeinsamkeiten und generieren das Beste, das die Bassmusik derzeit zu bieten hat,“ schreibt ein taz-Kritiker. Eine Feministin seufzt: „Frauen können keine allgemeinen weiblichen Erfahrungen mehr generieren…Männer generieren Macht in ihrer Beziehung.“ Ein linker Regisseur erklärt der taz die Hauptfigur seines neuen Films: „Weil er ein Kapitalist ist, kann er nicht anders, als zu denken: das muss ich kaufen, anstatt es aus sich selbst heraus zu generieren.“
Es sich selbst zu schaffen, meint er wahrscheinlich. Und dies im Sinne einer „creatio ex nihilo“ (wie die des Schöpfergottes). Der Regisseur spricht hier der männlichen Prokreation das Wort, also der Vermehrung (durch Herstellung toller Werke), die mehr als die Reproduktion sichern. Beide Wörter gelten jedoch im strengen Sinne nur für die biologische Fortpflanzung, d.h. für das „Egoistische Gen“, wenn man dabei dem Erzdarwinisten Richard Dawkins folgt. Dieser übersetzte damit 1976 Margret Thatchers Dummbeutel-Bekenntnis: „Ich kenne keine Gesellschaft, nur Individuen“ – als ewige Wahrheit in die Natur: Den Genen geht es nicht um die Arterhaltung, sondern um das Individuum, das ihnen aber nur als Transportmittel dient, in dem sie – die Gene – untereinander um ihre Verteilung in der nächsten Generation konkurrieren.
Aus dieser Ecke kommt das Wort „generieren“, erst nach der Wende wurde es in der taz vom Feuilleton übernommen – quasi weichgeklopft, so dass es längst überall paßt, wenn es darum geht, sich Uptodate auszudrücken. Gestern las ich in der FAZ irgendwas mit „Kommunikation“ „an Schnittstellen“ „generieren“…Ach!
Vaterschaftstests
Vor einiger Zeit verschlug es mich nach Manila. Dort traf ich zwei „Health-Officers“ aus Papua-Neuguinea, die sich auf Einladung der UNESCO zur medizinischen Weiterbildung in der Stadt befanden: Sie gewährleisten die medizinische Versorgung und Gesundheitsprävention in schwer erreichbaren Gegenden, in einem lebten auch ihre Eltern als Subsistenzbauern. Ihr Rang war etwas unterhalb von ausgebildeten Krankenschwestern angesiedelt, man könnte sie als „Barfuß-Krankenpfleger“ bezeichnen, eingebunden jedoch in ein englisches Gesundheitssystem, das kostenlos war. Einer der beiden „Health-Officer“, er war etwas devoter als der andere, bezeichnete die „Heiler“ und „Schamanen“, die Geld für ihre Behandlung nehmen, als seine „Hauptgegner“, die er als „Betrüger“ bekämpfte. Während der andere, der souveräner wirkte, bei dem „Hauptproblem“ in seinem Distrikt – die Bisse einer bestimmten Giftschlange – sogar die „Zauberdoktoren“ um Hilfe bat, die in solchen Fällen die Bißstelle mit Lehm und bestimmten Pflanzensäften beschmieren und dazu Zaubersprüche murmeln: „Das hilft fast immer – und ich spare mein teures Serum,“ erklärte er.
Die beiden Health-Officer nahmen also zwischen dem „wilden“ und dem „rationalen Denken“ unterschiedliche Positionen ein. Wir diskutierten jedoch bald etwas anderes: Die Anthropologie behauptet immer wieder eine Kenntnis des Zusammenhangs zwischen Geschlechtsverkehr, Zeugung, Schwangerschaft und Geburt. Diese Kenntnis reiche weit über die westlichen Gesellschaften hinaus und betreffe eigentlich alle menschlichen Gemeinschaften, ja sogar die vieler Tiere: Wenn z.B. männliche Löwen und Schimpansen als neue Rudelführer alle nicht von ihnen abstammenden Jungen töten, damit sie schneller – mit ihren Genen versehene – eigene Nachkommen zeugen können. Den Gipfel schoß in dieser dumpfdarwinistischen Hinsicht einmal der Tierfilmer Heinz Sielmann ab, als er in seinem Beitrag über das Leben in einem Tümpel, über den ein Mückenschwarm tanzte, raunte: „Sie haben nur ein Interesse – sich zu vermehren.“
Dem gegenüber stehen ethnologische Feldforschungen – beginnend mit denen von Bronislaw Malinowski bei den Trobriandern, deren Inseln zu Papua-Neuguinea gehören: Trotz guter anatomischer Kenntnisse leugnen die Trobriander den Zusammenhang von Geschlechtsverkehr und Schwangerschaft, dennoch werden unverheiratete Frauen, obwohl sie viel Geschlechtsverkehr haben (können), fast immer erst nach ihrer Heirat schwanger. Weil erst dann ein „Vater“ da ist, „der das Kind in den Arm nehmen kann, wie sie sagen. Der Vater ist bei den Trobriandern also keine biologische, sondern eine rein soziale Kategorie. Malinowski: „Da die Zeugungsfunktion des Geschlechtsakts unbekannt ist, weil die Samenflüssigkeit als harmlos gilt, ja als wohltuende Ingredienz, gibt es keinen Grund, ihr Eindringen zu verhindern – deswegen kennen die Trobriander auch keine Verhütungsmittel. Und das gilt nicht nur für die Menschen, sondern auch für ihre Hausschweine, deren weibliche Tiere, da alle männlichen kastriert werden, sich von männlichen Wildschweinen im nahen Urwald decken lassen, was die Trobriander jedoch heftig bestreiten, zumal sie Wildschweinfleisch verabscheuen und nur das Fleisch von ihren Hausschweinen essen.
Auch etliche andere „primitive Völker“ – bis hin zu vielen „unaufgeklärten“ Teenagern im Westen sehen keinen Zusammenhang zwischen Geschlechtsverkehr und Schwangerschaft. Die genverbreitungsversessenen Anthropologen würden dem entgegenhalten: „Sie wissen das nicht, aber sie tun so – als ob.“ Aus schierem Antidarwinismus bin ich dem gegenüber – wie die Trobriander – der Meinung, dass der „Vater“ ein rein soziologischer Begriff ist, mit der Zeugung haben Männer nichts zu tun, die Vaterschaft kann man sich höchstens erarbeiten, sie kostet auch eine Menge – an Zeit, Geld und Nerven. Und eigentlich ist sie sozial sinnvoll nur bei den Bauern und den Unternehmern, die sich als Väter gehörig anstrengen müssen, um einen einigermaßen „fitten“ Hof- bzw. Betriebsnachfolger heranzuziehen. Heutzutage, da es hier wie dort nur noch „Manager“ gibt, ist die Vaterschaft bloß noch eine Art „Bürgerschaftliches Engagement“ . wie übrigens die Mutterschaft auch bald. Die beiden „Health-Officer“ aus Papua-Neuguinea, die beide verheiratet waren und Kinder hatten, vertraten, natürlich möchte man fast sagen, eine dem entgegengesetzte, die herrschende – angloamerikanisch-biologische – Theorie.
Bevölkerungspolitiken
Deutsche Eugenik-Biologen, wie die Wasservögelforscher Konrad Lorenz oder Oskar Heinroth, haben immer wieder vor der „drohenden Überbevölkerung“ durch Menschen gewarnt, sie konnten sich dabei auf Darwins Inspirationsquelle Thomas Malthus berufen. Der erste Lehrstuhlinhaber für Ökonomie hatte 1798 ein „Bevölkerungsgesetz“ entdeckt: Danach wächst die Bevölkerung schneller als ihre Unterhaltsmittel, mathematisch gesehen nehmen die Menschheit in geometrischer Progression und die Lebensmittel in arithmetischer Progression zu, was früher oder später katastrophal enden muß. Malthus riet deswegen erst einmal zur Abschaffung der Armenfürsorge – als eine Form der „Geburtenbeschränkung“.
Im „Deutschlandradio“ forderte erst neulich der Bremer Populationsforscher Gunnar Heinsohn eine „demografische Abrüstung“ in Arabien, weil seiner Meinung nach die hohen Geburtenraten in den palästinensischen Gebieten zur Gewalt im Nahen Osten beitragen, wobei viele junge Männer ohne Perspektive für religiös motivierte Gewalt empfänglich seien.
In China fordern Wissenschaftler, Bürgerrechtler und nun auch noch ein regierungsnahes Institut für Bevölkerungswissenschaft das genaue Gegenteil: die „Ein-Kind-Politik“ zu beenden. Ab 2015 sollten alle Paare zwei Kinder bekommen dürfen – und bis 2020 alle diesbezüglichen Beschränkungen ganz aufgehoben werden. Das trifft sich mit einer ganz anderen chinesischen Politik, die darin besteht, dass der Versorgungsstaat sich aus dem „Sozialen“ zurückzieht – dafür jedoch die Familienbanden wieder stärker werden sollen. Diese chinesische Staatspolitik ist der Wunschpolitik in Deutschland ähnlich, wo die Frauen im Durchschnitt auch nur (noch) 1,39 Kinder bekommen – freiwillig: Die politischen Ideen, um diesen demographischen Mangel zu beheben, reichen hier vom „Elterngeld“ über „Kitaplätze“ bis zum Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, der zwar zugibt, dass „Elternschaft keine Bürgerpflicht ist,“ aber „langfristig können wir damit nicht zufrieden sein“. Es muß ein „Kulturwandel“ stattfinden – eine Art Kulturrevolution sogar: „in Betrieben und Kommunen“. Auch die „Arbeitgeber“ müssen ran – und sich mehr um „die private Seite ihrer Arbeitnehmer“ kümmern.
Nicht weniger als eine Kulturrevolution – und zwar gleich eine ganze globale – fordert auch der „Club of Rome“-Berichterstatter Jorgen Randers in seinem zweiten Szenario der Weltentwicklung – diesmal bis zum Jahr 2052. Es wurde kürzlich als Buch veröffentlicht. Der norwegische Klimaforscher hält ein Umdenken in vier Bereichen für dringend geboten, damit wenigstens die Menschheit, wenn schon nicht alle Tier- und Pflanzenarten, bis 2052 überlebt: 1. Sollte sie ihre Kinderzahl begrenzen („Die Ein-Kind-Familie muß hier zur Norm werden“); 2. alle Treibhausgas verursachenden Aktivitäten reduzieren; 3. eine effiziente Energieversorgung vor allem in den Entwicklungsländern organisieren, und 4. sollten die Gesellschaften starke Regierungen akzeptieren.
Jorgen Randers hält ausgerechnet das autoritäre China in diesem Zusammenhang für vorbildlich, weil der chinesische Staatsapparat „die Mehrheit der Bevölkerung am Fortschritt teilhaben läßt, das Gegenteil geschieht in Amerika,“ wo die Gesellschaft es „nicht schafft, die Gewinne gerecht zu verteilen.“ Dort wird „die grosse Mehrheit“ sogar ärmer – und „diese Entwicklung wird sich fortsetzen.“ Der „Club of Rome“-Prognostiker muß derzeit zwar sämtlichen Hauptstadtmedien der Welt Interviews geben, aber sein Plan zur Rettung des Planeten ist noch bescheiden, es geht Jorgen Randers bloß darum, die nächsten – lächerlichen – 40 Jahre rumzukriegen.
Ganz andere Pläne stellte gerade das Berliner „Haus der Kulturen der Welt“ vor: Mit mehreren Millionen Euro will es in den kommenden zwei Jahren – bis 2015 „Umweltschutz-Ideen für die nächsten 250.000 Jahre“ vermitteln bzw. entwickeln. Das Riesenprojekt, an dem wissenschaftliche Institutionen wie die Max-Planck-Gesellschaft beteiligt sind, nennt sich „Antropozän“: Menschenzeit – gemeint ist damit die jetzige, die mit Hilfe der im Haus der Kulturen der Welt von wahnsinnig kreativen Künstlern und Wissenschaftlern entwickelten Umwelt-Pläne schier ewig währen soll; der Projektkurator Christian Schwägerl hält es nämlich laut Berliner Zeitung „für möglich, dass die etwa 250.000 Jahre alte Gattung Mensch ihre Halbzeit noch nicht erreicht hat“. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass es gelingt, dem Publikum „die Verantwortung des Menschen in planetarischen Dimensionen [zu] verdeutlichen.“ Abschließend sei zu dieser ganzen „Debatte“ hier nur noch angemerkt, dass es sich bei all den dazu erwähnten Stimmen – pro und contra mehr Kinder – durchweg um solche von Menschen ohne Menstruationshintergrund – also um Männer – handelt, die sich da als „Experten“ gerieren, wobei sie die Frauen, die die Kinder ja schließlich kriegen oder nicht kriegen sollen, mit keinem Wort erwähnen. Dafür haben sie jedoch die Zukunft der ganzen Art, ja sogar aller Arten, fest im Blick.
P.S.: 1960 lieferten einige US-Wissenschaftler den Nachweis, dass es auch eine Art von „nichtmalthusischer Auslese“ gibt: Bei vielen Tierarten fanden sie einen „selbständigen Regulationsmechanismus bei der Fortpflanzung, unabhängig von der zur Verfügung stehenden Nahrung“. Im Zootechnischen Labor in Jouy stellte man daraufhin Versuche mit Schweinen und Mäusen an. Der Biologe Rémy Chauvin faßte ihre Ergebnisse 1964 (in: „Tiere unter Tieren“) zusammen: „Bei zunehmender Bevölkerungsdichte setzt infolge entsprechender hormonaler Steuerung eine Verminderung der Fruchtbarkeit ein, die schließlich zu einem völligen Stillstand der Fortpflanzung kommen kann…Es gibt also für jede Tierart eine bestimmte Bevölkerungsdichte, ab der ein geheimnisvoller, durch die Drüsen von Nebennierenrinde und Hypophyse wirkender Regulationsmechanismus unerbittlich die Fruchtbarkeit herabsetzt.“
Der französische Entomologe meint: Bei den staatenbildenden Insekten gäbe es solch eine Vermehrungshemmnis jedoch nicht. Dazu scheint auch der Mensch zu gehören, dessen Sozialstaats-Bildung hat jedoch immerhin, in Verbindung mit Verhütungsmitteln und Abtreibungserlaubnis, zu einer vernunftgemäßen Reduzierung der bäurischen Vielkinder-Familie auf eine moderne „Anderthalbkind-Familie“ geführt, was dem deutschen Staat aber nun zu weit geht – er versucht deswegen wie oben erwähnt neue Anreize zu schaffen.

Sowjetischer Trassenpoller. Photo: Peter Loyd Grosse



