Ein altes Khmer-Märchen beginnt so:
Als der Zufall einmal wollte, dass Glück und Unglück persönlich aufeinandertrafen, da fragte Unglück wie aus der Pistole geschossen: »Na, hallo, mein Glück, worin besteht denn eigentlich Eure legendäre Macht, die alle Welt so sehnlich erhofft?« – »Meine Macht«, sagte Glück, »ist das Glück selbst. Ich bin in der Lage, jemanden, der vollkommen verachtet und mitleidlos behandelt wird, in jemanden zu verwandeln, den man liebt, wenn ich in seine Nähe komme«.
Einen Augenblick herrschte Stille zwischen den beiden.
Dann fragte Glück zurück: »Und wie, o Unglück, steht es um Eure Macht?« Unglück erwiderte: »Ich muss nur in die Nähe von jemanden kommen, und sofort wird er verachtet und schlecht behandelt. Selbst ein König fällt so tief, dass er zum Sklaven wird«.
Ohne Frage konnten die beiden Kontrahenten im weiteren Verlauf der Begegnung ausreichend Fallbeispiele für ihre Theorien nennen. Höhenflüge und Unheilstürze märchenhaften Ausmaßes sozusagen.
oo*oOOOOO-oio-OOOOOo*oo
Ob ich an dieser Fabel buddhistische Verhaltensweisen erläutern könne, fragte mich meine Lehrerin.
ICH: Ehrlich gesagt, nein! Mich macht dieser Fatalismus, der in dieser Geschichte anklingt, recht ratlos. Das Glück ist das Glück selbst, das Unglück ist das Unglück selbst; beide scheinen nur aus ihren sozialen Wirkungen zu bestehen. Finster und hell sprüht es nur aus den Augen der anderen. Das mag ja eine antike Khmer-Weisheit sein; mich katapultiert sie aus meinem Umfeld hinaus, versucht mich auf eine Verkomplizierung meiner Persönlichkeit zu verpflichten, auf ergebnislose Endlosigkeit im Rückzug nach innen.
LEHRERIN: Die Alten waren nicht dumm, sie setzten das Fatum über alles. Sie waren fest von der strengen Notwendigkeit alles Geschehen überzeugt; wie also sollten sie sich die Zukunft anders vorstellen als die Vergangenheit?
ICH: Das verstehe ich schon. Aber kann denn so ein Fatalismus ein wirklicher Trost für jemanden sein?
LEHRERIN: Legen die Reisbauern irgendwo auf der Welt ihre Hände in den Schoß?
ICH: Nein.
LEHRERIN: Leiten die Reisbauern aus ihrer Theorie vom unabwendbaren Schicksal ab, dass man kommenden Ereignissen nicht vorbeugen soll?
ICH: Nein, auch das nicht.
LEHRERIN: Sehen Sie. Jeder Erfolg hat vorhergehende Ursachen. Niemand weiß das besser als der Fatalist. Dass man die Schädlinge am Feld zur richtigen Zeit bekämpft hat, dass man die Ernte vor Unwetter geschützt hat … das ist letzten Endes das einzige, was zählt.
Ich schloss die Augen, machte mich blind wie das Fatum. Tatsächlich, der Unterschied, ob ich die Sprechende sah oder nicht, verlor an Bedeutung.
© Wolfgang Koch 2012
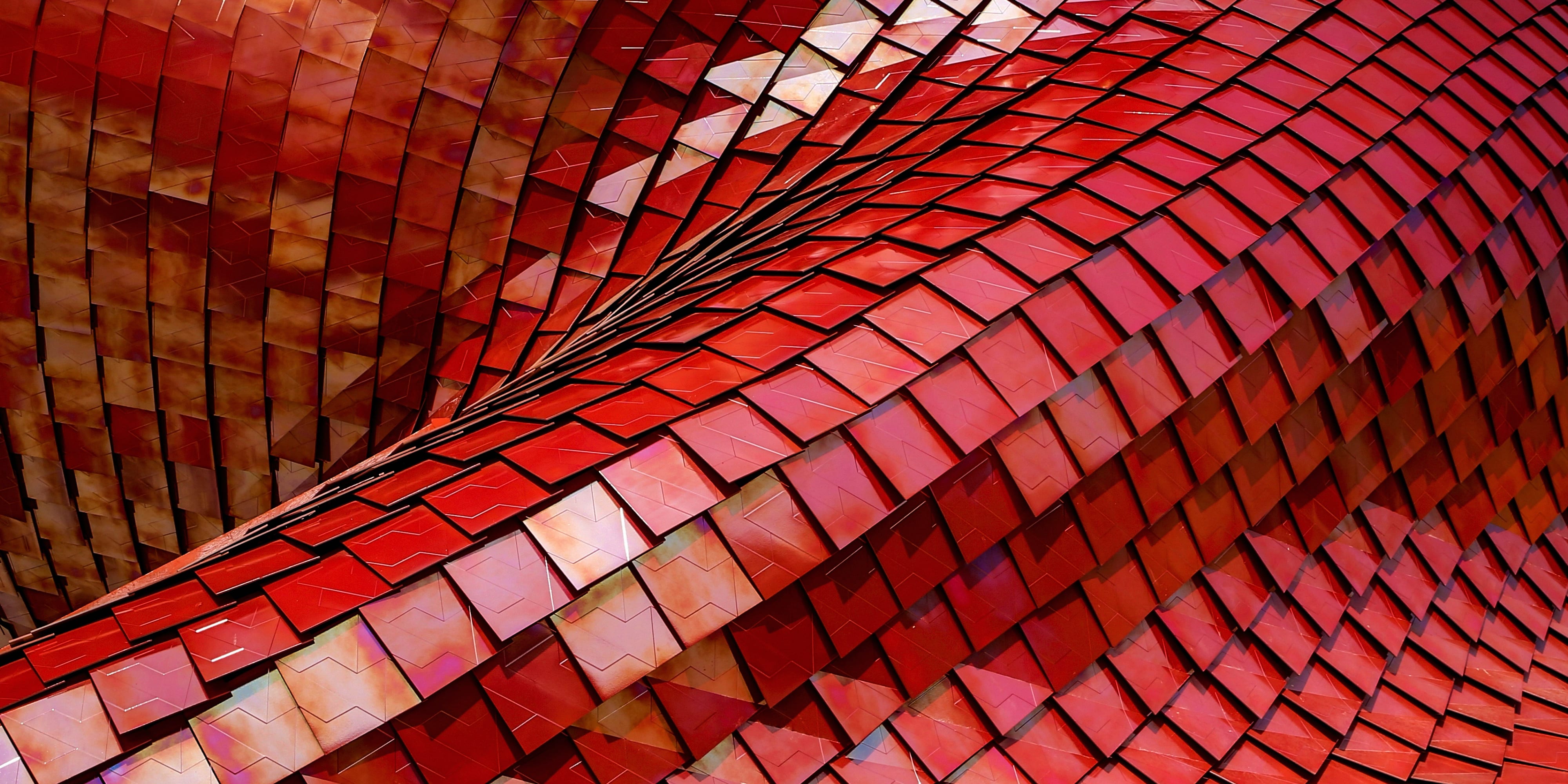



Interessanter Beitrag. Nur weiter so!