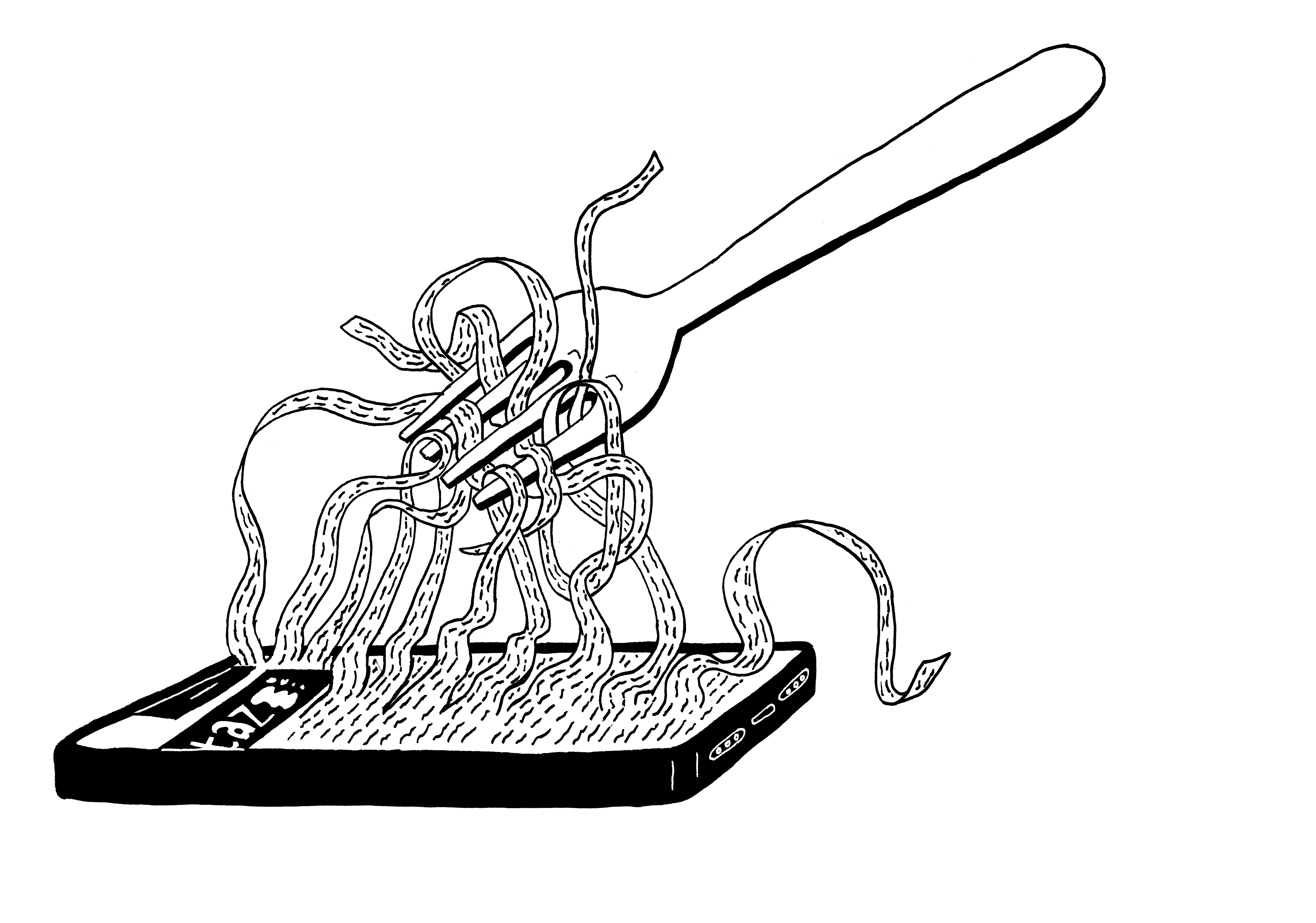Viel ‚Entdeckung‘ und wenig kulturelle Lektürekompetenz ist im Spiel, wo von Gerti Tetzners Karen W. geschrieben wird. Dabei kann der Roman gerade letztere lehren, weil er breite Schneisen in die Literatur- und Kulturgeschichte der DDR legt. Doch gibt er – als wäre das nicht schon überreichlich – mehr als nur eine Bilanzierung der Entwicklung des DDR-Sozialismus nach einem Vierteljahrhundert. Karen W. stößt auf den messerscharfen Grat zwischen Sozialismus und Sozialismus wie auf seine Bruchstellen, nicht zuletzt, um ihre Ausbesserungs- und Erweiterungsmöglichkeiten zu ermitteln. Zwischen Erinnerung, Erfahrung und Erklärung ist sein Verfahren exemplarisch für eine Schreibweise einer bestimmten Entwicklungsstufe im Literatursystem DDR, die sich heute gut gebrauchen ließe.
Annäherung – DDR-Literatur heute veröffentlichen
Klappentexte legen berufsmäßig trügerische Fährten. Der für Gerti Tetzners Karen W. zuständige weiß über die Zusammenfassung der wesentlichsten inhaltlichen Koordinaten hinaus, dass der Roman „durch die DDR-Zensur in Vergessenheit“ geraten sei. Klare Sache: Was gut und heute noch lesbar ist, das war damals verboten, so einfach ist das. Allerdings: Eine Erstauflage von 15.000 Exemplaren und weitere sieben Auflagen in der DDR, diverse Auflagen in der BRD und Übersetzungen auch im nichtsozialistischen Ausland lassen Zweifel aufkommen.
Gemeint sein könnte – Aufbau ist der Gag zuzutrauen – diejenige ‚Zensur‘, die dem hegemonialen Sprechen über die DDR nach 1990 Widersprechendes tilgte, wo es nicht so ganz reinpasste in die Erzählung vom Grau-im-Grauen des Staatssozialismus. Die weiters aufgerufene „Wiederentdeckung“ will da aber nicht so recht passen. Begrifflich mit dem rhetorischen Tropenhelm zugerüstet, unter dem Heutige über Damalige, Männer über Frauen, Westdeutsche über Ostdeutsche bevorzugt operierten, wird vor allem entdeckt, was dem Bekannten anschlussfähig scheint: die verallgemeinerte Sinnsuche und Selbstermächtigung einer Frau im Dissens mit ihrer Lebenswirklichkeit und/oder eine nicht weniger verallgemeinerte DDR-Kritik. Was dann so allgemein vielleicht mehr über die fortgesetzte Unbeholfenheit in der kritischen Auseinandersetzung mit a) der Stellung der Frau, b) in der Literatur, unter c) bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen.
Die Kontaktadelung Tetzners im Verweis auf ihre Beteiligung an „Christa Wolfs sogenannter ‚Weiberrunde‘“ rundet ab, was Verweis auf Zensur und Wiederentdeckung beginnen, um die Wiederveröffentlichung eines Romans aus der DDR, 51 Jahren nach dessen erstem und 35 Jahren nach deren letztem Erscheinen zu legitimieren. Tetzner sei Dank: Der Text ist schlauer als sein Klappentext. Denn er stellt Ansprüche.
Anspruch – DDR-Literatur damals lesen
Literaturgeschichtliche Einordnungsmöglichkeiten für Karen W. über die allgemeine Einweisung in den Wolf’schen Salon hinaus gäbe es reichlich. Es ließe sich etwa fragen, wer eigentlich die Eltern der meist elternlosen Söhne der Post-DDR-Literatur Schulzes, Sparschuhs oder Brussigs sind. Es ließe sich ebenso fragen, wer die Mütter der Töchter sind, die die aktuellen Romane Erpenbecks, Gneuß’ und Rabes bestreiten und wer die meist beiläufigen Frauen der ‚mittleren Generation‘ in den Ost-Familienepen dazwischen sind. Mit Karen spricht eine dieser oft abwesenden Frauen selbst – und ausführlich.
Sie ist längst nicht die Einzige, die sich Mitte der 1970er Gehör verschafft. Ihr Eintritt in die Literaturgeschichte markiert mit den zeitgleichen Veröffentlichungen von Franziska Linkerhand und der Trobadora Beatriz eine Zäsur: dreimal monumentale, grundlegende und unnachgiebige Verhandlungen des Lebens in der DDR, die sich deutlich von einer vorangehenden ‚Ankunftsliteratur‘ unterscheiden. Ebensowenig wie als ‚Frauenliteratur‘ lassen sie sich auf ihre neu gewonnene Subjektivität reduzieren oder gar mit den Produkten der angeblich ‚Neuen Subjektivität‘ zeitgenössischer BRD-Literatur zusammendenken, ohne sie zu beschädigen. Ihnen muss im eigenen Anspruch zu Leibe gerückt werden – als ‚Anspruchsliteratur‘.
Der liegen nicht zuletzt entschiedene Ansprüche der Autor:innen an sich selbst zugrunde, die Tetzner in einem Selbstporträt 1976 – ohne ein einziges Mal in diesem kurzen Text „Ich“ zu sagen – notiert:
Unbestechliches Hinblicken und Hinhören erlernen. Denken statt funktionieren. Nachdenken, zurückdenken, umdenken. Realen Raum abtasten für menschliches Maß. Immer wieder. Erwartungen hervorziehen, benennen, behaupten – in Kenntnis realer Grenzen. Immer wieder. Inmitten allen Lärms ein hörbares Wort finden. Vielleicht.[1]
Zwischen ‚Immer wieder‘ und ‚Vielleicht‘ spannt sich das für Karen W. vielfach beackerte Feld von Ideal und Wirklichkeit. Der mit Tetzner befreundete Literaturwissenschaftler Hans Kaufmann[2] gelangt in seiner Auseinandersetzung mit dem Roman zu einer präziseren Erkenntnis: „Das ins Bild gesetzte Leben ist nicht dazu da, Ansichten zu bekräftigen, vielmehr werden Ansichten dem Leben ausgeliefert und je nachdem erhärtet oder verworfen, konkretisiert oder modifiziert.“[3] Derart werde aus dem scheinbar einfachen „Anliegen einer Selbstbefragung“ letztlich „beinahe das große Sujet einer Bilanz unserer Entwicklung.“[4] Es geht auch um Ideal und Wirklichkeit – aber nicht weniger um das Selbst inmitten dieser ‚unsrigen‘ Entwicklung, um das ‚Ich‘ und sein Verhältnis zum ‚Wir‘. Tetzners Selbstporträt macht dieses Verhältnis von Individuum und Kollektiv hinsichtlich ihrer gemeinsamen Geschichtlichkeit, Gegenwart und Erwartungen in ihrem dialektischen Gewordensein deutlich:
Nicht selbst in Krieg und Faschismus verwickelt, dennoch nicht wirklich davon befreit: während aller bewußt gelebten Jahre blieben auf der kleinen Erde Krieg und Konzentrationslager, erschien westlich „Rommel der Wüstenfuchs“ in Neuauflage, schwärmten hiesige Biertischrunden immer noch über ehemalige Kriegsschauplätze aus, plappern junge Münder noch das Wort Pollacken. Inmitten sehr gegenwärtiger und nützlicher Tagesläufe. Trotzdem aufwachsen in maßlosen Erwartungen und maßloser Bereitschaft zum Andersmachen von Grund auf.
Kaum damit begonnen und unter Wissenden und Gläubigen immer wieder bis zur Erschöpfung damit beschäftigt – das meiste noch Erwartung –, ersticken Menschen schon in Abgasen und Abwässern und Abfällen einer Zivilisation nach fragwürdigem Maß und chemisieren und maschinisieren und funktionieren dennoch weiter, bis zur Erschöpfung beschäftigt für und mit dem neuesten Auto, dem ältesten Vertiko. Trotzdem Kinder gebären, Erwartungen erneuern.[5]
Für Kaufmann ist klar, dass der daraus resultierende „allgemeine Inhalt dieses Kunstprinzips“ nicht weniger sei als „sozialistischer Demokratismus.“[6] Hier lässt sich erahnen, wie Literatur, Literaturkritik und Literaturwissenschaft in der DDR nicht allein von der einheitsparteilichen Kulturpolitik geknechtet werden, sondern sich auch eigensinnig gegen deren festgefahrene Schlagworte in Stellung bringen, ohne zugleich den Selbstanspruch an eine sozialistische Literatur aufzugeben.
Kurz darauf argumentiert etwa Annemarie Auer in ähnlicher Tendenz und qualifiziert Irmtraud Morgners Trobadora zu nichts weniger als der zeitgenössisch angemessenen Entwicklungsstufe sozialistisch-realistischen Schreibens.[7] Die Frauen der nun Bilanz ziehenden ‚mittleren Generation‘ der 1930er-Jahrgänge, so Auer, seien zwar de jure und ökonomisch gleichgestellt mit dem jungen Staat erwachsen geworden. Eine konsequente kulturelle Gleichstellung sei jedoch ausgeblieben. Auf dieser Grundlage manifestiere sich in der alltäglichen Erfahrung von Frauen – und idealiter in ihren Texten – eine der drängendsten Aufgaben gesellschaftlicher Entwicklung, womit das abgeleitete Sujet, „ersichtlich sozialistisch realistisch“[8] werde: die Notwendigkeit einer kulturellen nach der ökonomischen Revolutionierung.
Auers Überlegungen anhand von Morgners Roman ließen sich unschwer auf Tetzners Text projizieren. Darauf sei an dieser Stelle verzichtet und ebenso auf den Nachweis, dass Kaufmanns und Auers Argumentationen sich ebenso mit den Vokabularien des mittleren Lukács, mit Tendenz und Parteilichkeit, Erzählen oder Beschreiben in Einklang bringen ließen. Kaufmann und Auer erproben marxistische Ästhetik am Gegenwartstext. Sie zeigen, dass sich die Auseinandersetzung mit Karen W. nicht allein darum drehen kann, die Biografien von Autorin und Hauptperson miteinander und diese beiden mit einer Handvoll Vorannahmen zur Geschichte der DDR abzugleichen. Dann bleiben Weltbild und Text zwar bequem vermittelt, aber Welt und Roman nicht annähernd angemessen erklärt. Die Ansprüche der Generation Tetzners und ihrer Literatur sind ernstzunehmen und für den Roman in Anschlag zu bringen.
Denn dieser zeigt nicht weniger als einen dynamischen und entwicklungsfähigen sozialistischen Realismus, wie er abseits der kulturpolitischen Verschlagwortung hätte entwickelt werden können: als Darstellung konsequenter Suchbewegungen nach dem Eigenen auf dem Boden des zeitgenössischen Sozialismus, dessen Defizite aufzeigend, ohne seine Potenziale sogleich infrage zu stellen. Das Darstellungsverfahren in Karen W. erscheint so als sozialistisch realistische Schreibweise – ohne Bindestrich – in Verteidigung gegen dessen politisch-ästhetische Sachwalter. Es ist analog gegen seine ‚Entdecker‘ zu verteidigen, die heute wie damals vorschnell „herauslesen, was gegen die DDR gerichtet war“ und dabei „den breiteren Ansatz“ übersehen, in den dieser Anspruch eingebettet ist: „dass man ein anderes Leben will“, wie Tetzner selbst ihre Erfahrungen mit westdeutschen Lesarten auf den Punkt bringt.[9]
Ambivalenz – DDR-Literatur damals schreiben
Wie sieht das nun im Roman aus? Oberflächlich zunächst nach einem zwischenmenschlichen Alltag, in dem man längst angekommen ist: „Ich warte auf ein Wideranschwellen seiner Schnarchlaute.“ (5) So weit, so fürchterlich, aber wenn eine erste Seite den Kern aller folgenden Handlung enthalten soll, haben wir das hier vorbildhaft. Nach acht Beziehungsjahren sind Karen und Peters zu Teilnehmern aneinander verkommen, während Karen, knapp dreißig, schmerzlich ihr Leben versickern spürt und im Radio der Sechstagekrieg beginnt. Karens „Grübeln, wie und warum wir so geworden sind und wie wir hätten sein können“ (5) motiviert die folgende Handlung und zu allererst ihren Ausbruch aus den klar abgezirkelten Sicherheiten, auf deren Fundamenten ihr Ausbruch allerdings erst möglich und nötig wird.
Disqualifiziert wird fürs Erste der Gang „in die Produktion zur Bewährung“ (8) – und damit auch ein etabliertes Erzählmuster der Sinnsuche innerhalb der nun schon gar nicht mehr so neuen Verhältnisse. Karens Suche ist schwieriger. Es geht ihr darum, zu Erklärungen zu kommen, die vorerst nicht ihr Verhältnis zur Gesellschaft, sondern ihr Verhältnis zu sich selbst und zu Peters greifbar machen. Stand Juni 1967, ex negativo: „Was ich nicht wollte, konnte ich vielleicht erklären“, nämlich dass „ich meine Erfahrungen vergesse – und doch am nächsten Tag dieselben mache“ (9). Erklärung nicht möglich, Erfahrung arretiert – was bleibt? Der Weg zur Erinnerung.
Auf der Suche nach Erklärungen kehrt sie zurück an ihren eigenen Ursprung, versucht es wenigstens, doch „alles ist anders als in Geschichten der Heimkehr“ (12) – auch in thüringischen Käffern vergeht die Zeit. Ablagerungen der Vergangenheit in der Gegenwart finden sich trotzdem zuhauf und mit ihnen findet Karen zu Erinnerungsfragmenten, die sich nach und nach zu einer vorläufigen Totalität ergänzen. Karen nähert sich auf dem Weg der Einsicht in gewisse ökonomische Notwendigkeiten der Dorfgesellschaft an – irgendwo muss schließlich auch im beinah entwickelten Sozialismus Geld zum Leben herkommen. Die Erfahrung der dörflichen Wirklichkeit, die auch als Naturerfahrung stilisiert wird, stößt Karen immer wieder auf den Korrekturbedarf ihrer scheinbar stichfesten Erinnerungen. Daran hat auch ihre siebenjährige Tochter Bettina wesentlichen Anteil, die ohne Rückhalt in Erinnerung grundsätzliche Erklärungen für scheinbar Selbstverständliches alltäglich einfordert und Karens Selbstbefragung in Gang hält.
Bei allen Zweifeln bis hin zur „Selbstzerfleischungswut“ (108) – Karens drängende Infragestellung gründet auf gründlicher Selbstsicherheit: „Ich weiß, was ich riskiere“ (41). Ihre Verunsicherung ist keine destruktive, sondern eine selbstbewusste, die weiß, dass angemessene Erklärungen ohne Skepsis nicht zu haben sind. Ihr Fragen ist schießt mitunter übers Ziel hinaus. Das Ziel heißt aber immer: eigene Erkenntnis. Karens Suche danach beginnt bereits in ihrer Studienzeit: „Wenn man sich noch nicht durchfindet und nichts Eigenes dagegensetzen kann und dann … Gedanken ausleiht … Beginnt man sich da nicht zu verleugnen?“ (169) Sie muss anerkennen, dass das nicht immer der Fall ist. Dafür sind ihre Fragen zu substanziell und werden, einmal an der Substanz, immer komplexer. Will man zur belastbaren Erklärung durchdringen, kann man sich zwar nicht zufriedengeben mit fremden Fragen und Antworten im Modus „das ist -istisch, das ist -astisch“ (49), aber Denken in anderen Köpfen ist unerlässlich.
Das „nackte zielgerichtete Denken“ (43) in festen Schemata ist eher Hindernis in der Vermittlung von Erinnerungen und Erfahrungen für bessere Erklärungen. Es geht um die Erkenntnis des Lebens selbst, am Leben selbst, im Leben selbst. Erinnerungen sind hier historisierte Erfahrungen, die immer wieder von aktuelleren Erfahrungen umgewälzt und korrigiert werden. Diese Korrekturschleifen fördern neue, bessere Erklärungsansätze zutage, die, selbst wo sie zu noch nicht vollends befriedigend sind, Fortschritte markieren. Sie können selten vollkommen sein, weil dieser Prozess sich in Permanenz erhält: Erfahrungen werden zu Erinnerungen, neue Erfahrungen in veränderten Lebenswirklichkeiten korrigieren sie – Schleifen, die sich aber nicht im immer wieder gleichen Schnittpunkt kreuzen, sondern Unwucht geben, die Fortschritt ermöglicht, auch weil sich manche Erklärungen als gültig oder nicht vollends ungültig erweisen. Manchmal genügt es, mit der Quantität der Fragen neue Qualitäten der Erklärungen zu erzwingen. An anderen Stellen muss neu angesetzt und anders gefragt, manchmal schlicht abgewartet werden, bis Leben, Erinnerung, Erfahrung und die richtige Frage zur Passung kommen.
Dieser Prozess ist jedoch keiner, erkennt Karen nach und nach, der nur aus sich selbst heraus erfolgen kann. Er erfolgt buchstäblich von Angesicht zu Angesicht mit anderen Subjekten dieses geteilten Lebens. Und das erfordert „[i]mmer wieder rückhaltlose Offenheit und Vertrauen“ (184), für die die Erfahrung der Geburt im Übrigen besonders privilegiere, bei der frau „jedes Zipfelchen vom Ich rückhaltlos einsetzen“ (225) muss. Mensch und also Frau besonders besteht nur in Bezug zu anderen. Derart gelangt Karen nach und nach vom Ich zum Wir oder genauer: zum Ich im Wir, indem sie ihr subjektives Gewordensein durch zahllose andere Subjekte erkennt – durch Gesellschaft eben. Und dadurch zur Erkenntnis gewisser Objektivitäten gelangt. Es gilt rückhaltlos: Erkenntnisfortschritt folgt nicht nur aus der „Partnerschaft des Erkennens“ (205), sondern auch aus der Erkenntnis der Partnerschaft dabei. Die Erklärung für das eigene Leben gibt es nur auf dem Weg der Erklärung des Lebens aller. Wer zu sich kommen will, muss erstmal zu den Anderen kommen und dabei die eigenen Erinnerungen und Erfahrungen mitbringen.
Schwierig wird’s, wenn diese Anderen sich dieser Kollektivität verweigern oder sie sich in Ritualisierung entfremdet, woran auch die Beziehung zu Peters scheitert – symptomatisch für die gesellschaftliche Partnerschaft der frühen Jahre der DDR: „Wir hatten doch schon mal das Gefühl des Aufbruchs. Warum konnten wir es nicht bewahren?“ Auf die Diagnose folgt die Behandlungsanweisung: Weiterfragen, den Anderen verstehen lernen und das „Leben, von dem er geführt wird“ (232), miteinander Reden und erkennen „wie oft wir über Schicksale anderer redeten, um über uns zu reden.“ (277)
In den Schicksalen anderer wird das gemeinsame Leben und dessen Geschichte erkenntlich. An ihnen entlang lesen wir nicht nur scheinbar exakte äußerliche Bestandsaufnahmen vom Alltag der DDR zwischen LPG und Universität von den späten 1940ern bis Ende der 1960er, sondern gleichermaßen ein Stück Mentalitäts- und Kulturgeschichte. An Peters und seinen Kolleg:innen wird exemplarisch geschildert, wie sich akademische Diskussionen von Positionierungsfragen um Sozialismusentwürfe zu Postenfragen im Apparatsozialismus und zunehmend vom Leben abseits davon entfremden. Demgegenüber wird in den Lebensläufen der Dorfbewohner:innen anschaulich, wie man auf dem Land in diesem Staatssozialismus ankommt.[10] Hier wie dort geht es um nichts weniger als die Frage danach, was diese Ankunft mit den Leuten macht und wie sich das auswirkt. Nicht nur Karen wird dreißig und nicht nur sie fragt sich: „Was steht nun eigentlich unterm Strich?“ (239)
Karen steht als eine Art ‚mittlere Heldin‘ in den Entwicklungen dieses Landes, dass sie sich – dann also doch – in einer Art ‚Bewährung in der Produktion‘ aneignet: „Ich hab viele Wochen in seine schwere lehmige Erde gegriffen, sie gerochen und beschimpft, und jetzt liegt sie locker und glatt und groß da; die ganze braune Weite des Landes gehört mir.“ (82) Als „alltäglicher Mensch“ gehört sie „zu allen Angelegenheiten dieses Landes“ (219), das sich rasant verändert. Mithin so schnell, dass die Gefahr besteht, dass Menschen und Ideale nicht hinterherkommen: „Unsere Zeit kommt nicht lange mit Göttern wie Wirtschaft und Technik aus.“ (239)
Verhalten kommt aus Verhältnissen. Die sind gewachsen und wachsen weiter. Nur wie – und wie kann das beeinflusst werden von Leuten, die selbst Resultat dieser Verhältnisse sind? Aus der Erklärungssuche nach dem Individuum im Kollektiv, um das Eigene zu finden, ergibt sich die Erklärungssuche nach dem Gewordensein der Gegenwart, um Möglichkeiten zu deren Weiterentwicklung zu finden. Der Lösungsansatz, auf den Karen stößt, heißt: kulturelle Revolutionierung der Verhältnisse nach ihrer notwendigen, aber unzureichenden sozialen und technischen Umwälzung.
Wie die zu machen sein könnte, erprobt Karen im Selbstversuch und in Auseinandersetzung mit dem Leben vis-à-vis. Doch auch die Suche nach gültigen Erklärungen hierfür ist Kollektivarbeit und erfolgt auch auf anderen Wegen, wie die Einblicke in Peters akademische Arbeit zeigen. Der perspektiviert dieselbe Frage in die langfristige historische Entwicklung und sucht nach dem Verhältnis von subjektiven Persönlichkeiten und ihrem Einfluss auf objektive geschichtliche Vorgänge: „Ich meine, die Revolutionen vieler Jahrhunderte sind nicht vollendet mit sozialen Veränderungen. Das Wichtigste beginnt erst danach: Befreiung des Menschen als Persönlichkeit.“ (171) Der Versuch der Befreiung des Menschen als Persönlichkeit anstelle der Entgrenzung des offiziellen Menschen nach den Ansprüchen einer zwar politisch und technisch revolutionierten, aber kulturell noch durchaus gestrigen Gesellschaft steckt bereits in Karens Befreiungsschlag, der die Romanhandlung und ihr unablässiges Fragen in Gang setzt. Sie ist, das stellt der Roman bei allen gravierenden Fragen nirgends infrage, nur auf Grundlage des bereits Erreichten und nur gemeinschaftlich möglich.
Abspann – DDR-Literatur heute lesen
Eine abschließende Erklärung dafür, was das „bloß für eine Zeit und ein Land um mich rum“ (173) waren, liefert Karen W. konsequenterweise nicht. Ohnehin ergeben sich aus jedem „anderen Aufwachsen und Leben in anderer Zeit“, wenngleich am selben Ort, „auch andere Fragen“ (318). Ihr Erkenntnismodus ist aber auch für diese neuen Fragen anwendbar und notwendig, denn sonst, weiß Peters, „können wir uns vor der Geschichte einpacken lassen.“ (176)
Das gewichtigste Resultat von Erinnern–Erfahren–Erklären ist jedoch schließlich, dass es mit Fragen und Erklärungen nicht getan ist, sondern auch ein darauf bauendes Handeln braucht. „Wissen ohne Handeln“ muss sonst „tauber Samen“ (360) bleiben. Wer „etwas tut, mit dem wird auch etwas getan“ (272) – die Revolution macht ihre Revolutionär:innen, weil die die Revolution machen, wenn sie sie denn machen. So viel Dialektik muss sein: Geschichte wird gemacht, von Menschen, die die Geschichte macht.
Dass das Ideal der Wirklichkeit immer hinterherhinkt, ist keine Ausrede dieses Ideal deswegen zu begraben. Am vorläufigen Ende steht wieder die Erinnerung. Erinnert wird der „alte Traum“ vom „ganz anders miteinander leben“ (329f.), der darauf hinweist, dass der mehr oder weniger entwickelte Sozialismus eben doch auch nur ein Zwischenschritt ist auf etwas anderes hin. Was mitunter Kommunist:innen den allzu fantasielosen Funktionäre eines skelettierten Sozialismus in Erinnerung rufen müssen, wie es die abschließende Anekdote von der ‚legendären Margarete‘ zeigt.
Tetzner lässt Karens Erkenntnissuche nicht enden, nur die Erzählung davon kommt zum Ende, bezeichnenderweise im Frühjahr 1968. Damit rettet der Roman nicht nur die Hoffnungen eines Aufbruchs nach 1945 in die erzählte Zeit der späten 1960er, sondern auch in seine Erscheinungszeit Mitte der 1970er. „Immer wieder muss man’s drauf ankommen lassen“ (137) – vielleicht ist Tetzners Roman gerade damit nicht nur sozialistisch realistisch, sondern zeigt, wie die ihm verwandten Romane, was ein kommunistisches Erzählen sein könnte.
„Es wird oft als normal empfunden, daß angesichts von Realitäten Träume und Veränderungsvorschläge immer mehr abgebaut werden. Ich halte das nicht für normal. Große Ansprüche an das Leben sind nicht als Pubertätserscheinungen abzutun.“[11] Angesichts heutiger Realitäten traumhaft, dass solche Sätze mal in der Für Dich standen und Autorinnen solche Antworten parat hatten. Das Erzählen, dass aus dieser Haltung zur Wirklichkeit folgt und das, wovon es erzählt, können wir heute ganz gut gebrauchen. Es aus der Erinnerung geholt und der Erfahrung und Erklärung zugänglich gemacht zu haben, ist der Verdienst der Wiederauflage bei Aufbau. Man muss es nun lesen und könnte es auch schreiben lernen. Gerti Tetzners Karen W. gibt das dafür vielleicht Notwendige an die Hand.
(Gerti Tetzner: Karen W., Aufbau Verlag Berlin 2025)
[1] [Selbstporträt Gerti Tetzners]. In: Bestandsaufnahme. Literarische Steckbriefe. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag 1976, S. 106f. hier S. 107.
[2] Vgl. das der Neuauflage beigefügte Interview „In dem Moment, in dem man sich nicht mehr hinterfragt, da wird etwas starr und verliert an Leben“. Gerti Tetzner im Gespräch mit Carsten Gansel. In: Gerti Tetzner: Karen W. Berlin: Aufbau 2025, S. 371–398, hier S. 376.
[3] Ein Vermächtnis, ein Debüt. Brigitte Reimann: „Franziska Linkerhand“; Gerti Tetzner: „Karen W.“ In: Eva Kaufmann/Ders.: Erwartung und Angebot. Studien zum gegenwärtigen Verhältnis von Literatur und Gesellschaft in der DDR. Berlin: Akademie 1975, S. 193–215, hier S. 194.
[4] Ebd., S. 207.
[5] Tetzner: [Selbstporträt], S. 106f.
[6] Kaufmann: Ein Vermächtnis, ein Debüt, S. 215.
[7] Vgl. Annemarie Auer: Trobadora unterwegs oder Schulung in Realismus. In: Sinn und Form 28 (1976), H. 5, S. 1067–1106.
[8] Ebd., S. 1093.
[9] Gansel/Tetzner: Interview, S. 384.
[10] Aufschluss über den komplexen Strukturwandel und die Vielzahl zeitgenössischer Erfahrungen im ländlichen DDR-Alltag gibt das von Josefa Baum, Caroline Böttcher und Luise Meier initiierte Projekt Lexikon der Erinnerungen: https://lexikon-der-erinnerungen.de/ , zuletzt abgerufen am 15.12.2025.
[11] Gedanken zu Karen W. Gespräch mit Gerti Tetzner. In: Für Dich 50/1974, S. 30; zit. n. Kaufmann: Ein Vermächtnis, ein Debüt, S. 215.
Tim Preuß schreibt akademische und andere Texte, meist über linke Literatur- und Kulturgeschichte.