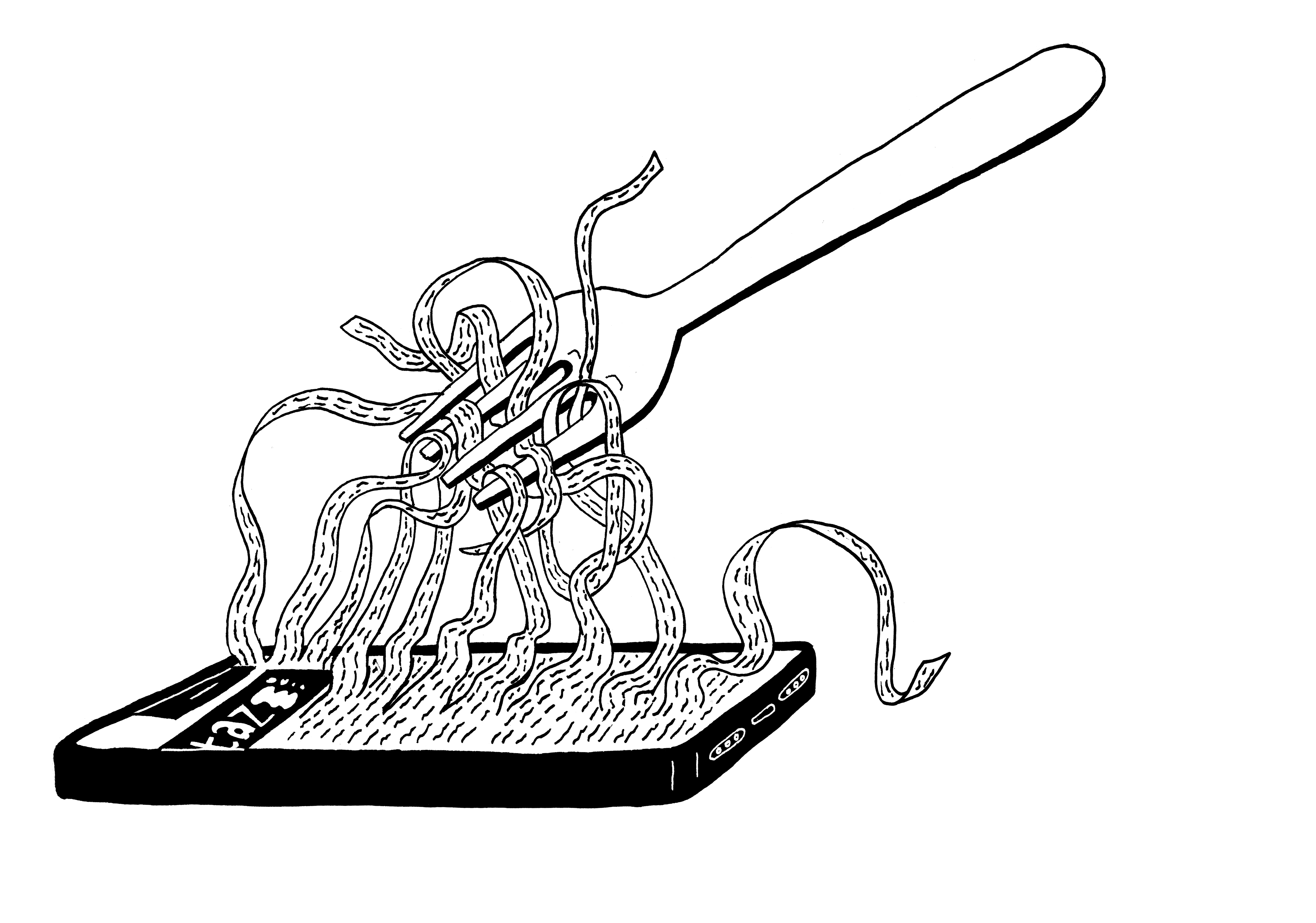(Erster Teil: Hurra, die Welt geht unter!)
(Zweiter Teil: Der Zusammenhang zwischen den Krisen)
Um uns herum wird an vielen Orten um die Zukunft gekämpft, von vielen unterschiedlichen Gruppen und Bewegungen. Diese Kämpfe werden von sehr unterschiedlichen Leuten geführt, die aus unterschiedlichen Hintergründen kommen und die das, was sie da tun, oft unterschiedlich nennen. Aber alle Kämpfe, die wirkliche Kämpfe um die Zukunft sind, haben doch ein paar Gemeinsamkeiten:
Es sind solidarische Kämpfe: Es sind Kämpfe, die von dem Gedanken getragen sind, dass jede das haben sollte, was sie zum Leben und zu ihrer Entfaltung braucht, auch wenn das manchmal unterschiedliche Sachen sind. Dass Freiheit nur Freiheit ist, wenn auch jede die Möglichkeiten hat, diese Freiheit zu leben und sich die eigene Freiheit in der Freiheit der anderen verwirklicht.
Es sind freiheitliche Kämpfe: Es sind Kämpfe, in denen die Individuen nicht nur Mittel für einen Zweck sind. Sie zielen nicht nur darauf ab, Menschen, als Masse zu verwalten oder als Wähler*innen für diese oder jene Sache zu gewinnen. Sie respektieren und verteidigen die Freiheit der Einzelnen gegenüber dem Kollektiv. Gleichzeitig fordern sie diese Achtung der Freiheit auch von den Einzelnen ein. Eine Freiheit dazu, andere auszubeuten oder ihre ökologischen Lebensgrundlagen zu zerstören, kann es nicht geben.
Es sind konkrete Kämpfe: Es sind Kämpfe, die um etwas Konkretes geführt werden, das man braucht, um eine Zukunft und Lebensperspektiven zu haben. Das können Wohnorte sein, Lebensmittel, Technologien, Infrastrukuren für Gesundheit und Energieversorgung oder Kämpfe darum, wie und was gearbeitet wird und wem die Produkte der Arbeit gehören.
Die Menschen, die diese Kämpfe führen, haben dafür ganz unterschiedliche Namen. Manche beziehen sich auf die alte antiautoritäre Arbeiter*innenbewegung, den Anarchosyndikalismus und den kommunistischen Anarchismus. Andere führen ähnliche Kämpfe mit ähnlichen Ideen, sie verorten den Ursprung dieser Ideen aber in 500 Jahren antikolonialem Widerstand. Wieder andere sind vor dem Hintergrund der Entwicklung des Internets und der Digitalisierung auf dieselben Ideen gekommen.
Folgend sind einige Beispiele solcher Kämpfe versammelt. Zusammen sind sie vielleicht ein Bild des Ursprungs einer neuen Welt, die gerade in den Rissen und Nischen der sterbenden Weltordnung entsteht. Vielleicht sind sie auch nur eine Momentaufnahme, die bald von Wellen faschistischer Zerstörung überrollt wird. Wahrscheinlich beides. Man kann es nicht wissen, bevor man kämpft.
Wasserversorgung
Wasserknappheit in vielen Regionen ist schon jetzt eine Folge des Klimawandels. Diese ohnehin stattfindende Verknappung wird noch verschärft werden durch die Privatisierung des Wassers, die es Unternehmen wie Nestlé ermöglichen soll, auch aus dem katastrophalen Zerfall unserer Lebensgrundlagen noch Profit zu schlagen. Dabei gibt es aber eine Verschiebung in der Zeitlichkeit: das, was in vielen Kernregionen der Kapitalismus noch bedrohliche Zukunft ist, ist in den kolonialisierten Regionen schon immer Realität. Das heißt aber auch, dass es Menschen gibt, die schon viel Erfahrung in Kämpfen um die gerechte Verteilung knapper Lebensgrundlagen haben. Beispielhaft dafür steht der Wasserkrieg von Chochabamba, einer Auseinandersetzung, die in Bolivien zu Anfang des Jahrtausends stattgefunden hat.
Bolivien war lange von Geldgeberinnen wie dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank abhängig. In den neunziger Jahren beschloss der IWF im Rahmen einer generellen neoliberalen Neuausrichtung, weltweit die Privatisierung der Wasserversorgung durchzusetzen. Die Kreditvergabe an Länder wie Bolivien war von da an daran geknüpft, dass diese Initiativen zur Privatisierung der Wasserversorgung in Angriff nahmen. Die Wasserversorgung der Stadt Cochabamba wurde in einem Prozess, der eigentlich gegen damals geltendes Recht verstieß, an die Firma Aguas del Tunari überschrieben, ein Konsortium verschiedener internationaler Konzerne. Durch die Verabschiedung eines neuen Gesetzes wurde der Vertrag mit Aguas del Tunari legalisiert. Dieses Gesetz beschränkte sich nicht auf die staatliche Wasserversorgung: auch das Wasser, dass aus selbstorganisiert gegrabenen Brunnen und Quellen gewonnen wurde, war ab diesem Zeitpunkt Eigentum der Firma Aguas del Tunari. Als Antwort auf dieses Gesetz wurde die Coordinadora en Defenso de la Vida y el Agua (Koordinierung für den Schutz des Lebens und des Wassers) gegründet, die den Kern des Widerstandes gegen die Wasserprivatisierung bildete. Die Preise, die die Haushalte für ihre Wasserversorgung entrichten mussten, erhöhten sich schlagartig um bis zu 300%. In Bolivien lebte ein Großteil der Bevölkerung von weniger als 2 Dollar pro Tag, die Konsequenzen dieser Preissteigerung waren katastrophal. Die Umstellung bedeutete nicht nur einen einfachen Anbieterwechsel. Die kommunale Wasserversorgung basierte in den ärmeren Vierteln, in denen große Teile der indigenen Bevölkerung wohnen, nicht auf einer zentralisierten Infrastruktur, sondern auf gemeinsam gegrabenen Brunnen und selbst verlegten Leitungen. Diese wurden zum Teil im Rahmen von Polizeieinsätzen lahmgelegt, zum Teil wurde von da an auch auf Wasser aus solchen Quellen Gebühren erhoben. Die ärmeren Gemeinden wurden von ihren bisherigen Wasserquellen abgeschnitten. Denn wenn das Wasser einem Konzern gehört, ist jede, die sich ihren eigenen Brunnen gräbt oder Wasser aus Quellen oder Flüssen bezieht, plötzlich eine Diebin. So wurde ein Wassermarkt künstlich geschaffen. Die darauffolgenden Ereignisse werden als Wasserkrieg von Cochabamba bezeichnet. Im Januar des Jahres 2000 kam es zu ersten größeren Protesten gegen die Wasserprivatisierung. Unter den Demonstrant*innen waren Regantes (selbstorganisierte Klempner*innen), gewerkschaftlich organisierte Arbeiter*innen im Ruhestand, Anarchist*innen, Cholitas, Straßenverkäufer*innen, sweatshop Arbeiter*innen und Straßenkinder. Die zentralen Plätze wurden besetzt und die Ausfallstraßen mit Barrikaden blockiert. Die Stadt wurde durch einen viertägigen Generalstreik lahmgelegt. Ab dem 4. Februar 2000 wurden neben der Polizei auch Einheiten des Militärs gegen die Demonstrant*innen eingesetzt. In den darauffolgenden, zwei Tage andauernden Kämpfen wurden über 100 Menschen verletzt. Im April wurden die zentralen Plätze von Cochabamba erneut besetzt. Die Proteste weiteten sich auf andere Teile des Landes aus. Es ging nicht mehr nur um die Wasserversorgung von Cochabamba, sondern auch um Löhne, Arbeitslosigkeit und verschiedene ökonomische Probleme. Präsident Hugo Banzer verhängte den Ausnahmezustand und gestattete den Einsatz scharfer Waffen gegen die Demonstrant*innen. Aber obwohl es mehrere Tote gab, konnte der Widerstand nicht gebrochen werden. Nachdem ein Video von der Ermordung des Schülers Victor Hugo Daza durch einen Angehörigen des Militärs während einer Demonstration im Fernsehen übertragen wurde, kam es zu einem massiven Aufstand. Die Angestellten des Konsortiums von Aguas del Tunari mussten aus der Stadt fliehen und der Gewerkschaftsführer Oscar Oliviera unterzeichnete mit der Regierung ein Abkommen, das die Kündigung des Vertrages mit Aguas del Tunari und die Übertragung der Wasserversorgung von Cochabamba an einen Zusammenschluss von Basisbewegungen garantierte.
Eine massive Verschlechterung der Wasserversorgung konnte zwar abgewendet werden, die Wasserversorgung in Cochabamba und anderen Städten Boliviens ist aber weiterhin desolat. Auch die Wahl des Gewerkschaftlers Evo Morales zum Präsidenten im Jahr 2005 hat daran wenig geändert. Oscar Oliviera, der im Aufstand von Cochabamba eine prägnante Rolle gespielt hat, hat dazu folgendes zu sagen:
„Zwölf Jahre sind seit dem Wasserkrieg vergangen. Wir haben jetzt eine Regierung unter Evo Morales, die aus dem Wasserkrieg hervorgegangen ist. Evo Morales und sein Mitstreiter Garcia Linera sind eng verbunden durch den Wasserkrieg. Das Wasserthema sollte in Hinsicht auf die Rechte der Natur und der Mutter Erde ganz oben auf der Agenda stehen, aber unter der Regierung Morales ist die Wasserfrage nicht mehr aktuell. Sie ist bei Morales von der Tagesordnung verschwunden. […] Bevor Morales an die Macht kam, wurde ich von ihm als Abgeordneter, als Senator vorgeschlagen. Als er dann Präsident wurde, schlug er mich als Arbeitsminister vor. Zwei Jahre später bot er mir das Amt des Wasserministers an. Ich lehnte damals immer ab, da ich bei Morales nicht die Bereitschaft sah, einen Staatsapparat zu demontieren, der jeden, der darin mitarbeitet, zum Dieb und Lügner macht und der nicht für die Menschen arbeitet. Ich sagte zu Morales, dass ich mich nicht ändern werde wie die, die dann in die Regierung eintraten. Der Staatsapparat müsse auseinander genommen, den Menschen geöffnet und die Macht an das Volk gegeben werden.“
(zitiert nach kontext.tv)
Güterproduktion
Wenn man davon schreibt, dass man auch vom antiautoritären Teil der alten Arbeiterbewegung für den Kampf um die Zukunft lernen kann, denkt jede natürlich sofort an zwei Sachen: den Klassenkampf und den Kampf um die Produktionsmittel, also dem Kampf um die Fabrik. In den alten Vorstellungen von Sozialismus aus der Zeit des damals noch dramatisch wachsenden Industriekapitalismus glaubte man, dass das der zentrale Hebel ist, um eine bessere Gesellschaft zu errichten. Heute wissen wir, dass das allein nicht gereicht hat. Ohne geht es aber auch nicht. Denn zum einen ist die Güterproduktion einer der besten Punkte, um in die zerstörerische Maschine des Kapitalismus einzugreifen. Zum anderen wird auch eine überlebensfähige Gesellschaft noch Güter produzieren müssen, wir können also die Produktionsmittel nicht einfach ignorieren. Aber wie kann heute in unserer Zeit der Kampf darum geführt werden? Ein Beispiel dafür kommt aus Argentinien.
In Argentinien kam es in den 90er Jahren zu grundlegenden neoliberalen Strukturreformen, die eine massive Verschlechterung der Lebensbedingungen und eine Währungs- und Wirtschaftskrise zur Folge hatten. Die bekannteste Reaktion darauf bildete der Aufstand von 2001, als die Argentinier*innen unter dem Motto „Que se vayan todos!“ (Sie sollen sich alle verpissen!) in einer Woche fünf Regierungen hintereinander aus dem Amt jagten. Doch es gab nicht nur Proteste auf der Straße. Die Wirtschaftskrise hatte die Schließung vieler Betriebe zur Folge, deren Betreiber*innen ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen konnten oder wollten, und nun auf die Veräußerung der Materialien setzte. In ganz Argentinien standen ganze Fabrikbelegschaften auf einmal ohne Job da. Fast 300 Betriebe im ganzen Land wurden daraufhin besetzt und die Produktion selbstverwaltet weitergeführt. Es kam natürlich zu massiver polizeilicher Repression, um die Arbeiter*innen aus den Betrieben zu treiben und so die Liquidierung ihres Kapitals und die Rückzahlung der Kredite der Eigentümer*innen zu ermöglichen. Diese Repression wurde oft militant beantwortet.
Über die simple gewalttätige Repression hinaus entwickelte sich in Argentinien eine Form der Umarmungsstrategie, die die Reintegration dieser Betriebe in den kapitalistischen Normalvollzug ermöglichen sollte. Vielen der sich in der Illegalität befindlichen und von Repression bedrohten Fabriken wurde ein verlockendes Angebot gemacht: Nämlich Kredite, mit denen sie die finanziellen Forderungen der gegenwärtigen Fabrikbesitzer*innen begleichen und die Fabrik erwerben könnten. Diese Kredite hatten eine lange Laufzeit, sodass sie über die laufenden Profite der selbstverwalteten Betriebe beglichen werden könnten. Die Konsequenz ist klar: die Rückkehr des kapitalistischen Arbeitsregimes und Funktionslogik in die Fabriken. Nunmehr wurde nicht mehr nur für die kollektive Sicherung des eigenen Lebensunterhalts gearbeitet, sondern für die Tilgung eines Kredites. Es musste wieder mit der Maßgabe der Profitmaximierung gearbeitet werden, nicht unter dem Zwang einer Arbeitgeber*in, sondern unter dem Zwang der eigenen Verschuldung. Die Logik der Effizienzsteigerung und Zurichtung der entfremdeten Arbeit hielt wieder Einzug, nur dass es diesmal die Arbeiter*innen selber waren, die sich im kapitalistischen Sinne zu disziplinieren hatten. Nicht alle Belegschaften gingen diesen Weg. Viele, die einen weitergehenden politischen Anspruch hatten, als den bloßen Erhalt ihrer Arbeitsplätze, entschieden sich für politische Militanz als Mittel der Durchsetzung ihrer Ziele. Der bekannteste Betrieb, in dem ein konsequent politischer Weg gegangen wurde, ist die Kachelfabrik FASINPAT, die „Fabrik ohne Bosse“. 2001 beschloss Luis Zanon, Besitzer der größten Keramikfabrik Lateinamerikas und mit 75 Millionen Dollar bei verschiedenen Kreditgeber*innen verschuldet, seine Fabrik zu schließen und alle Arbeiter*innen ohne Auszahlung der seit Monaten ausstehenden Gehälter zu entlassen. Im Oktober 2001 erklärten die Arbeiter*innen die Fabrik für besetzt und zelteten monatelang vor den Fabriktoren. Außerdem erwirkten sie einen Gerichtsbeschluss, der es ihnen ermöglichte, die noch vorhandenen Lagerbestände der Fabrik zu verkaufen, um die Lohnschulden zu begleichen. Im März 2002 leerten sich die Lagerbestände und in der Versammlung der Arbeiter*innen wurde beschlossen, die Produktion in selbstorganisierter Form wieder aufzunehmen. Die Fabrik wurde umbenannt in Fabrica Sin Patrones.
Die Voraussetzung dafür, dass die Arbeiter*innen einen so langen und harten Kampf für den Erhalt und die Übernahme erfolgreich führen konnten, war die Organisierung der Belegschaft in einer Basisgewerkschaft. Basisgewerkschaften unterscheiden sich von den sozialdemokratischen Apparatsgewerkschaften dadurch, dass die Entscheidungsgewalt bei der Basis, also den Arbeiter*innen selbst liegt und nicht bei einem Funktionärsapparat. Dies wird durch eine Struktur erreicht, die stark auf basisdemokratische Versammlungen setzt und die betroffenen Arbeiter*innen in Entscheidungen einbezieht. Während Apparatsgewerkschaften meist dem Paradigma des großen Kompromisses folgen und dabei oft die Wünsche ihrer Basis ignorieren, können Basisgewerkschaften konsequentere Kämpfe gegen die Macht des Kapitals führen. Die Arbeiter*innen der FASINPAT waren bereits vor den Auseinandersetzungen um die Schließung bei der Basisgewerkschaft Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén (SOECN) organisiert. Die Organisationsprinzipien der SOECN sind Arbeiter*innendemokratie, Klassenautonomie, Internationalismus und Anti-Imperialismus. Eine sozialdemokratische Apparatsgewerkschaft hätte die Arbeiter*innen der FASINPAT wahrscheinlich verkauft, um mit Luis Zanon einen faulen Kompromiss zu schließen, aber mit ihrer Basisgewerkschaft konnten sie den Kampf bis zum Ende kämpfen. Auch nachdem sie die Fabrik gewonnen hatten, blieb die basisgewerkschaftliche Organisierung entscheidend. Denn durch die Erfahrung im gemeinsam basisdemokratisch geführten Kampf verfügte die Belegschaft über die organisatorischen Fähigkeiten, die sie brauchten um die Fabrik nach der Übernahme selbstbestimmt zu leiten. Die FASINPAT wird seit über 20 Jahren selbstorganisiert geführt. Die Belegschaft beteiligt sich weiter an politischen Kämpfen, sie unterstützen beispielsweise Arbeitslosengewerkschaften oder soziale Projekte in der Nachbarschaft.
Wenn ihr euch das Kachelangebot der FASINPAT mal anschauen wollt, findet ihr sie auf Instagram.
Außerdem gibt es verschiedene Dokumentarfilme und Bücher über die Fabrik, zum Beispiel dieses auf Deutsch: Sin Patrón, Herrenlos, Arbeiten ohne Chefs. Erschienen im AG Spak Verlag, übersetzt von Daniel Kulla zu finden u.a. bei Back Mosquito.
Wenn du selber Teil einer Basisgewerkschaft werden willst, ist die beste Adresse dafür die Freie Arbeiterinnen und Arbeiter Union, kurz FAU. Die FAU verortet sich in der historischen Tradition des Anarchosyndikalismus, das heißt, sie strebt einen freiheitlichen Sozialismus an. Die Gewerkschaftsarbeit soll nicht nur direkte Verbesserungen bewirken, sondern auch die Arbeiter*innen darauf vorbereiten, die Betriebe zu übernehmen und selbst zu verwalten. Leider kann man die FAU nicht uneingeschränkt empfehlen, da ihre Ortsgruppen ein sehr stark unterschiedliches Niveau haben. Falls du dich für die FAU interessierst, schaust du dir am besten vorher den Blog der nächsten Ortsgruppe an.
Falls du dich für basisgewerkschaftliche Arbeit interessierst, aber nicht sicher bist, ob direkt eine Mitgliedschaft für dich richtig ist und du erst einmal Unterstützungsarbeit machen möchtest, kannst du dir den Verein Interbrigadas e.V. ansehen. Der Verein organisiert Freiwilligeneinsätze, mit denen sie die Gewerkschaft SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras) unterstützen. Die SAT ist in Südspanien aktiv, auf den großen Plantagen, von denen das Obst und Gemüse für unsere Supermärkte kommt. Dort herrschen oft sklavereiähnliche Bedingungen auf den Feldern.
Siehe auch hier auf dem Blog: Wenn Arbeiter*innen sich auflehnen und organisieren
Nahrungsmittelproduktion
Wenn möglichst viele Menschen die kapitalistischen Katastrophen überleben sollen, ist die Lebensmittelversorgung entscheidend. Nur wenn eine Nahrungsmittelversorgung weitgehend unabhängig vom Markt möglich ist, können wir uns der Krisendynamik entziehen. Die Lebensmittelfrage wird durch den Klimawandel und die Störung der globalen Lieferketten durch Krieg immer komplizierter. Die Inflation der Lebensmittelpreise trifft auch die Kernländer des Kapitalismus, während in anderen Regionen schon Hunger herrscht. Besonders schwierig ist es in den Städten. Die Stadtbevölkerung ist meist komplett abhängig von einer externen Nahrungsversorgung, die ausschließlich über den kapitalistischen Markt funktioniert. Wenn diese externe Versorgung immer unsicherer wird, müssen die Grundlagen des eigenen Lebensunterhalts komplett neu geschaffen werden. Landwirtschaftliche Kulturtechniken müssen erlernt oder neu entwickelt werden. Es fällt schwer, sich eine Stadt vorzustellen, die sich weitgehend selbst mit Nahrungsmitteln versorgt.
Das Beispiel Havanna zeigt, dass dies möglich ist. Havanna ist ein Ballungsraum, in dem drei Millionen Menschen leben. Trotzdem wird mehr als die Hälfte der konsumierten Lebensmittel auch in der Stadt produziert. Viele Formen landwirtschaftlicher Produktion existieren in Havanna nebeneinander: von nachbarschaftlichen kooperativen über Kleinunternehmen bis zu Staatsbetrieben. Die Lebensmittel werden meist von den Menschen konsumiert, in deren unmittelbarer Umgebung sie produziert wurden. Diese Organisation ist aus einer extremen Krisensituation heraus entstanden.
Kuba hatte sich seit den sechziger Jahren auf den Export von Zuckerohr in andere Staaten des Warschauer Paktes ausgerichtet. Die Zuckerohrproduktion stellte den wichtigsten Faktor in der kubanischen Landwirtschaft dar, im Gegenzug wurden Erdöl und Lebensmittel importiert. Die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung erfolgte größtenteils über staatlich zugeteilte Rationen. Nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes war Kuba wirtschaftlich und politisch isoliert. Als Folge des Handelsembargos der USA fand Außenhandel unter erschwerten Bedingungen statt, die Versorgung der Bevölkerung musste also über 25 Jahre ohne größere Importe sichergestellt werden. Aber auch die konventionelle Landwirtschaft in Kuba selbst konnte nicht erfolgreich auf eine Eigenversorgung umgestellt werden, da die sie weitgehend von Erdöl abhängig ist. Es geht dabei nicht bloß um Treibstoff für Maschinen, auch die große Anzahl der in der konventionellen Landwirtschaft notwendigen Pestizide und Herbizide kann nur in Prozessen hergestellt werden, in denen Erdöl auf die eine oder andere Weise eine Rolle spielt. Auch diesbezüglich war Kuba auf Importe aus der Sowjetunion angewiesen. In den frühen neunzigern kam es zu einer landesweiten Lebensmittelknappheit. Die Regierung versuchte zunächst der Krise mit staatssozialistischen Konzepten Herrin zu werden, um es dann mit einer marktwirtschaftlichen Öffnung zu versuchen, was auch nicht funktionierte. In dieser Situation war die kubanische Bevölkerung gezwungen zu improvisieren von gemeinsam genutzten städtischen Brachflächen, über Dachgärten bis zu kleinen Kräuterbeeten im Haus. 1993 wurde das offizielle Leitbild der kubanischen Agrarpolitik umgestellt: von einer zentralistischen, auf die Zuckerohrproduktion ausgerichteten Landwirtschaft hin zu einer dezentralisierten, in Kooperativen organisierten Nahrungsmittelproduktion.
Heute gibt es im Stadtgebiet Havanna fast 200 organicoponicos, ökologische Gärten, in denen in Kooperativen gewirtschaftet wird. Die Anwohner*innen produzieren dort gemeinsam den Großteil der von Ihnen konsumierten Lebensmittel. Dabei kommen Techniken der Permakultur zum Einsatz, da die Pflanzenzucht fast komplett ohne synthetische Pestizide erfolgen muss. Denn in einem Wohnviertel massiv Gift zu spritzen, wäre eine nicht sehr zukunftsorientierte Idee. So werden zum Beispiel zwischen den Beeten Zwiebelreihen gepflanzt, um Bodenschädlingen vorzubeugen. Gegen andere Schädlinge wird nicht gespritzt, es werden stattdessen die entsprechenden Fressfeinde ausgebracht. Die Kleinräumigkeit der Gärten und die hohe Anzahl an Helfer*innen macht es möglich, ohne Herbizide gegen Unkräuter vorzugehen. Der Dünger wird teilweise aus Abfällen selbst produziert und es wird darauf geachtet, durch die richtige Auswahl der Fruchtfolge die Bodenqualität zu erhalten. Überschüssige Lebensmittel werden in kleinen Märkten in der unmittelbaren Umgebung der Gärten verkauft. Heute wird ein großer Teil der Lebensmittel, die im Großraum Havanna verbraucht werden, auch dort produziert. Kuba hat es durch Dezentralisierung und ökologische Initiativen geschafft, eine nachhaltige Landwirtschaft aufzubauen.
Strenggenommen ist die kubanische Wirtschaft natürlich kein Beispiel für eine freiheitliche Organisation des Lebens. Es herrscht nach wie vor ein autoritärer Staatssozialismus. Man kann zwar wählen, aber meist nur ein*e Kandidat*in und freie Presse gibt es auch nicht. Dennoch ist das Beispiel für uns übertragbar. Die Initiative zur Umstellung der Landwirtschaft ist aus der Bevölkerung hervorgegangen, die Regierung hat das Konzept übernommen, nachdem andere Versuche gescheitert sind. Und die landwirtschaftlichen Methoden, mit denen die zukunftsfähige Landwirtschaft auf Kuba funktioniert, funktionieren auch in einer anderen Regierungsform.
In Deutschland ist man Lichtjahre davon entfernt, so eine dezentrale und nachhaltige Landwirtschaft zu entwickeln. Erste vorsichtige Versuche gibt es aber mit dem Konzept der Solidarischen Landwirtschaft. (SoLaWi) Dabei kommen Landwirt*innen und Verbraucher*innen in einer Vereinsstruktur zusammen, anstatt, dass der Austausch über den Agrarmarkt läuft. Ob es bei dir in der Nähe eine SoLaWi gibt, kannst du auf dieser Karte nachsehen.
Gesundheitsversorgung
In den Gesundheitskrisen unserer Zeit kommen mehrere Faktoren zusammen. Auf der einen Seite steht die Tendenz des Kapitalismus, Seuchen zu produzieren. Auf der anderen Seite steht die Zerstörung der Gesundheitssysteme in den letzten 15 Jahren. Der Kapitalismus ist schon vor 15 Jahren in eine existenzbedrohende Krise geraten, die kurzfristig abgewendet wurde, in dem man Wohlstand aus der Breite der Gesellschaft in die Märkte transferiert. Eine konkrete Form davon ist der Umbau der Sozialsysteme hin zu einem extraktivistischen, gewinnorientierten Modell. Dabei wird Wohlstand aus den öffentlichen Sozialsystemen zu privatem Kapital gemacht. Der Kapitalismus ist auf eine Dualität mit dem Staat angewiesen, der den Menschen die Überlebensbedingungen garantiert, die der Kapitalismus nicht sicherstellen kann. Ein Ausdruck davon sind die Sozialsysteme, die in der Zeit der Expansion des Industriekapitalismus in den alten Kernländern des Kapitalismus aufgebaut wurden. Öffentliche Verkehrsmittel wie die Bahn, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Post und eben die Gesundheitsysteme. In ihnen ist ein gewisser Wohlstand gebunden, diese Systeme können aber nicht gewinnorientiert funktionieren, wenn sie tatsächlich funktionieren sollen. In der Zeit, in der der Kapitalismus anfing zu stagnieren, wurden die Sozialsysteme privatisiert. Durch die Privatisierung wird der in diesen Systemen gespeicherte Wohlstand in die Märkte transferiert. Für die Märkte fühlt sich das eine Zeitlang wie Wachstum an, tatsächlich ist es derselbe Prozess wie bei einem verhungernden Körper, der beginnt seine überlebenswichtigen Organe selbst verdauen. In der Coronapandemie wurde klar, dass die Verdauung der Organe der Gesellschaft ein bedrohliches Niveau erreicht hat. Wo über Jahrzehnte Betten in den Krankenhäusern abgebaut wurden und Pflegekräfte so krass ausgebeutet werden, dass sie den Beruf zu tausenden verlassen, kann man auf Gesundheitskrisen nicht mehr angemessen reagieren. Dieser Prozess ist in Ländern, die von der Krise damals besonders hart getroffen wurden, schon sehr weit fortgeschritten. Genau hier findet man aber auch ein Beispiel dafür, was man machen kann, wenn die Märkte die Gesundheitssysteme verwüstet haben.
In Griechenland fand im Rahmen der Austeritätspolitik (= staatliches Sparen) ein Großangriff auf alle Formen staatlicher Versorgung statt. Dies führte zu massenhafter Verelendung und dem Zusammenbruch elementarer Versorgungsstrukturen im Gesundheitsbereich. In griechischen Krankenhäusern fehlt es an den wichtigsten Materialien und Gerätschaften. Stellenstreichungen führten in einigen Krankenhäusern dazu, dass der Betrieb jeweils nur für die Hälfte eines Monats aufrechterhalten werden konnte oder die Einrichtung gleich ganz geschlossen wurde. Kürzungen der Versicherungsleistungen und die Erhebung von Behandlungsgebühren haben dazu geführt, dass sich viele Griech*innen eine Behandlung nicht mehr leisten können. So kostete beispielsweise eine Entbindung im Krankenhaus 1000 Euro. In einigen Fällen wurden Neugeborene den Eltern erst nach Bezahlung dieser Gebühr übergeben. Die Situation wurde unerträglich. Die Austeritätspolitik bedeutete den Tod von Menschen, welche an Krankheiten und Verletzungen sterben, die eigentlich leicht zu behandeln gewesen wären. Um sich dagegen zu wehren, wurde in Thessaloniki im November 2011 ein selbstverwaltetes Gesundheitszentrum eröffnet. Hervorgegangen war diese Idee aus einer Gruppe von Ärzt*innen, die im Januar 2011 sich im Hungerstreik befindende Migrant*innen medizinisch versorgt hatten. Die 50 Hungerstreikenden waren in einem Workers Center in Thessaloniki untergebracht und wurden dort von solidarischen Ärzt*innen, Krankenpfleger*innen und Psychotherapeut*innen betreut. Nach dem Streik setzten diese die Arbeit fort und gründeten die Soziale Krankenstation der Solidarität Thessaloníkis (SKS). Die SKS versorgt nun seit 12 Jahren den Teil der Bevölkerung der Stadt, der aufgrund der zerstörerischen Austeritätspolitik keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung mehr hat. In der SKS arbeiten Freiwillige, der Betrieb wird über Spenden finanziert, Medikamente und medizinische Alltagsprodukte stammen oft aus der Hausapotheke solidarischer Menschen. Die Solidarität ist jedoch keine Einbahnstraße. Ehemalige Patient*innen helfen beim Alltagsbetrieb des Zentrums oder übernehmen Verwaltungsaufgaben. Die SKS bietet Versorgung in verschiedenen Bereichen an, darunter Allgemeinmedizin, Psychotherapie, Kinderversorgung und eine Apotheke, in der Medikamente umsonst abgegeben werden. Die Aktiven der SKS verstehen sie nicht als rein karitatives Projekt, wie ähnliche Krankenstationen der Kirche. Die SKS möchte zeigen, dass selbstorganisierte, solidarische Projekte funktionieren:
„Wir haben das Projekt nicht gestartet, um unsere Seele mit karitativer Arbeit zu retten, sondern verstehen uns als politisches Projekt mit einem klaren Ziel. Unser Hauptziel als SKS ist es zu zeigen, dass solidarische Strukturen funktionieren und dass es durch solidarische Organisierung gelingen kann, die Probleme zu überwinden, die durch die ökonomische Krise entstehen. Solidarität bedeutet dabei mehr, als nur eine helfende Hand auszustrecken. Solidarische Strukturen können dann wirkungsmächtig werden, wenn Solidarität zum Teil des Bewusstseins wird, nicht nur unserer PatientInnen, sondern auch ihrer Familien und der Viertel, in denen sie wohnen. Während eines solchen Prozesses wird klar, dass solidarische Strukturen nicht nur im Gesundheitssektor geschaffen werden können, sondern auch in allen anderen Bereichen unseres Lebens. Dieser Bewusstwerdungsprozess ist sehr schwer in Gang zu setzen. Wenn wir jedoch dabei stehen bleiben, nur ein funktionierendes Gesundheitszentrum erschaffen zu haben, war unsere Arbeit umsonst. Erfolg haben wir dann, wenn es gelingt, das SKS zum Teil einer allgemeinen Bewegung mit dem Ziel der gesellschaftlichen Selbstverwaltung und Solidarität in der Stadt, aber auch im ganzen Land, zu machen.“
(zitiert nach fau.org)
Wenn ihr die SKS unterstützen wollte, gibt es hier einen Spendenlink. In vielen deutschen Städten gibt es ebenfalls Vereine, die Menschen ohne Krankenversicherung unterstützen.
Vierter Teil: …und wenn wir zusammen musizieren, so wäre dies wohl fantastisch