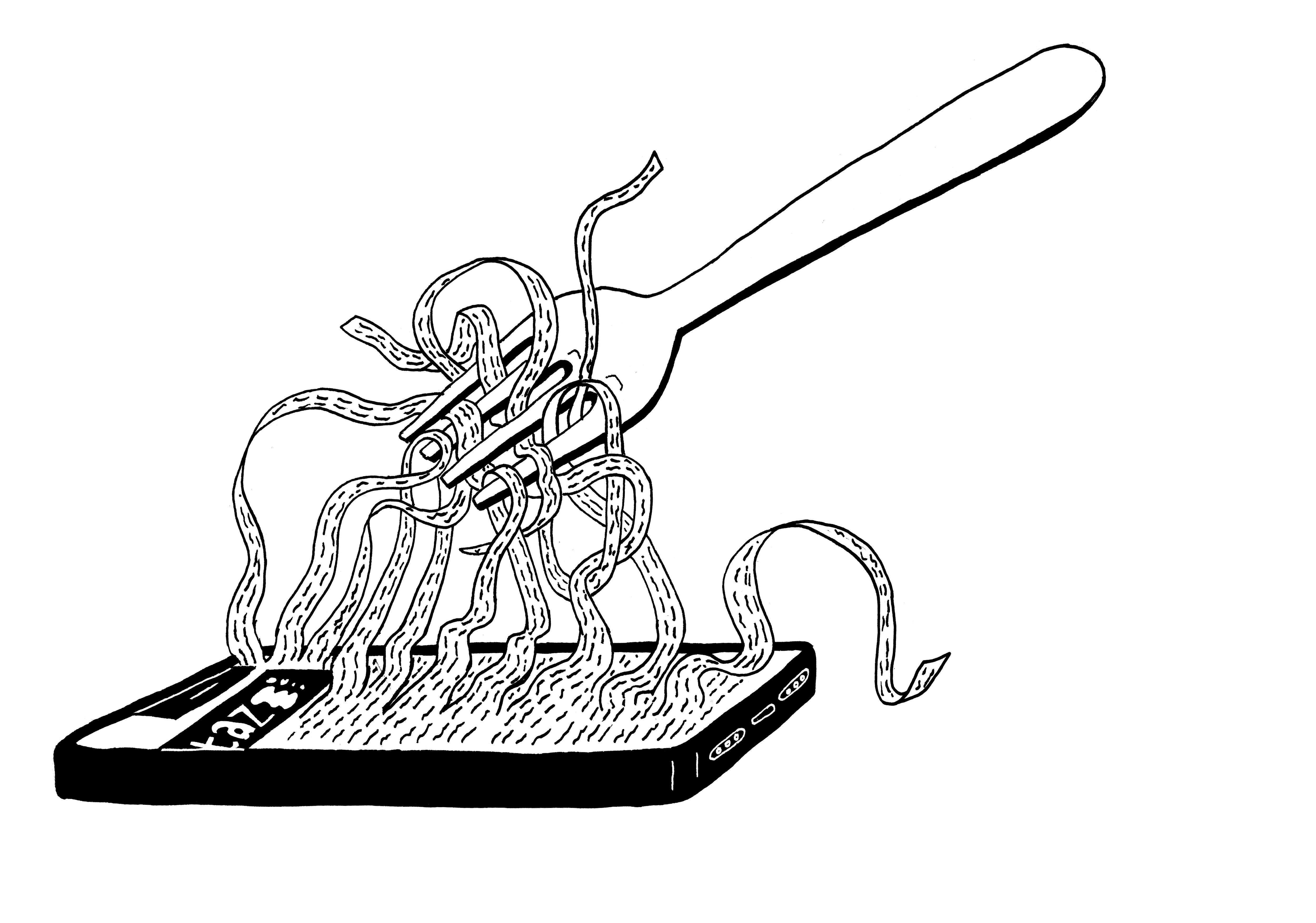Am Morgen lese ich einen Artikel, in dem über Didier Eribons neues Buch „Eine Arbeiterin“ berichtet wird. Es ist wie schon sein letzter Bestseller „Rückkehr nach Reims“ biographisch und handelt von seiner Mutter, die er in ein Altersheim gegeben hatte und die dort innerhalb von sieben Wochen verstarb. Er hatte sie in dieser Zeit nicht mehr gesehen. Egal mit wem ich hier in der Türkei über Eltern rede, sehe ich immer nur glückliche, begeisterte Gesichter. Als meine Eltern mich vor zwei Jahren hier besuchten und ich mit ihnen durch Istanbul ging, wurde mir überall zu ihnen gratuliert. Die Türken lieben ihre Eltern, daran gibt es nichts zu rütteln. Und das hier mitzubekommen, ist sehr schön. Wie allerdings die alten Menschen hier mit ihrer Rente zurechtkommen, das kann man als in einem guten Sozialsystem aufgewachsene Deutsche nicht verstehen. Die Renten der mittleren Schicht, die wegen der anhaltenden extremen Inflation auch immer ärmer wird und erst recht die Renten der unteren Schichten sind sehr gering und die Menschen können hier inzwischen eigentlich nur noch überleben, wenn sie im Familienclan zusammenhalten. Allerorten gibt es vom Staat finanziell unterstützte Halk Ekmek Stände, in denen in Plastik verpacktes Brot verbilligt verkauft wird.
Ansonsten gibt es aber kaum Unterstützung von einem Staat, der das Geld lieber in Kreuzfahrtanleger und Hotels für wohlhabende Menschen aus arabischen Ländern investiert. Manchmal sieht man hier in Istanbul alte Menschen betteln, das sind meist Angehörige der Roma; die Roma sind in der Türkei, obwohl Muslime und seit Jahrhunderten ansässig, immer noch eine gesellschaftlich nicht akzeptierte Randgruppe. Gestern sah ich bei einem Spaziergang eine alte Frau in typischen anatolischen Kleidern, die in einer heruntergekommenen sehr muslimischen Gegend in der Altstadt, wo viele arme Menschen wohnen, an einer Straßenecke mit einer grünen Plastiktrillerpfeife den Verkehr regelte. Ob sie dafür wohl Geld bekommt? Auch der uralte gekrümmt gehende Mann mit dem Riesenkorb auf dem Rücken, in dem Äpfel sind, die er verkauft, wird kaum überleben können.
In Tarlabasi, ganz unten im Tal und gleich neben meinem in den letzten Jahren enorm gentrifizierten und reichen Stadtviertel Beyoglu gelegen, wohnen die Ärmsten der Armen, d. h. vor allem Angehörige der Roma, Transfrauen, Prostituierte. Die Häuser sind zerfallen, sie malerisch zu nennen, wäre eine grobe Übertreibung, sie sind erbärmlich. Das stadtnahe Viertel sollte eigentlich schon seit Jahren abgerissen werden, wodurch Tausende Menschen ihre Wohnung verlieren würden. Aber es hat bisher dem Abrisswahn getrotzt, was vielleicht jetzt damit zusammenhängt, dass in ganz Istanbul sowieso eine übereifrige Bauwut herrscht, der drohenden Erdbebengefahr wegen werden alle möglichen Häuser abgerissen und neu oder umgebaut, weshalb alle Ressourcen ausgeschöpft sind. Die Armen kommen zuletzt dran. Eine gute Freundin von mir, die vor fünfzehn Jahren von Deutschland nach Istanbul gezogen ist, bewohnt eine Wohnung in einem Haus, das nicht erdbebensicher ist. Der Vermieter will das sechsstöckige Haus mit Bosporusblick neu bauen lassen und mit drei Stockwerken aufstocken, um die Kosten wieder reinzuholen. Sie selber wird ihre Wohnung verlieren und sich keine Wohnung in einem solchen Viertel mehr leisten können. Sie überlegt, wieder nach Deutschland zurückzugehen.
Sonntags ist in Tarlabasi Flohmarkt. Dort gibt es nur Ramsch, alte getragene Kleidung, ausgelatschte Schuhe, abgestoßene kaputte Gegenstände. Ich bin am Sonntag mit einem Freund auf den Flohmarkt gegangen, der der einzige Flohmarkt hier in Istanbul ist. Wir fühlen uns dort zwischen all der Armut und dem Elend schlecht, müssen dann aber trotzdem manchmal lachen über all das Kaputte und die Häuser und viele der Gegenstände auf diesem Markt, von denen wir denken, dass sie in Deutschland begeistert aufgenommen und als große Kunst verkauft würden. Auch wegen dieser Gedanken haben wir wiederein schlechtes Gewissen. Eine Frau mit leprös veränderten Händen kommt uns entgegen. Wir geben ihr ein paar Lira. Dann sitzt ein Mann mit Beinstummeln mitten auf dem Weg. Auch er freut sich über ein paar Lira. Genauso wie der Taxifahrer, der uns hierher gebracht hat und über das ganze Gesicht strahlte, als wir ihm für die Fahrt, die fast eine halbe Stunde dauerte und 5 Euro gekostet hat, auch noch 1 Euro Trinkgeld gaben. Wie kommt er bloß zurecht? Schon das Benzin kostet doch pro Liter inzwischen über einen Euro. Als ich vor drei Jahren das erste Mal in Istanbul war, war es noch halb so teuer. Der Taxifahrer drängt uns seine Telefonnummer auf, wie bisher noch jeder Taxifahrer, mit dem wir bislang unterwegs waren und sagt, er würde uns „Discount“ geben. Discount? Bei diesen Preisen. Man schämt sich und kommt sich unendlich reich vor in diesem Armenviertel, in dem der Blick in düstere schmutzige Fenster und halb offen stehende Türen nur Unrat und Schmutz zeigt. Kinder mit nackten Füßen, die Haare voller Dreck, die dünnen Körper unter schmutzigen Kleidern auch nicht sauberer, gehen an uns vorüber, halten sich an den Händen. Aber die alten zahnlosen Frauen, die ihre Gardinen hinter blinden Fenstern öffnen und uns unter ihren Tüchern angucken, lächeln, als ich sie anlächele.
Nicht nur die Liebe zu den Eltern gilt weiterhin als Gebot. Auch die Liebe zu Fremden ist selbstverständlich. Fremde sind hier immer Gäste, egal wie wenig man hat. Gehe ich mit türkischen Freunden essen, bestehen sie darauf zu bezahlen. Der ältere Mann, der der Frau am Teestand hilft, wo wir uns einen Chai für wenig Geld holen, spricht uns in perfektem Deutsch an. Er sagt, ihm würde es hier gut gehen. Er bekäme ja glücklicherweise seine Rente aus Deutschland in Euro, weshalb er es gut habe bei der täglich steigenden Inflation mit ihren immer höheren Preisen. Sein Name sei Hardy. Er sei 1964 nach Hannover gegangen, um dort arbeiten und sei nun zehn Jahre zurück in der Heimat. Er sei 78 Jahre alt und bekomme 1000 Euro Rente. Davon könne er hier phantastisch leben. Seine Familie sei in Deutschland, die Kinder und Enkel seien dort geboren und aufgewachsen. Das sind keine richtigen Türken mehr, sagt er und bittet uns, ihn doch beim nächsten Flohmarktbesuch in seiner Wohnung zu besuchen und zeigt hinter sich. Die niedrige Tür in dem schrottreifen Haus führt in einen dunklen schmutzigen Flur. Hier wohnt er und er ist stolz auf seine Behausung. Wir verabschieden uns, als wären wir alte Freunde und gehen weiter.
Das Wenige, was sie haben, wird beiseitegelegt, höre ich am selben Abend von türkischen Freunden, mit denen wir in eine Meyhane gegangen sind. Geld horten die Türken nicht mehr auf der Bank, wo es sowieso täglich weniger wird. Seit ich vor zwei Wochen ankam, ist der Lira von 32 (für 1 Euro) auf inzwischen fast 36 angestiegen. Ende des Monats ist er bei 40, sagt mir eine Freundin, die mir gegenübersitzt. Wir bestellen Raki, die kleinste Flasche, 20cl, kostet 20 Euro. Ein Glas Wein 12 Euro. Ringsum auf den Tischen stehen große Flaschen Raki auf den Tischen, alle hier trinken auch Wein und essen Meze dazu. Es gibt eine wenn auch immer kleiner werdende Oberschicht hier, die sich das Ausgehen leisten kann. Das Geld horten wir Türken inzwischen zu Hause, sagt meine Freundin. Nicht nur wegen der Inflation. Sondern vor allem wegen des für Istanbul angekündigten drohenden Erdbebens, über das hier, seit ich vor drei Jahren zum ersten Mal kam, eigentlich alle irgendwann einmal sprechen. Falls das Erdbeben kommt, spätestens dann, ist hier alles vorbei, sagt sie, die für diesen Fall ihr Geld in Fremdwährung zu Hause aufbewahrt. Sie würde gerne schon jetzt fortgehen, kann es aber nicht, weil sie arbeiten und die Schulen ihrer Kinder bezahlen muss. Obwohl sie in einem erdbebensicheren relativ neuen Haus wohnt, weiß sie schon, dass sie im Fall eines Erdbebens in Istanbul sofort weggehen wird. Es wird ein totales Chaos geben, ein unkontrollierbares Chaos, und niemand wird mehr etwas besitzen, weil auch die Banken kollabieren werden, sagt sie mir jetzt. Mir fällt wieder ein, dass ich von allen Türken, mit denen ich auf der Straße zusammentreffe, gefragt werde, wie sie wohl am besten nach Deutschland kommen können. Die deutsche Botschaft vergibt Visa erst, wenn man den Nachweis über sehr viel Geld auf einem Sperrkonto erbringt, erzählt eine andere Freundin. Man braucht mindestens 50000 Euro, um ein Visum zu bekommen. Diejenigen, die soviel Geld haben, wollen aber meist gar nicht aus der Türkei fort, sie leben in erdbebensicheren Häusern und haben Sommerhäuser in der Ägäis oder am Mittelmeer, in die sie sich flüchten könnten, wenn das Erdbeben kommt. Ob im Falle des vorhergesagten Erdbebens in Istanbul die 18 Millionen Menschen, die hier wohnen, ihre alten Eltern in Sicherheit bringen können, wird sich zeigen. In Antakya, wo das letzte Erdbeben war, leben die meisten Menschen immer noch sehr behelfsmäßig in Containern und der Bau neuer Häuser geht nur sehr schleppend voran. Ich muss wieder an Didier Eribons Buch denken und daran, dass verglichen mit den Problemen, die die Türken derzeit haben, unsere westeuropäischen Probleme lächerlich und klein erscheinen.
Heute Abend zahlen wir die Rechnung und keine*r der anwesenden eingeladenen Türk*innen protestiert. Sie haben uns vorhin noch erzählt, dass sie schon lange nicht mehr hier waren. Ich weiß, dass sie sich dafür schämen, dass sie uns nicht mehr einladen können und dass wir nun für sie zahlen. Und ich schäme mich auch dafür. Und ich muss denken, dass ich eigentlich ganz froh bin, dass ich in wenigen Tagen wieder nach Deutschland zurückgehen werde. Schönheit und Verfall, Jubel und Furcht vor der Zukunft liegen hier in Istanbul so dicht beieinander, dass es beängstigend ist!