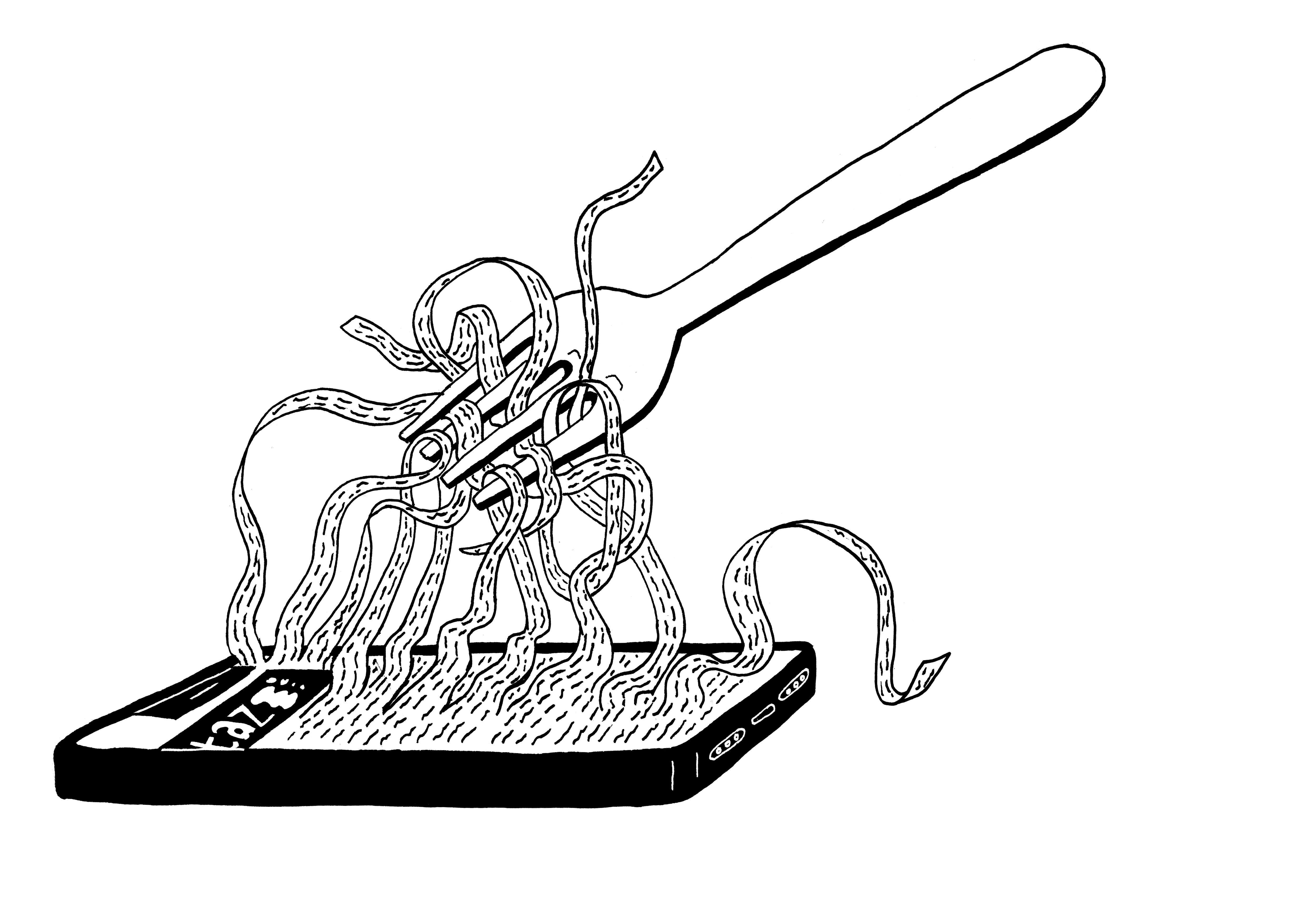Was für eine Rückkehr in die seuchenerprobteste Stadt der Welt, in der vor Jahrhunderten die Quarantäne erfunden wurde. Bei der Zugfahrt läuft nach jedem Stopp die Durchsage, jeder Passagier müsse an der nächsten Haltestelle aussteigen, falls er seine Gesichtsmaske nicht oder auch nur unkorrekt trägt. Viele könnte es nicht treffen, kaum jemand ist unterwegs. In der Selbsterklärung, die mitgeführt werden muss, gebe ich als Reisegrund an: „Venedig spüren“. Niemand kontrolliert.
Im vergangenen Juni schien das Corona-Virus nur eine weitere Episode in der pestreichen Geschichte der Serenissima gewesen zu sein. Nach dem ersten Lockdown war der Sommer sehr groß, in diesem „schönen Gegengewicht der Welt“. Viele Touristen strömten bis in die Herbsttage erneut in die Lagunenstadt, aber nie zu viele. No overtourism. Rainer Maria Rilke wurde zum unbewussten Begleiter, als wieder zu spüren war, dass junge Nächte wie ein kühler Duft auf den Kanälen liegen.
Gegen Jahresende folgte aber poesiefrei der nächste Lockdown. Ein kurzes Aufblühen der Stadt im Februar führte in den nunmehr dritten verordneten Stillstand. Die Ausgangssperre gilt ab 22 Uhr. Schon zwei Stunden vorher empfinde ich bei meiner Ankunft den Canale Grande als befremdlich trist. Nur ein Gefühl?

Niemand irgendwo. Zur Quarantäne angehalten, fahre ich mit der Linie 1 direkt zum Hotel. Es ist geschlossen. Dennoch überlässt mir der Manager, der seit meinem Walk-In im Juni zum Freund wurde, die codierte Karte zum „Room 304“, dem Zimmer aller Zimmer. Am nächsten Morgen stellt er ein Essenspaket vor die Türe. Frisches in Unmengen Plastik. Den Wein habe ich im Gepäck.
Zur Quarantäne angehalten, fahre ich mit der Linie 1 direkt zum Hotel. Es ist geschlossen. Dennoch überlässt mir der Manager, der seit meinem Walk-In im Juni zum Freund wurde, die codierte Karte zum „Room 304“, dem Zimmer aller Zimmer. Am nächsten Morgen stellt er ein Essenspaket vor die Türe. Frisches in Unmengen Plastik. Den Wein habe ich im Gepäck. Tagelang kann ich uferlos in Träume abtauchen, mich gehen lassen in meiner grau verplüschten Kemenate, alleine im Hotel mit dem weltgerühmten Ausblick. Keine falschen Geräusche. Einfach lesen, lesen, lesen und schreiben. Venice calling.
Tagelang kann ich uferlos in Träume abtauchen, mich gehen lassen in meiner grau verplüschten Kemenate, alleine im Hotel mit dem weltgerühmten Ausblick. Keine falschen Geräusche. Einfach lesen, lesen, lesen und schreiben. Venice calling.


 Nur eine Möwe besucht mich.
Nur eine Möwe besucht mich. Schritte auf dem ausladenden Kai der Riva degli Schiavoni hallen bis ins Zimmer im dritten Stock. Gespräche kann ich Wort für Wort mitverfolgen, so vereinzelt sind sie.
Schritte auf dem ausladenden Kai der Riva degli Schiavoni hallen bis ins Zimmer im dritten Stock. Gespräche kann ich Wort für Wort mitverfolgen, so vereinzelt sind sie.

Rebecca
Nach einer Woche darf ich raus, mit dem Vaporetto zum vorgeschriebenen Coronatest in das Poliambulatorio Bielo Hub neben der Bahn- und Polizeistation. Ein verschlungener Weg. Dornenreich, im Wortsinn.
Rebecca nimmt meine Daten auf und weist mich ein. Sie ist eine Dotoressa und erfahren im Umgang mit Besuchern. Bis zum ersten Lockdown leitete sie auf einer Insel vor dem Lido in einem ehemaligen Kloster und einer später gefürchteten psychiatrischen Anstalt die Rezeption des nunmehrigen Spitzenhotels „San Clemente Palace“. Weltstars waren ihre Gäste. Rebecca hat Tourismusmanagement studiert, nicht Medizin. Jetzt ist sie ohne Perspektive, das Hotel seit unzähligen Monaten nicht in Betrieb. Eine historische Ironie: Vor vierhundert Jahren eroberte von der Insel San Clemente aus ein Pestausbruch die Serenissima. Jetzt sind Rebecca und ihre Kollegen Corona-Opfer, zumal auch in diesem Sommer Flüge aus den Hauptherkunftsländern der Gäste nicht vorgesehen sind. No luxury, no job.
Jetzt ist sie ohne Perspektive, das Hotel seit unzähligen Monaten nicht in Betrieb. Eine historische Ironie: Vor vierhundert Jahren eroberte von der Insel San Clemente aus ein Pestausbruch die Serenissima. Jetzt sind Rebecca und ihre Kollegen Corona-Opfer, zumal auch in diesem Sommer Flüge aus den Hauptherkunftsländern der Gäste nicht vorgesehen sind. No luxury, no job.
„In der Teststation kann ich wenigstens irgendetwas arbeiten“, sagt sie. Sie spricht fließend englisch, französisch und spanisch. Derzeit ist das wertlos wie Banknoten nach einer Hyperinflation. „Die Deutschen haben weiterhin Geld und dort gibt es vielleicht auch Arbeit“, meint sie. Doch ausgerechnet Deutsch spricht sie nicht. Vielleicht will sie das jetzt auch noch lernen.
Freigetestet bewege ich mich durch die Gassen. Und wieder so ein Gefühl der Schockstarre. Geschäfte, die vor einem halben Jahr noch mit Sonderangeboten lockten, haben inzwischen serienweise aufgegeben, auch in noblen Gegenden. Früher so begehrte Werbeflächen bleiben weiss.
Früher so begehrte Werbeflächen bleiben weiss. Im „La Coupole“ kaufte ich vor fast 40 Jahren einen für mich damals kaum leistbaren Schal und hegte ihn lange Zeit. Im vergangenen Herbst war ich wieder da, zögerte bei einem besonderen Mantel. Jetzt wollte ich ihn mir gönnen. Zu spät. Zu viele Kunden haben zu lange überlegt und nicht gekauft.
Im „La Coupole“ kaufte ich vor fast 40 Jahren einen für mich damals kaum leistbaren Schal und hegte ihn lange Zeit. Im vergangenen Herbst war ich wieder da, zögerte bei einem besonderen Mantel. Jetzt wollte ich ihn mir gönnen. Zu spät. Zu viele Kunden haben zu lange überlegt und nicht gekauft. Vor dem Jahrhundertcafé “Florian” sitzen ältere Venezianer auf den unverwüstlichen Holzbänken und tratschen.
Vor dem Jahrhundertcafé “Florian” sitzen ältere Venezianer auf den unverwüstlichen Holzbänken und tratschen. Aber nicht lange. Sicherheitsleute verweisen sie des Platzes.
Aber nicht lange. Sicherheitsleute verweisen sie des Platzes. Vorne am Wasser finden sie Ablenkung. Russinnen stehen Modell.
Vorne am Wasser finden sie Ablenkung. Russinnen stehen Modell.
 Venedig feiert in diesem Jahr seinen 1600. Geburtstag. Nur einen Hinweis finde ich dazu.
Venedig feiert in diesem Jahr seinen 1600. Geburtstag. Nur einen Hinweis finde ich dazu. Die leeren Plätze und Straßen wirken nicht mehr belebend, sondern beängstigend kahl. Gar bleiern.
Die leeren Plätze und Straßen wirken nicht mehr belebend, sondern beängstigend kahl. Gar bleiern. Bars, Restaurants, Museen und die meisten Geschäfte bleiben geschlossen. Ein äußerst höflicher Antiquitätenhändler ist gerade in seinem Laden, seine Augen wünschen sich, dass ich einen Stich kaufe. Als er erfährt, dass ich Österreicher bin, bietet er mir eine Karte Westfalens aus dem frühen 18. Jahrhundert an. Mit Bleistift hat er am Rand den bisherigen Preis auf ein Viertel gesenkt. Ein „Bitte“ ohne Worte.
Bars, Restaurants, Museen und die meisten Geschäfte bleiben geschlossen. Ein äußerst höflicher Antiquitätenhändler ist gerade in seinem Laden, seine Augen wünschen sich, dass ich einen Stich kaufe. Als er erfährt, dass ich Österreicher bin, bietet er mir eine Karte Westfalens aus dem frühen 18. Jahrhundert an. Mit Bleistift hat er am Rand den bisherigen Preis auf ein Viertel gesenkt. Ein „Bitte“ ohne Worte.
Immerhin sind auch die Verkaufspavillons voller Touristenramsch versperrt. Ein Lichtblick.
Kuscheldecke für die Seele
Freunde und Bekannte laden mich zu sich nach Hause ein. Als Journalist darf ich sie besuchen, als lediglich kontaktsuchender Bürger dürfte ich es nicht. Doch auch mich drängt es in die Herzlichkeit solcher Begegnungen. Die Wärme und Großzügigkeit, die ihnen innewohnt, empfinde ich als Nordländer, der zum globalen Nomaden wurde, als Kuscheldecke für meine Seele. Wo ich herkomme und wieder Heimat suchte, gilt Kargheit als Tugend. In Worten und in Taten.
Gustavo
Gustavo holt mich ab. Auf dem Weg zeigt er auf eine Wand. „Ein Banksy?“, fragt er. Gustavo hat fertig. Er ist ein herausragender Sommelier. Die Gäste klatschen oft schon beim Hauptgang in die Hände, so trefflich wählt er die Weine aus, die zu allen passen – zu den Gästen und zum Essen.
Gustavo hat fertig. Er ist ein herausragender Sommelier. Die Gäste klatschen oft schon beim Hauptgang in die Hände, so trefflich wählt er die Weine aus, die zu allen passen – zu den Gästen und zum Essen.
Den ersten Lockdown hat Gustavo noch geschafft. Der zweite ihn. In den Turbulenzen der Einsamkeit und des Stressabfalls griff er nach noch mehr Drogen als üblich. „Frage mich nicht, was ich genommen habe, besser danach, was ich nicht genommen habe.“ Heroin? „Das nicht, so gescheit bin ich noch.“ Aber ansonsten: LSD, Amphetamine, Exstasy, Kokain, soweit bezahlbar, und natürlich, Marihuana. Einige Pflanzen lässt er demonstrativ auf seiner Kleinstterasse sprießen. „Ich will, dass so ein Topf bald auf jedem Fenstersims steht.“
Gustavo wirkt mit seinen 32 Jahren außergewöhnlich verletzlich und fürsorglich. Diese Sensibilität hat sich im Job verlässlich ausgezahlt. Wir trinken gemeinsam was Gescheites, und er erzählt von seiner „Explosion“. Zwischen den Lockdowns, als sich das Lokal mit „Ombra“-Rufen füllte, dem venezianischen Wunsch nach weiterem Wein, verliebte er sich in eine Arbeitskollegin. Mit allen Sinnen. Er sagt: „Besinnungslos“. Gustavo gestand seiner langjährigen Freundin seine neue Gefühlswelt, sie trennten sich. Sie macht seither Karriere, er zog ans andere Ende der Stadt, verfiel seiner Kollegin und hoffte und wartete und wartete und hoffte. „Aber zu mehr als einer Umarmung kam es nie.“ Die Emotionen fraßen sich ihre Bahn. Nachts, in einer Kneipe, die es gar nicht gibt, unter Drogen, die es gerade in diesen besucherkargen Zeiten in Venedig überall gibt, langte er hin. „Ich habe sie nicht getroffen, doch ihre Seele war getroffen.“ Der Chef entließ ihn, „was hätte er sonst tun sollen?“ Jetzt ist Gustavo arbeitslos. Vielleicht, vielleicht bekommt er wieder eine Chance in einem der Lokale, die vor Corona überquollen und den Mitarbeitern die Kräfte raubten statt sie in ihnen aufzustauen. Allerdings weiß noch niemand, ob allzu viele Restaurants überhaupt wieder aufsperren werden. So überlegt Gustavo, ein Venezianer durch und durch, wegzugehen. Wohin? „Keine Ahnung.“
Die Emotionen fraßen sich ihre Bahn. Nachts, in einer Kneipe, die es gar nicht gibt, unter Drogen, die es gerade in diesen besucherkargen Zeiten in Venedig überall gibt, langte er hin. „Ich habe sie nicht getroffen, doch ihre Seele war getroffen.“ Der Chef entließ ihn, „was hätte er sonst tun sollen?“ Jetzt ist Gustavo arbeitslos. Vielleicht, vielleicht bekommt er wieder eine Chance in einem der Lokale, die vor Corona überquollen und den Mitarbeitern die Kräfte raubten statt sie in ihnen aufzustauen. Allerdings weiß noch niemand, ob allzu viele Restaurants überhaupt wieder aufsperren werden. So überlegt Gustavo, ein Venezianer durch und durch, wegzugehen. Wohin? „Keine Ahnung.“ Die Leere verfestigt sich. Tag für Tag, Abend für Abend. So sähe es auch aus, wenn eine Neutronenbombe abgeworfen worden wäre. Die Gebäude bleiben unversehrt, die Menschen sind verschwunden.
Die Leere verfestigt sich. Tag für Tag, Abend für Abend. So sähe es auch aus, wenn eine Neutronenbombe abgeworfen worden wäre. Die Gebäude bleiben unversehrt, die Menschen sind verschwunden.


 Verfällt Venedig? Kaum. Bin ich Venedig verfallen? Ja. Das ist nicht originell, aber mei. Was dabei schmerzt? Bisher nichts.
Verfällt Venedig? Kaum. Bin ich Venedig verfallen? Ja. Das ist nicht originell, aber mei. Was dabei schmerzt? Bisher nichts.
Keineswegs zufällig komme ich an dem Haus vorbei, in dem sich Joseph Brodsky länger aufhielt, erinnere mich an sein „Ufer der Verlorenen“. In der katholischen Buchhandlung in der Nähe meines Hotels kaufe ich das Bändchen, dazu „Mit Rilke in Venedig“. Bestellt hatte ich Peter Handkes „Mein Tag im anderen Land“. Die so treffenden Titel sind Zufall. Bei Gianni, dem Buchhändler ist Land unter. Er zeigt mir, wie hoch das letzte Hochwasser in seinem Laden stand und gibt mir Rabatt. Für drei Büchlein? „Drei kauft nur noch selten jemand“, sagt er.
Gondolieri und Giorgio „Il Galeon“
Auf der Riva dei Sette Martiri, dessen Name an sieben politische Häftlinge erinnert, die 1944 von den Nazis erschossen wurden, treffe ich vor einer Bar auf einige Männer aus der Nachbarschaft. „Wir haben noch nie so eine Krise erlebt“, sagt Fabio Zanetti, der Mann in schwarz. „Die Finanzkrise 2008 war nicht so schlimm, auch nicht der Golfkrieg, als der Flughafen für die Nato-Flugzeuge gesperrt war. Venedig war noch nie so still, auch nicht während der Spanische Grippe.“ Das wisse er, weil er sich mit Geschichte beschäftigt. Zanetti ist Gondoliere, seine Stammkundschaft lebt in Südamerika. Er ist seit 19 Monaten arbeitslos, seit dem Hochwasser am 12. September 2019. „Hier an dieser Stelle stand uns wirklich das Wasser bis zum Hals“, beginnt er zu erzählen, „das Zollhäuschen ist bis in den Biennale-Park geschwemmt worden. Nach zwei Tagen hatte sich die Lage schon wieder beruhigt, aber Fernsehteams aus aller Welt haben 40 Tage lang darüber berichtet. Ihre Übertreibungen waren die wirkliche Katastrophe.“ Bis das Virus alles übertraf.
„Wir haben noch nie so eine Krise erlebt“, sagt Fabio Zanetti, der Mann in schwarz. „Die Finanzkrise 2008 war nicht so schlimm, auch nicht der Golfkrieg, als der Flughafen für die Nato-Flugzeuge gesperrt war. Venedig war noch nie so still, auch nicht während der Spanische Grippe.“ Das wisse er, weil er sich mit Geschichte beschäftigt. Zanetti ist Gondoliere, seine Stammkundschaft lebt in Südamerika. Er ist seit 19 Monaten arbeitslos, seit dem Hochwasser am 12. September 2019. „Hier an dieser Stelle stand uns wirklich das Wasser bis zum Hals“, beginnt er zu erzählen, „das Zollhäuschen ist bis in den Biennale-Park geschwemmt worden. Nach zwei Tagen hatte sich die Lage schon wieder beruhigt, aber Fernsehteams aus aller Welt haben 40 Tage lang darüber berichtet. Ihre Übertreibungen waren die wirkliche Katastrophe.“ Bis das Virus alles übertraf.
Eine nervlich bedingte Muskelschwäche zwingt seinen Freund seit dem vergangenen Sommer in den Rollstuhl. Als „Giorgio il Galeon“ stellt er sich vor, „wie das Lokal. Zu mir kam auch die belgische Königsfamilie zum Essen, ein Mal im Jahr.“ Im Dezember mußte er verkaufen, „weit unter Preis, aber wenigstens an einen Venezianer“. Das Finanzamt wollte Geld, den Mitarbeitern hatte er einiges vorgestreckt, die staatlichen Zuschüsse tröpfelten nur und kamen zu spät. Seine Frau hat keine Arbeit, seine Tochter und sein Schwiegersohn auch nicht. Das kleine Hilfsgeld vom Staat muss irgendwie reichen. Aus dem standfesten Restaurantbesitzer Giorgio il Galeon wird bei den Behörden der behinderte Almosenempfänger Giorgio Gallardi.
Massimo Veronesi, der seinen Rollstuhl schiebt, ist Sänger bei Gondelfahrten. Er bekam in eineinhalb Jahren 7.000 Euro an staatlicher Unterstützung. „Ich habe das Glück, dass meine zwei Kinder arbeiten, eine ist Sekretärin, die andere fährt auf einem Vaporetto.“
Und jetzt, wie wird das mit dem großen Wiederaufbauprogramm der Europäischen Union? „Ach“, meint Fabio Zanetti, „was werden die Politiker davon schon wirklich weitergeben? Wir sagen dazu:´Du bist schwul mit meinem Hintern‘.“
Mein Interesse erstaunt sie. „Es sollten einmal italienische Journalisten vorbeikommen und uns so genau fragen.“
Ronny
Am nächsten Tag zieht es mich ins Restaurant CoVino, diesem bisherigen Gesamtkunstwerk.
 Ronny kommt vorbei. „Na ja, ich bin nahe an der Armutsgrenze“. Es ist ihm anzusehen, dass er das ernst meint. „Aber das bin ich ja gewöhnt.“ Er ist in der DDR geboren, seine Eltern waren bei der Stasi. Weil er „in Deutschland nur Schrott gefressen“ habe, wog er bald 120 Kilo und wurde selbst zu einer Figur – in einer Rammstein-Parodieband.
Ronny kommt vorbei. „Na ja, ich bin nahe an der Armutsgrenze“. Es ist ihm anzusehen, dass er das ernst meint. „Aber das bin ich ja gewöhnt.“ Er ist in der DDR geboren, seine Eltern waren bei der Stasi. Weil er „in Deutschland nur Schrott gefressen“ habe, wog er bald 120 Kilo und wurde selbst zu einer Figur – in einer Rammstein-Parodieband. Er heuerte beim SAT1-Frühstücksfernsehen an und rechtfertigt sich noch heute dafür.“ Ich wollte so gerne Benjamin von Stuckrad-Barre kennenlernen.“ Das gelang, und anderes.
Er heuerte beim SAT1-Frühstücksfernsehen an und rechtfertigt sich noch heute dafür.“ Ich wollte so gerne Benjamin von Stuckrad-Barre kennenlernen.“ Das gelang, und anderes. Danach zog er in das unscheinbare Alpenkaff Belluno, lernte italienisch und halbierte beinahe sein Gewicht. Seine Lust auf Naturweine brachte ihn bis ins CoVino. Nach dem ersten Lockdown verlor er den Job, übte Gitarre. Seit dem Sommer ist er wieder dabei. Die Mannschaft hält sich mit kreativem Takeaway über Wasser, Chef Andrea auch mit Weinhandel, spezialisiert auf Orange-Weine. Anna fotografiert ihn für einen neuen Webauftritt.
Danach zog er in das unscheinbare Alpenkaff Belluno, lernte italienisch und halbierte beinahe sein Gewicht. Seine Lust auf Naturweine brachte ihn bis ins CoVino. Nach dem ersten Lockdown verlor er den Job, übte Gitarre. Seit dem Sommer ist er wieder dabei. Die Mannschaft hält sich mit kreativem Takeaway über Wasser, Chef Andrea auch mit Weinhandel, spezialisiert auf Orange-Weine. Anna fotografiert ihn für einen neuen Webauftritt. Und nun? „Es wird wie eine Rakete abgehen, sobald genug Menschen geimpft sind und die Quarantänepflicht aufgehoben wird“, meint Andrea. „Venedig ist doch der erste Ort, den Menschen besuchen wollen. Das wird hier wie eine Bombe einschlagen.“ Mit dieser Meinung ist er allein.
Und nun? „Es wird wie eine Rakete abgehen, sobald genug Menschen geimpft sind und die Quarantänepflicht aufgehoben wird“, meint Andrea. „Venedig ist doch der erste Ort, den Menschen besuchen wollen. Das wird hier wie eine Bombe einschlagen.“ Mit dieser Meinung ist er allein.
Bei zahlreichen anderen Gesprächspartnern, die ich in diesen so stillen Wochen treffe, überwiegt die Skepsis. Mein Hotelmanager beobachtet, wie zögerlich die Reservierungen für die Zeit nach dem Lockdown anlaufen, anders als im vorigen Frühsommer: „Die Stimmung ist verzweifelt.“ 

 Die venezianische Eigentümerfamilie will das Haus verkaufen. Was wird dann aus dem Zimmer 304, dessen Magie ich glaubte, noch lange genießen zu können? Unzählige Restaurants und weitere Hotels fluten den Immobilienmarkt, obwohl das Hochwasserschutzsystem Mose seit dem vergangenen Herbst endlich zu funktionieren scheint. Einigermaßen.
Die venezianische Eigentümerfamilie will das Haus verkaufen. Was wird dann aus dem Zimmer 304, dessen Magie ich glaubte, noch lange genießen zu können? Unzählige Restaurants und weitere Hotels fluten den Immobilienmarkt, obwohl das Hochwasserschutzsystem Mose seit dem vergangenen Herbst endlich zu funktionieren scheint. Einigermaßen.
„Wie lange wirst Du bleiben?“, fragt Ronny mich.
„Bis ich tot bin.“
„Wunderbar“, meint er. Na denn.
Seit dem Beginn dieser Woche dürfen Bars und Restaurants im Freien wieder öffnen. Die Ausgangssperre bleibt. Mal sehen. P.S.: Gustavo heißt in Wirklichkeit anders und macht beruflich auch etwas Anderes. Doch in diesem Blog muss er vor Anderen geschützt werden. Hoffentlich schafft er das bald auch wieder für sich selbst.
P.S.: Gustavo heißt in Wirklichkeit anders und macht beruflich auch etwas Anderes. Doch in diesem Blog muss er vor Anderen geschützt werden. Hoffentlich schafft er das bald auch wieder für sich selbst.