
Ostfriesenpoller. Photo: Peter Grosse
„Gold wird aus Blei gemacht“ (Wladislaw Dubowizki, „Nahe Null“)
Ein Buch zu drucken, um damit Geld zu machen, ist einfach, aber um sich das nötige Geld selbst zu drucken, dazu braucht es mehr – u.a. spezielle Apparaturen und Fertigkeiten. Zudem machen es die Druckereien der Zentralbanken den Geldfälschern immer schwerer, indem sie ihre Banknoten mit Wasserzeichen, Hologrammen und Silberfäden versehen.
Ich war mir unsicher, ob ich 2006 einen gefälschten 50-Euroschein in die Hände bekommen hatte – und ging mit ihm bei einem türkischen Kiosk einkaufen. Der Verkäufer besah sich die Banknote, sagte nach kurzem Zögern: „Na ja, geht so!“ und gab mir die verlangte Ware sowie das Restgeld heraus. Neulich bekam ich beim Einkauf im Supermarkt erneut einen gefälschten 50-Euroschein zurück – ohne das ich es merkte. Erst als ich damit am Wochende ein Auto mieten wollte, flog die Fälschung auf: Der Angestellte steckte den Schein in ein Prüfgerät, bevor er ihn entgegennahm. Und dieser Apparat stieß plötzlich laute Warngeräusche aus. Daraufhin wurde das Bundeskriminalamt alarmiert – und die schickten zwei Damen vorbei. In der Zwischenzeit hatten wir uns den gefälschten Schein genauer angesehen – und mit echten verglichen: Er war ein bißchen kleiner, das Papier war einen Tick zu steif und die Farben etwas zu knallig. Die beiden LKA-Damen streiften sich albernerweise Gummihandschuhe über, bevor sie meinen Geldschein entgegennahmen und in eine Plastikhülle stopften. Dann schrieben sie meine Personalien auf und erklärten mir, den Geldschein könne ich vergessen. Laut Bundesbankgesetz §35 werde aufgefundenes Falschgeld ersatzlos eingezogen. Beim Gehen äußerten sie die Vermutung, dass die Banknote aus Rumänien käme. Die hätten sich da unten so auf den EU-Beitritt gefreut, dass sie schon zwei Jahre davor angefangen hatten, die Euronoten nicht nach-, sondern quasi vorzudrucken. Am Häufigsten würden jedoch Ein- und Zwei-Euromünzen gefälscht werden.
Das erinnerte mich an die bosnische Lebenskünstlerin Xenia, die – zu D-Mark-Zeiten noch – billige Bleifiguren einschmolz, um daraus 5-Markstücke zu machen. Damit ging sie abends in die Diskos und bat die Barkeeper in einem günstigen Moment – wenn sie gerade voll beansprucht waren – eine Münze in Markstücke umzutauschen – für den Zigarettenautomaten. Ihre Geldfälschung flog nie auf, einmal führte sie sie sogar öffentlich vor – als Performance quasi. Das war 1999 – im Rahmen einer von uns organisierten dreitägigen „Messe über Geldbeschaffungsmaßnahmen“ auf dem Pfefferberg.
Eine andere mir bekannte Geldfälscheraktion endete ähnlich künstlerisch-harmlos: Dabei handelte es sich ebenfalls um eine Frau (obwohl Frauen sich in aller Regel auf das In-Umlauf-Bringen der Blüten beschränken). Die junge Filmemacherin, aus Zürich in diesem Fall, wollte ihren ersten Film – über eine indische Tänzerin – mit gefälschten Schweizer Franken finanzieren. In Vorbereitung der Blüten-Herstellung recherchierte sie ausgiebig die damals gerade vom Staat ausgegebenen „noch fälschungssicheren neuen Banknoten“, machte Interviews mit Experten und Bankern und sprach mit Ingenieuren aus dem Druckgewerbe. Heraus kam jedoch, dass der Aufwand zu groß war. Die Filmerin machte aus ihrer Recherche schließlich eine kleine SWR-Dokumentation über die fälschungssichere Schweizer Währung – und das war es dann.
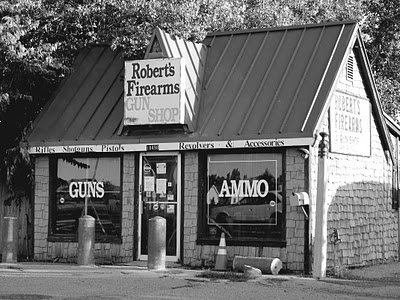
Amipoller. Photo: Peter Grosse
Erwähnt sei ferner der Westberliner Galerist und Satanist „Jes Petersen“, der – obwohl er einen Gutshof bei Flensburg geerbt hatte – ständig in Geldnot war, weil er zu viele arme Künstler aushielt. In dieser Situation erklärte er sich bereit, für eine Dollar-Fälscherbande in Italien den Westberliner Verteiler zu spielen – gegen Provision. Es gab noch einen zweiten Galeristen, der sich daran beteiligte. Eines Tages bekam Petersen einen Anruf: der Galerist sei verhaftet worden. Er geriet darüber derart in Panik, dass er fast eine Million Dollar in seinem Wohnzimmerofen verbrannte, den er damals noch besaß. Erst als er sich aus diesem „Geschäft“ ganz zurückgezogen hatte, erfuhr er, dass er zu voreilig gewesen war: Der Galerist hatte dicht gehalten.
Verhaftet wurde Petersen aber dann doch – 1993: wegen Kokainschmuggel aus Bolivien: Auch hier war er – zusammen mit einem Kunst- und Antiquitätensammler – Westberliner Verteiler gewesen, d.h. er hatte diesem bloß seine Galerieadresse zur Verfügung gestellt. Das Zeug bekamen sie in Papprollen geliefert, in denen sich zum Schein Kunst aus Lateinamerika befand. Petersen mußte dafür zwei Jahre ins Gefängnis. Vergeblich reichten seine Verteidiger mit Unterstützung einiger „Personen des öffentlichen Lebens“ ein „Gnadengesuch“ ein, in dem sie auf die „kulturellen Verdienste“ hinwiesen, die er sich als Kunstmäzen zwischen Mauerbau und Mauerfall in Westberlin erworben hatte. Als Petersen aus dem Gefängnis kam, war er erst einmal entsetzt, weil die Polizei beim Durchsuchen der Wohnung und Galerie sein umfangreiches Archiv zerfleddert hatte, das er für seine „Lebensgeschichte“ brauchte, an der er auch in Haft weitergeschrieben hatte. Seine ersten Geschäfte als Galerist und Verleger hatte der gelernte Bauer Petersen noch mit Pornographie gemacht: „Das wurde aber damals noch mit einer ähnlichen Leidenschaft und Sorgfalt verfolgt wie heute der Drogenhandel.“ Der Vertrieb lief schon damals über Südamerika, wo bei jemandem die Bestellungen eingingen. „Sie wurden dort auf einen winzigen Punkt verkleinert, in einen harmlosen Text montiert und dann in Flensburg wieder vergrößert“. Bis 1962 waren die staatsanwaltlichen Schikanen in Schleswig-Holstein jedoch derart „kompakt“ gediehen, daß Petersen nach Westberlin auswich. Hier war sein ständiger Galeriegast und Mittrinker dann der Klavierstimmer Oskar Huth. Dieser hatte während der Nazizeit als untergetauchter Zeichner des Botanischen Gartens auf einer Wehrmachtsdruckmaschine in seinem Keller Lebensmittelkarten gefälscht, mit denen er über 100 in Berlin untergetauchte Juden das Überleben in ihren Verstecken sicherte. Seine Lebensmittelkarten waren echter als die echten, denn sie hatten im Gegensatz zu diesen ein Wasserzeichen. Petersen gewann durch Oskar Huths Erzählungen eine Vorliebe für Fälschungen. Einmal wollte er eine Ausstellung mit Werken des Kunstfälschers Konrad Kujau organisieren. Seine Autobiographie sollte den nordischen Titel „Jes Petersens wundersame Reise“ bekommen. Aber er starb 2006 überraschend. Seitdem bringt der Historiker Andreas Hansen regelmäßig kleine Abschnitte aus Petersens Nachlaß heraus.


Kaputter Ostpreußenpoller, vom Hausmeister des „Gräfin Dönhoff-Gebäudes“ der Frankfurter Viadrina geflickt. Und dann einmal von vorne und einmal von hinten photographiert – von Philipp Goll.
In all diesen mir bekannt gewordenen Fälschungs-Fällen ging es noch um den Einzelnen – und seine Geld- bzw. Überlebensprobleme. Während des Zweiten Weltkriegs haben auch die Staatsbankiers darüber nachgedacht, die Währung ihrer jeweiligen Gegner zu zerstören, indem sie sie in Massen fälschten und auf seinem Territorium in Umlauf brachten. „Besonders originell war diese Idee nicht“, schrieb „Die Welt“, aber die Deutschen organisierten dazu gleich zwei Fälscherwerkstätten: Die SS ließ 200.000 Zehn-Pfundnoten drucken, „die Projektverantwortlichen waren jedoch mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Bemängelt wurde zum einen die Qualität der Fälschungen, zum anderen, dass kräftig gestohlen wurde“. Die zweite „Geheimdruckerei“ unterstand dem Chef der SD-Auslandsaufklärung und befand sich im KZ Sachsenhausen. Dort mußten Häftlinge US-Dollar und Pfundnoten drucken. Sie produzierten insgesamt neun Millionen Banknoten – im Wert von 134 Millionen Pfund, das waren 13% der echten Banknoten, die im Umlauf waren. Um sie in Verkehr zu bringen, baute man ein „gigantisches Geldnetzwerk auf dem Kontinent auf“. Mit den erzielten Profiten wurde die „Einsätze ausländischer Agenten“ und „Kriegsmaterial für die SS-Verbände auf dem Balkan“ finanziert. „Die Welt“ resümierte: „Die kursierenden Pfundnoten waren nicht kriegsentscheidend, haben aber dazu beigetragen, das Vertrauen in die englische Währung zu unterminieren“.
Einer der daran beteiligten KZ-Häftlinge, Adolf Burger, veröffentlichte 2007 ein Buch darüber – „Des Teufels Werkstatt“. Sein Bericht wurde wenig später verfilmt – unter dem Titel: „Die Fälscher“. 2010 veröffentlichte der englische Journalist Lawrence Malkin noch eine zusammenfassende Darstellung darüber: „Hitlers Geldfälscher. Wie die Nazis planten, das internationale Währungssystem auszuhebeln“. Die Pointe dieser „Projekte“ bestand für den Autor darin, “ dass eine nicht geringe Zahl gefälschter Banknoten aus dem KZ-Projekt dem jüdischen Untergrund zugespielt wurde, der damit nach Kriegsende Versorgungsgüter für Holocaust-Überlebende bezahlte und Flüchtlinge nach Palästina schmuggelte. Das Geld wurde, wie Malkin schreibt, darüber hinaus auch dafür eingesetzt, um über den Mossad auf dem Weltmarkt für den entstehenden jüdischen Staat Waffen zu beschaffen“.


Zu kurzer Staatspoller vom Hausmeister eines Charlottenburger Mixed-Use-Komplexes verbessert – und von vorne sowie von hinten photographiert von Heinz-Werner Lawo.
Eigentlich findet ein ständiger Geldkrieg statt – zwischen Drucken von oben und Fälschen von unten. Die Amerikaner haben im Vietnamkrieg versucht, sogar das Verteilen der von ihnen gefälschten Banknoten von oben zu organisieren, wenn man dem US-Schriftsteller Thomas Pynchon glauben darf, der in seinem neuen Roman „Natürliche Mängel“ berichtet, dass die CIA eine Zeitlang nordvietnamesische Banknoten druckte, „und zwar im Zuge eines Plans, die feindliche Währung dadurch zu stabilisieren, daß man bei routinemäßigen Bombenangriffen im Norden Millionen dieser Blüten abwarf.“
Umgekehrt hätten dann „rotchinesische Witzbolde“ Dollarnoten in Umlauf gebracht: „Die Graveurarbeit war exquisit“ – nur dass auf den Geldscheinen statt Lincoln der damalige US-Präsident Nixon abgebildet war. Angeblich „kursierte das Zeug schon eine ganze Weile als Ersatzpapiergeld in Südostasien und war vielleicht sogar in den Staaten verkehrsfähig.“ Das FBI konnte zwar eine große Menge sicherstellen, aber ein Teil verschwand auch hier im Untergrund – nämlich in der kalifornischen Hippieszene, die sich z.B. „mit diesen Nixon-Zwanzigern am Hollywood Boulevard“ neu einkleidete. Die meisten Blüten wurden jedoch für Rauschgift ausgegeben.
In der Hippiebewegung hieß es „Turn on, tune in, drop out““: Nimm einen LSD-Trip oder einen Joint, stell dich auf die neuen Umgangsformen – z.B. im Hippieviertel Haight-Ashbury von San Francisco – ein und steig aus: aus dem ganzen“Schweinesystem“: der verfluchten „Leistungs- und Konsumgesellschaft“. Statt LSD und Haschisch wurde aber schon bald an allen Ecken Heroin verkauft. Der Dichter Allen Ginsburg durfte sich über diesen Drogen-Wechsel auf der Seite 1 der New York Times äußern. Er schrieb, dass die ganzen Heroin-Dealer von der US-Regierung mit dem Stoff beliefert würden. Und diese wolle damit die Bewegung der „Aussteiger“ (Drop-Outs) zerschlagen. Der New-York-Times-Herausgeber Arthur Sulzberger fand diese Anschuldigung so absurd, dass er auf der selben Seite dagegen Stellung nahm. Jahrzehnte später mußte er jedoch einräumen, dass Allen Ginsburg Recht gehabt hatte.

Vietnampoller mit Volkskunst. Photo: Peter Grosse
Torontopoller mit Künstlerkunst. Photo: Peter Grosse
Jetzt hat die amerikanische Federal Reserve Bank bekanntgegeben, dass sie mehr als 600.000.000.000 „neue Dollarnoten“ drucken wird. China und Rußland drohten daraufhin, den Anteil an US-Staatsanleihen in ihren Devisenreserven zu reduzieren. Einige Kommentatoren meinten, die USA versuchen sich damit am eigenen Schopf aus dem Sumpf – der Überschuldung – zu ziehen. Andere sehen in diesem Staatsakt der Amerikaner einen letzten Versuch, den Dollar als Leitwährung zu halten.
In den Sechzigerjahren gab es schon einmal einen ernsten Versuch, „neue Dollar“ zu drucken, aber von unten und gegen die Wirtschaft der USA gerichtet. Der Plan wurde von einer im französischen Untergrund gegen Franco kämpfenden Gruppe spanischer Anarchisten gefaßt. Zu ihnen zählte der Fliesenleger Lucio Urtubia, der darüber in seiner Biographie „Baustelle Revolution“, die kürzlich auf Deutsch erschien, berichtet.
1959, „kurz nach der Kubanischen Revolution“, lernte er in Paris die erste Botschafterin des neuen Kuba, Rosa Siméon, kennen. Sie vermittelte ihm ein Gespräch mit dem neuen kubanischen Zentralbankchef Che Guevara, dem er dann einige von seiner Gruppe gedruckte Geldnoten zeigte und ihren Plan erläuterte: Es ging darum, den Weltmarkt mit Tonnen von Dollar zu überschwemmen und so die US-Währung zu zerstören. Der kubanische Staat sollte helfen, sie zu drucken und in Umlauf zu bringen. Che besprach die Idee mit seinen Genossen und ließ Urtubia wenig später wissen: „Damit könnten wir der USA keinen Schaden zufügen, denn der Dollar sei die Leitwährung.“
Für Urtubia und seine Genossen war das „eine große Enttäuschung“. Sie waren als Flüchtlinge „ohne Papiere“ ins Land gekommen und verfügten inzwischen über große Erfahrungen im Fälschen von Ausweispapieren und anderen Dokumenten, mit denen sie Militante und Illegale ausstatteten. Nach Che Guevaras Absage beschlossen sie, den Plan ohne die Kubaner durchzuführen, statt Dollars jedoch Traveller-Schecks zu drucken. Die Gruppe stellte diese Zahlungsmittel dann zentnerweise her – und unterstützte damit die Guerillagruppen weltweit. „Die Arbeit war anstrengend, aber wenn du sie für ein Ideal machst, findest du daran Gefallen,“ schreibt Uturbia. Die betroffene Bank – die heutige „Citibank“ – geriet darüber in immer größere Schwierigkeiten.

Italienpoller, privat und staatlich. Photo: Peter Grosse
Weil er und seine Genossen tagsüber weiterhin als Fabrikarbeiter tätig waren und ein unauffälliges Leben führten, kam ihnen die Polizei nie auf die Schliche, obwohl sie sie immer mal wieder überwachten. Als er nach Jahren durch Verrat doch verhaftet werden konnte (in Sartres Stammcafé „Les Deux Magots“), erwirkte die geschädigte „Citibank“, dass er gegen Herausgabe der Druckstöcke wieder freikam. „Sein Prozeß endete mit einer symbolischen Verurteilung,“ schrieb der damalige Chef der französischen Spezialeinheit zur Terrorbekämpfung in seinen Memoiren empört. Er ist davon überzeugt, das Urtubia und seine Anarchistenbande vom Staatspräsidenten Mitterand persönlich geschützt wurde. Das war zwar nicht der Fall, aber die wegen der vielen gefälschten Traveller-Schecks immer mehr in Schwierigkeiten geratene „Citibank“ war damals das weltweit größte Finanzunternehmen, mit 50.000 Filialen, sie zahlte Urtubia sogar noch eine Entschädigung für seine „Geschäftsaufgabe“.
Für die Anarchisten war die Scheckherstellung und -verteilung u.a. an die Black Panther, die IRA, die ETA und die Tupamaros wie ein „Versuch“ gewesen, „die Geschichte von David gegen Goliath zu wiederholen. Aber so waren wir“. Es steckte also kein „Staatsgeheimnis“ hinter dem „Projekt“, und nur ein halbes hinter seiner Beendigung, die Urtubia als „eine ehrenhafte Vereinbarung zwischen zwei Parteien“ bezeichnet – der großen „Citibank“ und der kleinen „Organisation idealistischer Handwerker und Arbeiter“, die ein „richtiges Netz zur Geldbeschaffung“ aufbauten: „Wir waren in ganz Europa und Südamerika aktiv, immer zu zweit“.
Die „Citibank“, eine der übelsten Finanzinstitute weltweit, erholte sich leider viel zu schnell von dem „Schaden“, nicht zuletzt, indem sie aus dem Verkehr gezogenene Aktien im Wert von Zigmillionen Dollar heimlich wieder in Umlauf bringen ließ. Das war das selbe Verfahren, mit dem auch die englischen Posträuber reich und berühmt wurden: Sie stahlen 120 Geldsäcke mit aussortierten, entwerteten Banknoten und brachten sie wieder in Umlauf. Auch dem spanischen Anarchisten Lucio Urtubia ging es nach dem „Deal“ mit der „Citischweinebank“ nicht schlecht: Der heute 79jährige wurde öffentlich geehrt und sogar einmal in den Élysèe-Palast eingeladen, er gründete zwei legale Kleinbetriebe, eröffnete ein Kulturzentrum und besitzt heute ein Haus in seiner alten Heimat Navarra.

Japanpoller unter Baumblüte. Photo: Peter Grosse
Kommentar:
Als spätes „Schwarzmarktkind“ beschäftige ich mich immer mal wieder mit demeritorischen Gütern (Glückspiel, Prostitution, Pornos, Drogen, Wetten). Dazu favorisiere ich „intelligente Verbrechen“, die ja auch viel geringer bestraft werden. Zudem gehe die Entwicklung von der Zerstörung zur Entwendung. Dabei kann ich mich u.a. auf Thomas Pynchon berufen: „Is it O.K. to Be a Luddit?“ fragte dieser sich in der New York Times Book Review. Ludditen – so nannten sich ab 1811 Banden von maskierten Männern, die nächtens in England Maschinen der Textilindustrie zerstörten. Der Name geht auf Ned Lud zurück, der 1799 in Leicestershire „in einem Anfall rasender Wut“, wie es im Oxford Dictionary heißt, zwei Maschinen, mit denen Strumpfwaren gestrickt wurden, zerstörte. Die Einführung der Maschinen beschleunigte den Niedergang des Handwerkertums und die allgemeine Arbeitslosigkeit. Die offizielle Geschichtsschreibung bezeichnet die Ludditen als ebenso fortschrittsfeindliche wie hoffnungslose „Maschinenstürmer“. Marx ging dem gegenüber davon aus, dass die „Totengräber“ des Kapitalismus im Schosse desselben heranwachsen: „Sonst wären alle Sprengversuche Donquichotterie“.
Von den „Ludditen“ der neueren Zeit erfuhr man bereits 1953 in dem Roman „Das höllische System“ von Kurt Vonnegut, in dem es um die Massenarbeitslosigkeit produzierenden Folgen der Computerisierung ging, die den Menschen nur noch die Alternative Militär oder ABM läßt. Schon bald sind alle Sicherheitseinrichtungen und -gesetze gegen Sabotage und Terror gerichtet. Trotzdem organisieren sich die unzufriedenen Deklassierten im Untergrund, sie werden von immer mehr „Aussteigern“ unterstützt. Irgendwann schlagen sie los, d.h. sie sprengen alle möglichen Regierungsgebäude und Fabriken in die Luft, wobei es ihnen vor allem um den EPICAC-Zentralcomputer in Los Alamos geht. Ihr Aufstand scheitert jedoch. Nicht zuletzt deswegen, weil die Massen nur daran interessiert sind, wieder an „ihren“ geliebten Maschinen zu arbeiten. Bevor die Rädelsführer hingerichtet werden, sagt einer, von Neumann: „Dies ist nicht das Ende, wissen Sie.“
Thomas Pynchons Text in der „Book Review“ greift dieses vorläufige „Ende“ 1984 wieder auf: „Wir leben jetzt, so wird uns gesagt, im Computer-Zeitalter. Wie steht es um das Gespür der Ludditen? Werden Zentraleinheiten dieselbe feindliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen wie einst die Webmaschinen? Ich bezweifle es sehr…Aber wenn die Kurven der Erforschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Robotern und der Molekularbiologie konvergieren. Jungejunge! Es wird unglaublich und nicht vorherzusagen sein, und selbst die höchsten Tiere wird es, so wollen wir demütig hoffen, die Beine wegschlagen. Es ist bestimmt etwas, worauf sich alle guten Ludditen freuen dürfen, wenn Gott will, dass wir so lange leben sollten.“
Die hier vorgestellten Aktionen von Finanz-Ludditen spielten sich sämtlich vor 1984 ab – waren also noch alle „analog“. Pynchon hat dazu 2000 im Vorwort zu einem Buch von Jim Dodge über eine untergetauchte kalifornische Aussteiger-Gruppe Stellung genommen: „In Dodges ,Kunst des Verschwindens‘, das ein erstes Beispiel für einen bewusst analogen Roman ist, wird man nicht nur eine Gabe für Prophetisches bemerken, sondern auch eine ständige Verherrlichung jener Lebensbereiche, wo noch bar bezahlt wird – und die sich daher dem digitalen Zugriff widersetzen.“ Das spricht dafür, dass Geldfälschungen auch jetzt noch eine reale Chance haben.
Neuerdings fordert der belgische Ökonom Bernhard Lietaer sogar legale „Initiativen von unten“, d.h. gegen die Zentralwährungen gerichtetes „Komplementärgeld“. Im Prenzlauer Berg wurde Derartiges bereits 1993 mit dem Local Exchange Trading System „Knochengeld“ von einer Künstlergruppe um den Dichter Bert Papenfuß realisiert. 2010 veröffentlichte der Krimiautor John S. Cooper schon einen ersten Krimi – „Zero“, der davon handelt, dass ein solches „digitales Komplementärgeld“ auf kriminelle Weise von der Zentralbank „geschluckt“ wird. Im Spiegel wurde der US-Bestsellerautor gerade entlarvt: Dahinter stecken die grundguten Verschwörungswitterer Mathias Bröckers und Sven Böttcher aus Norddeutschland. Aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter.

Duisburger Pollermann. Photo: Peter Grosse
Termin:
Am 16.2. findet zwischen 10 und 12 Uhr – wahrscheinlich in den Räumen der NGBK in der Kreuzberger Oranienstrasse – eine Pressekonferenz mit Dietmar Dath und den linken Berliner Buchläden statt. Sie haben einen Gerichtsprozess zu gegenwärtigen, in dem es um „Das Wort als Waffe“ geht, d.h. sie werden angeklagt, Schrifttum verkauft zu haben, u.a. die Zeitungen „interim“ und „radikal“, in denen zur Gewalt aufgerufen wird – deren Autoren bzw. Herausgeber aber für die Polizei nicht zu fassen sind. An ihrer Stelle sollen nun die Texthändler verknackt werden.
Interessant:
Von taz-Redakteur Michael Ringel erfahre ich gerade, dass auf dem Grabstein von Herbert Marcuse auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof nur ein Wort steht: „Weitermachen!“



